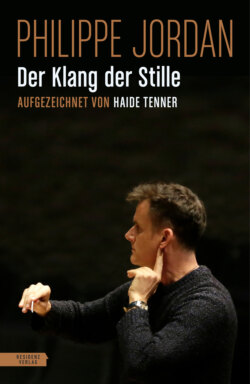Читать книгу Der Klang der Stille - Haide Tenner, Ignaz Kirchner - Страница 8
Die Galeerenjahre
ОглавлениеEines Tages rief mich eine ältere Gesangslehrerin aus Zürich, eine Frau Gerhard, an. Mit etwas gebrechlicher Stimme ließ sie mich wissen, dass sie für ihre Gesangsschüler für einige Stunden einen Begleiter bräuchte, es gäbe auch ein wenig Geld dafür. Obwohl ich zu dieser Zeit eigentlich mein Diplom vorbereiten musste, sagte ich zu. Frau Gerhard wurde zu meinem Schutzengel, weil sie immer wieder darauf bestand, ich müsse dirigieren. Auf ihre Anregung hin schrieb ich an alle in Frage kommenden Agenturen. Die meisten antworteten natürlich nicht, doch dann kam eine Nachricht von einer Stuttgarter Agentur, sie hätten meine Bewerbung an das Stadttheater Ulm weitergeleitet, wo auch Karajan begonnen hatte, und das Vorspiel sei nächste Woche. Das war natürlich eine tolle Sache. Ich war erst neunzehn und kam bei diesem Vorspiel auch gut an. Da ich aber schon als Korrepetitor für den Ring in Paris zugesagt hatte, stand ich allerdings für den Beginn der kommenden Saison nicht zur Verfügung. Daher wurde die Entscheidung vertagt, ich musste noch einmal mit konkreten schweren Opernszenen kommen und auch mit Sängern arbeiten. Ich übte bis dahin fleißig und wurde so tatsächlich ab Herbst 1994 Korrepetitor mit Dirigierverpflichtung am Stadttheater Ulm.
Wegen meiner Verpflichtung in Paris konnte ich weder die Eröffnungspremiere vom Rosenkavalier noch Wiener Blut korrepetieren, und so war Funny Girl mein erstes Stück – ausgerechnet ein Musical! Aber beim Üben bemerkte ich, wie viel Spaß mir diese Musik machte. Außerdem ist man gleich mit allen Abteilungen des Theaters beschäftigt: mit Sängern, Schauspielern und dem Ballett. Das Schöne im deutschen Stadttheater ist, dass man irgendwann immer seine Chance bekommt. Nach zwei Monaten übernahm ich zwei Vorstellungen als Dirigent. Es gibt das ungeschriebene Gesetz an deutschen Bühnen, dass man auf jeden Fall eine zweite Vorstellung bekommt, um sich zu verbessern, denn beim ersten Mal kann ja immer etwas schiefgehen. Sollte auch die zweite Vorstellung nicht wunschgemäß klappen, bleibt man am Klavier. Das war natürlich alles sehr aufregend, ich durfte Bühnenproben und eine Bühnenorchesterprobe leiten und das erste Mal ein professionelles Orchester dirigieren.
Mein Vater half mir damals sehr, denn er hatte mich als Korrepetitor zwar sehr gelobt, aber an meinen Dirigierfähigkeiten hatte er noch große Zweifel. Die Grundlagen hatte ich zwar im Fach Orchesterdirigieren am Konservatorium gelernt und auch in der Dirigentenklasse hatte ich Klavier gespielt und zugeschaut, aber das war keine wirkliche Ausbildung. Mein Vater kam eine Woche vor meinem Debüt nach Ulm und ließ mich das Stück durchschlagen. Danach fragte er mich etwas verblüfft, wo ich denn das gelernt hätte. Er gab mir noch ein paar Ratschläge und kam auch zur ersten Vorstellung. Ich war hochgradig nervös, aber der Vorteil beim Musical ist, dass im Orchester der Drummer immer das Tempo hält. Egal was schiefgeht, man hat etwas, woran man sich festhalten kann. In der ersten Vorstellung passierte es dann auch nach 25 Minuten: ein Kapitalschmiss. Der Posaunist hatte mich nicht verstanden und nicht eingesetzt. Ich dachte, jetzt ist es aus, aber ich machte weiter. Später lernt man, dass es in einer solchen Situation meistens nicht aus ist, denn auch bei den Größten kann immer etwas schiefgehen. In der Pause waren alle sehr positiv, fanden den Schmiss nicht weiter schlimm, sondern hatten bemerkt, dass da ein Zwanzigjähriger mit den Sängern atmet, Freude an der Musik hat und diese auch weitergibt. Die zweite Vorstellung lief dann einwandfrei – ganz ohne Schmiss. Danach bekam ich von der zweiten Kapellmeisterin, die sich bereits bei meinem Vorspiel in Ulm für mich eingesetzt hatte, gleich die nächste Chance. Julia Jones dirigierte Wiener Blut, eine Operette, in der zwar alle Melodien von Strauß sind, aber das Stück als Ganzes stammt nicht von Strauß. Sie war der Meinung, ich sollte auch ein paar Vorstellungen übernehmen. Alle sagten, das sei schwerer zu dirigieren als Die Fledermaus, denn die Übergänge sind sehr oft ungeschickt geschrieben. Ich hatte auch großen Respekt davor, denn immerhin war es, wie mein Vater mir erzählte, Kleibers großes Erfolgsstück in Zürich, aber ich hatte große Lust auf diese Musik – allein schon wegen des Kaiserwalzers, der als Balletteinlage eingefügt war. Über die Weihnachtstage lernte ich fleißig. Die Ulmer spielten zwar viel Operette, aber einen Wienerischen »Nachschlag« musste man schon über eine gewisse Gestik vermitteln, was sich bei der Vorstellung dann auch bezahlt machte.
In dieser Saison dirigierte ich dann auch meine erste Oper: Don Giovanni. Rein technisch gesehen viel leichter als Wiener Blut, aber gestaltungsmäßig natürlich eine andere Kategorie. Wenn man in der Provinz eine Vorstellung übernimmt, kann man nicht viel anders machen als der für die Produktion verantwortliche Dirigent. Wenn ein Vorgänger ein Tempo vielleicht zu langsam genommen hat und alle darunter gelitten haben, kann man das zur Freude aller Beteiligten ändern, man kann auch die Dynamik ändern, muss es aber deutlich zeigen. Die Musiker waren sehr nett zu mir; wenn etwas unklar war, ließ mich das der Konzertmeister wissen, und die Hornistin sprach des Öfteren über das Thema Klang mit mir. Ein Orchester ist der beste Lehrer für einen jungen Dirigenten. Dazu war Ulm ein kleines Theater mit einer wunderbar kreativen Stimmung. In der Praxis lernt man etwa Dinge wie, dass man schnelle Läufe mitunter langsam spielen muss oder langsame Tempi eher fließend, wie man eine ganze Szene am Laufen hält oder wie man eine Szene, die nicht stimmig ist, durch das gewählte Tempo positiv beeinflussen kann. In einem kleinen Theater fix engagiert zu sein, bedeutet auch, dass sich niemand ein Blatt vor den Mund nimmt. Manche Kollegen sind nett, manche weniger, aber auch damit muss man lernen umzugehen. Jede neue Produktion, sei es Carmen oder Traviata, wird an einem so kleinen Haus wie eine Uraufführung erarbeitet, weil sie oft viele Jahre nicht auf dem Spielplan stand. Außerdem machen diese kleinen Theater alle Formen der Bühnenkunst: Oper, Operette, Schauspiel, Ballett, Musical, Kinderproduktionen, Kammeroper und Barockoper. Man lernt dadurch, welche Anforderungen das Theater abseits der Musik an den Dirigenten stellt: Dass man das Tempo für die Tänzer halten muss, wie man eine Schleife beim Musical dirigiert, in der die Musik sich so lange wiederholt, bis der Umbau oder Dialog fertig ist, oder dass man den Schlussakkord so lange halten muss, bis der Vorhang ganz gefallen ist. Ebenso wie man nach Dialogen mit der Musik einsetzt, dass man auf Scheinwerfer warten muss und dass es eben nicht nur darum geht, einfach die Musik zusammenzuhalten, sondern die ganze Vorstellung. Natürlich gab es in Ulm keine Sänger vom Niveau eines großen Hauses, sondern eher ältere Routiniers oder auch ganz junge Talente. Mit ihnen muss man behutsam umgehen. Jeder braucht individuelle Unterstützung, man muss vorsichtig sein mit seinen Kommentaren und Äußerungen. Bevor man Orchesterpsychologie lernt, muss man an einem Opernhaus Sängerpsychologie lernen, denn diese ist noch viel diffiziler. Schnell gehen da die Emotionen hoch und Tränen fließen. Als junger Dirigent will man sich einerseits merklich einbringen und hat einen starken Gestaltungswunsch, andererseits muss man sich auch zurücknehmen und auf die anderen achten, von denen man ja gleichzeitig auch viel lernen kann.
Im zweiten Jahr in Ulm verließ der erste Kapellmeister das Haus. Auch Julia Jones wechselte nach Darmstadt und es blieben außer unserem Generalmusikdirektor James Allen Gähres nur noch der Studienleiter, der zum Zweiten Kapellmeister aufrückte, und ich, da der andere Korrepetitor nicht dirigieren wollte. Dadurch kamen plötzlich viele wunderbare Aufgaben auf mich zu: Eugen Onegin, Der Bettelstudent, Così fan tutte, West Side Story, Die verkaufte Braut, Werther und Der fliegender Holländer. Es bewarben sich viele Dirigenten um den Posten des Ersten Kapellmeisters, aber im Orchester und auch von Seiten des Generalmusikdirektors hieß es immer wieder: »Warum bewirbst du dich nicht?« Ich war erst einundzwanzig und hatte Bedenken, ließ mich dann aber doch dazu überreden und nach meinem Vordirigat mit der Verkauften Braut fiel dann die Entscheidung tatsächlich für mich.
Bald kam dann meine erste Premiere mit Humperdincks Hänsel und Gretel. Das hieß für mich, zum ersten Mal Orchesterproben mit dem Opernorchester zu haben, denn bisher hatte ich nur das Kammerorchester in Ulm dirigiert, das ein Laienorchester war. Plötzlich hatte ich auch Verantwortung für die Sänger und war nicht mehr nur der »Nachdirigierer«. Ich trat dabei in jedes denkbare Fettnäpfchen. Man hatte mich schon vorgewarnt, dass dies ein schweres Stück sei, aber ich hatte keine Ahnung, wie schwer es tatsächlich ist. Durch die große Anspannung und weil ich es immer noch besser machen und perfekt vorbereitet sein wollte, verlor ich etwas von der spontanen Musikalität, die ich beim Dirigieren den Orchestermusikern bisher hatte vermitteln können. Hänsel und Gretel ist für ein Wagnerorchester geschrieben, aber mit leichten Stimmen zu besetzen. Das muss man akustisch perfekt im Griff haben. Anstatt nur etwas Kosmetik zu betreiben und die Lautstärke des Orchesters zu reduzieren, muss man das Stück aus seinem Geist heraus verstehen. Man darf vor allem nicht in die Wagnerfalle tappen, denn es muss wie ein Singspiel musiziert werden – eher wie Mozart oder Mahlers Des Knaben Wunderhorn. Ich nahm viel zu langsame Tempi, weil es sich für mich so nach Wagner anhörte, und die Musiker, die mich eigentlich mochten, waren ziemlich verzweifelt. Ich wollte mit meiner ersten Premiere natürlich die Aufführung des Jahrhunderts dirigieren. Mit einer Premiere von Hänsel und Gretel in Ulm! Dabei hätte es durchaus gereicht, einfach das Stück so gut wie möglich über die Bühne zu bringen! Ich war 22 Jahre alt und wollte unbedingt auswendig dirigieren, was ein Unsinn war und was niemand brauchte. Viel wichtiger wäre es gewesen, die richtigen Tempi zu wählen und einfach gut und stimmig zu musizieren. Für die Sänger hatte ich die »perfekte« Interpretation im Kopf, ohne zu wissen oder mich zu fragen, welche Intention der Sänger oder die Sängerin hat, wozu die Stimme geeignet ist und wie man damit umgeht. Sängerinnen und Musiker waren sehr ehrlich mit mir, was gut war, denn es gab wirklich noch viel zu lernen. Ich hatte mich selbst unter wahnsinnigen Druck gesetzt, weil ich so viel von mir erwartet hatte, aber es ist der Vorteil eines kleinen Hauses, dass sehr offen kommuniziert wird und dass einen das Orchester nicht auflaufen lassen will. Da lernt man sehr schnell, und als ich dann Janáčeks Jenufa herausbrachte, lief es bereits deutlich besser, obwohl das zunächst eine für mich völlig fremde Welt war. Ich beschäftigte mich intensiv mit diesem Werk, fuhr zunächst nach Dresden, um mir eine Vorstellung auf Deutsch anzusehen, in der Gwyneth Jones die Küsterin sang, denn auch bei uns in Ulm wurde das Werk auf Deutsch gespielt. In Frankfurt lief es dann zur gleichen Zeit mit der wunderbaren Anja Silja als Küsterin auf Tschechisch. Außerdem las ich Literatur über Janáček, hörte viel von seiner Musik und entwickelte langsam ein Gefühl für diesen Komponisten. Es wurde dann im Ganzen eine schöne Premiere. Angela Denoke, die schon auf dem Absprung nach Stuttgart war, sang Jenufa und wusste genau, was sie wollte. Damals begriff ich, dass man sich durchaus darauf einlassen kann und soll, was ein Sänger denkt, dass einem kein Zacken aus der Krone bricht, wenn man den Ideen anderer gegenüber offen ist. Kurz: Ich lernte, was Zusammenarbeit bedeutet.
Damals sammelte ich auch die ersten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Regisseuren. Ich war allerdings noch viel zu sehr mit mir und der Musik beschäftigt, um zu registrieren, dass auf der Bühne vielleicht etwas nicht funktioniert, wie zum Beispiel ein akustisch ungeeignetes Bühnenbild. Auch diese Dinge muss man erst lernen.
Das Zusammenspiel mit Regisseuren ist im Grunde bis zum heutigen Tag für mich immer ein schwieriges Thema geblieben. Meine besten Erfahrungen mit Regisseuren waren bisher zumeist Wiederaufnahmen, wie zum Beispiel Parsifal in Bayreuth von Stefan Herheim oder Michael Hanekes Don Giovanni in Paris, auch wenn Letzteres nicht ganz meine Sicht ist. Bei Neuproduktionen hatte ich ganz selten eine wirklich erfüllende Zusammenarbeit. Aber selbst wenn es einmal gut funktioniert hat, heißt das noch lange nicht, dass es beim nächsten Mal wieder so ist. Auch bei den sogenannten »Kennenlerngesprächen« bin ich inzwischen sehr vorsichtig geworden. Meiner Erfahrung nach ist ein solcher Erstkontakt niemals negativ, zumal der Regisseur ja engagiert werden will. Oft hat man den Eindruck, es gebe ein Grundeinverständnis über das Stück, aber spätestens bei der Klavierhauptprobe, wo zum ersten Mal alles zusammenkommt, sieht man dann, dass vieles ganz anders ist als ursprünglich besprochen. Manches hat man sich selber während der szenischen Proben schön gesehen und gerade bei Kostümen und der Beleuchtung gibt es dann böse Überraschungen. Umgekehrt gibt es aber manchmal auch positive Erfahrungen. Ich denke da zum Beispiel an die Entführung aus dem Serail anlässlich des Mozartjahres 2006 im Burgtheater unter der Regie von Karin Beier. Als wir uns kennenlernten, dachte ich: Das kann nie etwas werden. Sie fand die Dialoge altmodisch und schlecht und hätte am liebsten alles neu geschrieben. Ich wollte die Produktion verlassen, es kam zum Krach, Direktor Ioan Holender intervenierte und die Dialoge wurden »nur« modernisiert. Statt »Weg Niederträchtiger« hieß es dann »Hau ab, verzieh dich«. Damit konnte ich irgendwie leben, wenngleich es nicht meine Idee von Theater ist. Die anfänglich großen Bedenken zerstreuten sich aber im Laufe der Arbeit und ich hatte letztlich viel Spaß bei der Produktion, die dann auch ein Erfolg wurde.
Bei der Zusammenarbeit mit Regisseuren ist mir die Personenführung sehr wichtig. Deshalb schätze ich auch Sänger und Sängerinnen mit darstellerischer Intelligenz ganz besonders. Wenn ich mit einem Sänger arbeite, geht es nie nur um Intonation, Phrasierung oder Farben, sondern es geht immer auch um den Inhalt. Am problematischsten sind für mich einerseits Sänger, die in einer musikalischen Probe nicht an der Gestaltung arbeiten wollen und ohne Energie nur die Noten singen und andererseits solche, denen man in einer szenischen Probe nichts Musikalisches sagen darf. Ich möchte mit Menschen arbeiten, die für die ganze Sache brennen, mit denen man – durchaus auch kontroversiell – diskutieren kann, um letztlich einen gemeinsamen Weg zu finden. So soll es auch in der Zusammenarbeit mit der Regie sein.
Als Dirigent muss man sich mit dem Regisseur über die einzelnen Figuren genau absprechen, denn die musikalische Gestaltung muss mit der szenischen zusammenpassen. Vielleicht ist ein Regisseur anderer Meinung über die Psychologie einer Figur, kann mich aber mit schlüssigen Argumenten überzeugen und wir gehen dann diesen Weg gemeinsam. Oder das Gegenteil tritt ein, wie es zum Beispiel 2004 in Salzburg bei Così fan tutte der Fall war. Zu Beginn der Arbeit mit Ursel und Karl-Ernst Herrmann hatte mich zunächst die Idee fasziniert, dass die Frauen den Schwindel der Männer mithören, aber dann wurde mir im Laufe der Proben mehr und mehr klar, dass dieses Konzept nicht funktionieren kann. Ich hatte die Premiere bei den Osterfestspielen nicht dirigiert – das war Simon Rattle mit den Berliner Philharmonikern –, aber bei der Wiederaufnahme zu den Sommerfestspielen mit den Wiener Philharmonikern lief dann leider vieles aus dem Ruder. Hinzu kam damals meine Kontroverse mit den Herrmanns, deren Regiekonzept es nicht zuließ, dass ich vom Cembalo aus dirigieren konnte. Wir hatten ein paar Jahre davor in Brüssel gemeinsam eine sehr schöne Produktion von Rossinis Il Turco in Italia mit einem Klavier auf der Bühne gemacht. Bei Così fan tutte bekam ich mein Cembalo – damals war ich ein überzeugter Cembalo-Fetischist, was ich heute nicht mehr bin –, aber plötzlich stand dann ein Hammerklavier auf der Bühne. Dann fielen so polemische Sätze wie: »Was soll ein Cembalo auf der Bühne, da können wir den Sängern gleich Barockperücken verpassen!« Selbstverständlich muss es aber die Entscheidung des Dirigenten bleiben, welche Instrumente in einer Produktion verwendet werden! Das war allerdings nur der Aufhänger, denn letztlich sollten bei dieser Produktion sogar Dynamik, Tempo und Kunstpausen der Sänger ausschließlich von der Regie bestimmt werden! In einer szenischen Probe, als Rezitative geprobt wurden, die bekanntlich der Motor der Da Ponte-Opern sind, sah ich dann, wie sehr sich Musik und Regie immer weiter voneinander entfernten. Ich wusste ja inzwischen sehr gut, wie man Rezitative gestalten muss, schließlich hatte ich das bei Daniel Barenboim gründlich studieren können, der es wiederum von Jean-Pierre Ponnelle gelernt hatte. Riccardo Muti, James Levine, Harnoncourt – sie alle haben sehr viel an den Rezitativen gearbeitet, wohl wissend, wie wichtig das für den Ablauf der gesamten Produktion ist. Bei den musikalischen Nummern versuchten wir dann, die richtigen Emotionen zum Ausdruck zu bringen, um das Ganze noch irgendwie zu retten, aber von den zehn Vorstellungen gelangen vielleicht gerade einmal zwei oder drei. Daher wollte ich für die Wiederaufnahme im nächsten Jahr andere Bedingungen. Vor allem die Entscheidung über Tempi und über die Pausen in der Musik sowie Mitsprache bei der Sängerbesetzung, sollten wieder mehr nach musikalischen Maßgaben getroffen werden. Doch plötzlich hieß es alles müsse genau gleich gleichbleiben.
Intendant Peter Ruzicka war mir leider keine Hilfe, also sagte ich ab. Da alles noch dazu über die Medien ausgetragen wurde, waren die Salzburger natürlich besonders verärgert, dass sich ein so junger Dirigent mit ihnen anlegte, und danach blieben die Türen für mich geschlossen. Markus Hinterhäuser war dann nach seiner Ernennung sehr interessiert, mich wieder nach Salzburg zurückzuholen, aber das ließ sich wiederum wegen meines Engagements in Bayreuth nicht vereinbaren.
DANIEL BARENBOIM:
»Als Philippe Jordan zum »vordirigieren« kam, um mein Assistent zu werden, war er erst dreiundzwanzig Jahre alt. Er dirigierte die Ouvertüre zu Hänsel und Gretel, die sehr schwer ist. Er machte das extrem gut. Er war sehr, sehr bescheiden, fast scheu …
Ich wollte, dass er die Premiere von Christoph Kolumbus dirigiert, er lernte einen Sommer lang die nicht einfache Partitur mit Bühnenmusik und Chor und bei der ersten Probe im September schloss er als Erstes die Partitur und probte auswendig. Er hatte das Orchester innerhalb von fünf Minuten in der Hand … Jetzt ist er seit vielen Jahren Musikdirektor der Pariser Oper und Chefdirigent der Wiener Symphoniker. Ich bin sehr glücklich und sehr stolz auf Philippe Jordan.«
Statement aus der Dokumentation »Philippe Jordan – Zum Dirigieren geboren« (Telmondis / Arthaus Musik / RM Creative 2016)
In der Zeit, als ich in Ulm Erster Kapellmeister war, Premieren leitete und auch schon in Häusern wie Brüssel oder Graz gastierte, kam das Angebot von Daniel Barenboim, sein Assistent in Berlin zu werden. Man weiß, dass die Assistenten von Barenboim nicht nur Kaffee holen, sondern voll in den musikalischen Betrieb eingebunden sind und auch dirigieren. Eva Wagner, die mich aus der Zeit des Rings am Châtelet kannte und der ich in der Anfangszeit viel zu verdanken habe, hatte mich ihm empfohlen. Es gab ein kurzes Gespräch, das so typisch für Barenboim war. Er sagte nicht, was er brauchte, sondern fragte mich, was ich suchte. Dann wollte er mich einmal mit dem Orchester arbeiten sehen und zwei Wochen später, als er die Neunte Beethoven für das Silvesterkonzert probte, stellte er mich der Staatskapelle vor und sagte, dass mir die Musiker fünfzehn Minuten geben sollten. Ich wollte die Ouvertüre und den Hexenritt aus Hänsel und Gretel machen. Der Orchesterdirektor hatte es aber vergessen. Da das Werk lange nicht an der Staatsoper gespielt worden war, mussten die Noten von der Deutschen Oper Berlin geholt werden und das Orchester musste fast dreißig Minuten warten. Mir war das schrecklich unangenehm und die Stimmung schien schlecht. Ich hatte ja damals noch nicht so viel dirigiert und spürte plötzlich die ungewohnte Reaktion der Berliner Staatskapelle auf meinen Schlag. Ich fühlte mich nicht wohl, weil dieses Orchester, wie alle großen deutschen Orchester, hinter dem Schlag spielte, während ich in Ulm gewohnt war, dass auf den Schlag gespielt wird. Das war neu für mich und damit konnte ich damals noch nicht umgehen. Es war sicher kein gutes Vordirigat. Aber Daniel Barenboim strahlte, weil er, wie mir ein Geiger später erzählte, bei mir einen starken Gestaltungswillen sah, was ihm imponierte. Danach sagte er mir, dass er mich gerne ab der Spielzeit 1998/99 für vier Jahre engagieren wolle, und ich sollte gleich im Herbst die Premiere von Christoph Kolumbus von Darius Milhaud nach einem Libretto von Paul Claudel übernehmen, was niemand dirigieren wollte, weil die Musik ein typisches Produkt der Zwanzigerjahre mit vielen Chören und zum Teil überbordender Musik ist. Ich erkannte das sofort als eine große Chance, denn bei einer Neuproduktion lernt man das ganze Haus kennen: das Solistenensemble, das Orchester, die Technik, den Chor. Regie führte der berühmte englische Filmregisseur Peter Greenaway, was für mich nicht immer ganz einfach war, und die Musiker verstanden zunächst meine große Begeisterung für das Stück nicht. Erst im zweiten Jahr, bei der Wiederaufnahme, fand ich den richtigen Weg, den Funken überspringen zu lassen. Ich konnte dann auch schon besser mit dem Orchester umgehen, weil ich Barenboim viel bei seiner Orchesterarbeit beobachten konnte. Ich hatte mit der Zeit gelernt, ein Gespür dafür zu entwickeln, was man wann verlangen kann und wo man insistieren muss. Zu Beginn war ich einfach nur beeindruckt von der Qualität des Orchesters.
Von Barenboim lernte ich auch, wie man Sänger stimuliert, mit welcher Begründung man Künstler holt, wie man an Klangfarben arbeitet, wie man mit Sängern und Sängerinnen am Text arbeiten muss. Ich lernte, mit dem Orchester Bogenstriche, Fingersätze, Rhythmusfragen und Intonation zu besprechen – Dinge, von denen man als junger Dirigent fälschlicherweise glaubt, sie seien selbstverständlich. Daniel und ich hatten wunderbare Gespräche. Ich konnte ihn alles fragen. Immer ging es vor allem um Gestaltung, und erst am Schluss kam vielleicht auch die Frage: »Wie schlage ich das?« Es gab nie die Gefahr, ihn zu kopieren – im Gegenteil! –, ich konnte auch stets meine eigenen Tempi wählen, wenn ich ihm ein Werk nachdirigierte. Ich erinnere mich noch gut an einen Figaro in meinem ersten Jahr, bei dem ich sehr genau beobachten konnte, wie er an Rhythmus, Tempo und an der Farbigkeit der Rezitative arbeitete. Über Mozartinterpretation kann man ja immer diskutieren, aber Daniel Barenboim kommt natürlich vom Klavier und weiß aus dieser Perspektive genau, was er mit Mozart will. Einmal ließ er mich in einer Bühnenorchesterprobe eine halbe Stunde dirigieren, worauf ich gar nicht vorbereitet war. Aber so eine Situation muss man dann meistern und bei der Orchesterhauptprobe sagte er plötzlich, ich solle von Anfang an alles dirigieren. Zunächst wollte ich nicht, aber er entgegnete nur, wenn er krank wäre, müsse ich ja auch einspringen. Natürlich kannte ich das Werk gut, weil ich die szenischen Proben dirigiert hatte, aber dann das ganze Werk zu dirigieren, den Sängern die nötigen Einsätze zu geben, die richtigen Tempi zu wählen, alles richtig zu schlagen, ist doch noch etwas ganz anderes. Das Feedback nach der Probe war sehr positiv, was mich natürlich freute, zumal ich auf diesen Einsatz gar nicht wirklich vorbereitet gewesen war. Im Nachhinein war das insofern auch interessant, als ich zuvor bei Hänsel und Gretel im Ulm alles »richtig« machen wollte, jedes Detail kannte und das Ergebnis trotzdem nicht gut wurde. Dann macht man etwas ein bisschen improvisiert und es läuft viel besser. Trotzdem wollte und will ich immer perfekt vorbereitet sein, obwohl mir mein Vater schon in Ulm sagte, ich müsse lernen, ein Stück auch einmal »al fresco« zu machen. Das verstand ich damals nicht, mache auch heute noch nichts »al fresco«, aber ich denke, man sollte sich eine gewisse Spontaneität in der Arbeit erhalten, wach bleiben, um zu sehen, was angeboten wird und wie damit umzugehen ist. Wenn man keine Distanz zu sich selbst hat und nur das hört, was in einem selbst ist, hört man nicht, was draußen ist. Oder anders ausgedrückt: Innerlich muss man hören, was man hören will, und gleichzeitig das was wirklich da ist. Um diesen Unterschied gilt es sich dann Gedanken zu machen. Man darf auch keinen Tunnelblick auf ein bestimmtes Stück bekommen, sondern muss damit umgehen können, wenn man in der Früh mit einem Sänger ein ganz anderes Stück repetiert als das, was davor geprobt wurde, am Abend Butterfly dirigiert, am nächsten Tag an einer Wiederaufnahme arbeitet, dann eine Orchesterprobe von Barenboim besucht und am Abend dann Barbier von Sevilla leitet. Das ist Theateralltag, das ist wirkliches Musikerleben. Als junger, unerfahrener Dirigent ist man auf jedes Detail fixiert und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Heute weiß ich, dass man bei jedem Stück, egal ob Oper oder Konzert, zunächst von der großen Form, vom Überblick ausgehen muss. Dann ist man auch in der Probe offener und schneller. Ein Sechzehntellauf, der am Anfang einer Probe nicht gelingt, oder hin und wieder ein »Verspieler« ist unwichtig. Aber ob das Tempo geschärft ist oder der Rhythmus nicht stimmt, ob ein Übergang nicht funktioniert, das ist wesentlich. Für mich war dann Wagner der Schlüssel zu dieser Erkenntnis. Als ich in Zürich den Ring dirigierte und mich ein ganzes Jahr damit beschäftigte, lernte ich, großflächig über ganze Akte zu denken – bei Wagner eine unabdingbare Notwendigkeit. Man lernt mit der Zeit auch Vertrauen ins Orchester zu haben und die Musik nicht zu zerstückeln. Man lernt das vor allem mit Wagner, der ja nicht nur Komponist, sondern einer der ersten großen Dirigenten im heutigen Sinne war.