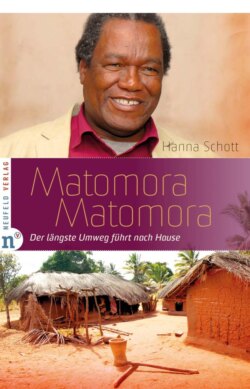Читать книгу Matomora Matomora - Hanna Schott - Страница 10
KAPITEL 4 Was wollen die Weißen?
ОглавлениеFür Deutsche ist 1961 das Jahr des Mauerbaus. Für US-Amerikaner das Jahr, in dem John F. Kennedy Präsident wurde. Für Russen blieb in Erinnerung, dass Juri Gagarin 1961 als erster Mensch den Weltraum bereiste. Für Tansanier ist 1961 das Jahr, in dem ihr Land unabhängig wurde. Für Matomora war es dennoch mehr als alles andere das Jahr, in dem er seinen Großvater rettete und dabei die seltsamen Weißen aus Mbesa wieder traf.
Tansania liegt nur wenig südlich des Äquators, und deshalb sind die Sommerferien die Ferien, in denen es angenehm kühl ist und man sich am besten erholen kann – ganz im Gegensatz zu den Weihnachtsferien, mit denen bei Staub und Hitze das alte Schuljahr endet, bevor im Januar, meist mit Beginn der Regenzeit, das neue Schuljahr beginnt. Als Matomora am ersten Ferientag im Sommer 1961 nach einer langen nächtlichen Busfahrt gegen Morgen Kalulu, sein Heimatdorf, erreichte, sein Bündel nahm und erleichtert aus dem Bus stieg, kam ihm einer seiner jüngeren Halbbrüder entgegengelaufen: »Geh nicht nach Hause! Hol lieber gleich Hilfe. Wir brauchen dich. Jetzt, sofort, du kannst doch Englisch.«
Matomora verstand kein Wort und wollte schon weitergehen. Aber der Kleine stellte sich ihm so breitbeinig, wie es nur ging, in den Weg. »Vater sagt, wir sollen uns von Großvaters Hütte fernhalten. Der schreit so schrecklich laut, das hält kein Mensch aus.«
Großvater? Der war in den letzten Ferien doch noch frisch und munter gewesen. Nicht der alte Matomora, der erfolgreiche Jäger. Der lebte schon lange nicht mehr. Großmutter hatte nach seinem Tod noch einmal geheiratet – oder müsste es heißen: sie wurde noch einmal verheiratet? Auf jeden Fall war der Großvater, der jetzt offensichtlich schwer krank war, nicht Matomoras biologischer Großvater. Aber er war doch derjenige, der in seiner Kindheit die wichtige Rolle des alten Mannes und Oberhauptes der Familie eingenommen hatte.
»Ich bin doch kein Baby, lass mich durch!«
Matomora machte am Bruder vorbei ein paar Schritte auf sein Zuhause zu, da kam ihm auch schon sein Vater entgegen.
»Kibwana, es ist irgendwas mit Großvaters Bauch, da kommt was raus, die Eingeweide oder ich weiß nicht was. Es muss höllisch wehtun. Renn nach Matemanga, da ist ein Mzungu, der kann helfen. Bestimmt versteht er Englisch. Aber schnell!«
Der Wortschwall des Vaters ersetzte die Begrüßung nach fünf Monaten der Trennung von Vater und Sohn. Matomora drückte sein Bündel dem kleinen Bruder in die Hand und machte sich auf den Weg. Fünfzehn Meilen, 25 Kilometer. Wie gut, dass es noch Morgen war, außerdem Sommer und nicht so schrecklich heiß wie bei seinem letzten Besuch in Kalulu.
»Beeil dich! Das ist so schlimm wie ein Schlangenbiss; es kommt auf jede Stunde an!«, hatte ihm der Vater noch nachgerufen.
Matomora sputete sich, und in Matemanga war der Mzungu schnell ausfindig gemacht. Arno Wobig hieß der »bunte Hund«, der seit ein paar Monaten im Dorf wohnte. Er sprach bereits ganz passabel Kisuaheli, das heißt, eigentlich sprach er am liebsten weder Deutsch noch Englisch noch Kisuaheli, denn er war ein zugeknöpfter Mensch, der lieber seine Hände als seinen Mund benutzte. Wobig erfasste die Situation sofort, startete den Landrover, bat Matomora einzusteigen und brauste los. In Kalulu wickelte er den schreienden und sich windenden Großvater in eine Decke, hievte ihn mit Matomoras Hilfe auf die Rückbank des Landrovers und brauste wieder los, diesmal in Richtung Mbesa. Ein junger Mann aus der weiteren Familie konnte gerade noch rechtzeitig ins Auto springen, um dem Kranken auf der mehr als zweistündigen Fahrt Beistand zu leisten. Dort, wo Matomora etwa vier Jahre zuvor die ersten Weißen gesehen hatte, war von genau diesen Männern inzwischen eine einfache Krankenstation errichtet worden: zwei Räume mit vier Betten für Frauen und vier Betten für Männer, dazu eine Veranda, die als Ambulanz diente – das alles zwar ohne Strom und fließendes Wasser, aber immerhin mit einem häufig genutzten OP. In den brachte man den Großvater, und Dr. Stein, im Gegensatz zu Wobig ein »echter« Arzt und sogar ein ausgebildeter Chirurg, warf im Schein der großen Taschenlampe einen Blick auf den Großvater. Er betrachtete kurz seinen Bauch, fühlte seine heiße Stirn, sah in seine roten Augen – und begann sofort mit der Operation. Etwa zwei Wochen später fuhr ein Fahrer den vollkommen genesenen Großvater, jetzt auf der Rückbank sitzend statt liegend, wieder nach Kalulu. Ein Bruch mit einer strangulierten Harnröhre hätte den alten Mann ohne einen Eingriff wohl kaum noch zwei Tage überleben lassen.
Die Freude im Dorf war groß – und das Erstaunen noch größer, als der Fahrer es ablehnte, für den eigenen Einsatz und den des »Daktaris« Geld zu nehmen. Nichts wollte er annehmen, selbst das wiederholte Händeschütteln schien er eher unwillig über sich ergehen zu lassen. Er gab sich Mühe, nicht grob unhöflich zu wirken, aber er machte sich doch los, sobald es möglich war, sprang in den Wagen und verschwand.
Was blieb, war ein erstauntes Rätselraten, das die Dorfbewohner noch lange Zeit beschäftigte: warum nur waren diese Männer in ihre Gegend gekommen? Was hielt sie davon ab, Geld zu verdienen, wo sich doch die Gelegenheit bot? Welchen Hintergedanken hatten sie bei dem, was sie taten?
Matomora hatte die Heimkehr des Großvaters verpasst, weil er die Ferien nutzen musste, um einige Meilen entfernt in einem anderen Dorf mit einem Ferienjob zu seinem Schulgeld beizutragen. Doch er rätselte genau wie alle anderen, nur dass er, der Weitgereiste, nicht beim ungläubigen Staunen bleiben wollte. Matomora nahm sich vor, der Sache auf den Grund zu gehen. Er würde fortan die Nähe der Weißen suchen und ihre Motive ergründen.
Doch so bald bot sich keine Gelegenheit. Im Gegenteil: gegen Ende des Jahres sah es so aus, als würden alle Weißen das Land verlassen. Am 12. Dezember 1961, kurz vor dem Ende des Schuljahres, wurde Tansania unabhängig. Schon im Mai hatte Tanganjika eine Verfassung bekommen, Nyerere, ein Sozialist und Katholik, der in England studiert hatte, wurde erster Premierminister, aber erst im Dezember erlangte das Land die volle Unabhängigkeit. Aus der Verschmelzung der Worte Tanganjika, Sansibar und der historischen Bezeichnung Asania für diesen Teil Ostafrikas wurde das neue Wort Tansania zur Bezeichnung einer freien Nation gebildet. Am großen Tag stand Matomora auf einem Platz in Tunduru und lauschte einem Mann, der ein Gedicht vortrug. Das war es auch schon. Nicht einmal eine Fahne wehte, denn die Flagge des neuen Staates musste erst noch entworfen werden. Einen Staatsakt hatte sich Matomora anders vorgestellt, aber ihn bewegte ohnehin vor allem ein Gedanke: würden die Engländer und die anderen Weißen jetzt verschwinden? Würden sie bleiben? Oder würden manche gehen und andere bleiben?
Ende Januar begann das neue Schuljahr. Und siehe da: in Songea fanden sich alle Lehrer ein, als wäre nichts geschehen: schwarze und weiße, Tansanier und Engländer, genauso wie einige wenige Amerikaner, die zum Lehrerkollegium gehörten. Matomora war erleichtert; die Spur der Weißen, auch der Deutschen, würde sich also vermutlich nicht so leicht verlieren. In Tansania schien ein sanfter Übergang in die neue Zeit zu gelingen.
Noch eine zweite Überraschung erwartete die Schüler an diesem Januartag: die neue Regierung erließ allen das Schulgeld. Der Zugang zu Bildung sollte jedem Kind unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern offenstehen – ein hehrer Grundsatz, der sich jedoch nicht lange durchhalten ließ. Eines Tages war einfach kein Geld für Lehrer, Gebäude und Internate mehr da, und die Eltern wurden wieder zur Kasse gebeten – doch da war Matomoras Schulzeit schon vorbei.
Gern wäre Matomora ja seiner Neugier, was die Motive der Deutschen anging, schon eher nachgegangen, aber erst in den folgenden Sommerferien bot sich dazu die Gelegenheit. Wieder einmal brauchte er einen Ferienjob (die gute Angewohnheit, in den schulfreien Wochen Geld zu verdienen, sollte er, so fand sein Vater, doch bitte beibehalten), und diesmal suchte er ihn gezielt in Tunduru, wo die Weißen inzwischen die Aufgabe übernommen hatten, das kleine, marode Krankenhaus auf Vordermann zu bringen – mit einem einzigen Arzt. Weil dieser Ort gut sechzig Kilometer von seinem Heimatdorf entfernt lag, musste Matomora eine Unterkunft finden. Und er fand sie wieder bei einem jungen Mann, bei dem er schon zweimal zuvor gewohnt hatte: Ali Saidi Ligombaji. Nur dass dieser plötzlich nicht mehr Ali Saidi, sondern Imanueli hieß. Als Ali Saidi war er market clerk gewesen, eine Art Steuereintreiber, der auf dem Marktplatz die angebotene Ware wog und vom Anbieter eine entsprechende Steuer einnahm. Zwei Sommer lang hatte Matomora ihn für jeweils sechs Wochen vertreten. Der Job war sehr begehrt und eine Art Auszeichnung, die er seinen guten Schulnoten verdankte. Im Dezember dann hatte sich jeweils ein zweiter Job angeschlossen: Zusammen mit einem messenger, der den eisernen Tresor trug, zog Matomora, den Tresorschlüssel in der Hosentasche, über die Dörfer, um bei den Bauern Steuern zu kassieren.
Nun also, im Sommer 1962, stand er dem alten Bekannten, aber neubekehrten Imanueli gegenüber, einem der ersten getauften Christen im Tunduru-Distrikt. Und einen neuen Job hatte der auch: statt market clerk war er nun facility manager – Mädchen für alles auf dem Gelände der Weißen. Die Ankunft der Deutschen hatte Imanuelis Leben völlig umgekrempelt, merkte Matomora. Kaum hatte er seine Matte in Imanuelis kleinem Haus ausgebreitet, da erzählte der ihm schon begeistert von allem, was er im letzten Jahr erlebt hatte. Gleich bei der ersten Begegnung war es nicht nur der selbstlose Einsatz der weißen Männer für die ihnen völlig fremden, kranken Menschen gewesen, der Imanueli beeindruckt hatte, er verstand auch schnell, dass es ein anderer Glaube war, der hinter ihrem Engagement stand.
An die Weißen heranschleichen brauchte Matomora sich jetzt wohl nicht mehr. Imanueli wurde für seinen jungen Untermieter in diesem Sommer zu einem Türöffner in eine neue Welt. Jeden Morgen ging Imanueli zur Morgenandacht der Missionare zu deren Haus hinüber. Die Brüder (so nannten sie sich) sangen und beteten auf Kisuaheli, so dass er der Andacht folgen konnte. Auch die Bibel wurde auf Kisuaheli gelesen.
»Komm einfach mit«, sagte Imanueli zu seinem Gast, »am Sonntag kannst du dann sogar einen ganzen Gottesdienst erleben. Oder traust du dich nicht?«
»Doch, doch. Warum sollte ich mich nicht trauen?«, antwortete Matomora, auch wenn ihm nicht allzu klar war, was dieses »Gottesdienst« wohl bedeutete. Er lachte. Sah er etwa aus wie ein Angsthase?
Neugier und Vorfreude wuchsen auf der Stelle. So schnell also würde er die Missionare aus nächster Nähe erleben.