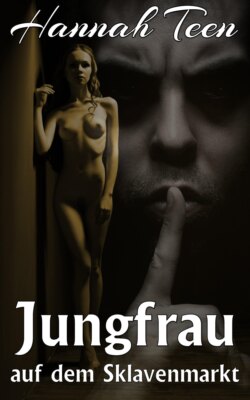Читать книгу Jungfrau auf dem Sklavenmarkt - Hannah Teen - Страница 4
I Sie
ОглавлениеMein Name ist Anna. Ich bin eine Mani. Eine junge Frau, die gemeinsam mit ihrem Bruder bei ihren Eltern lebt. Ich bin schlank, habe rote lockige Haare und falle in diesem Land damit natürlich auf. Vor allem, weil ich ziemlich hübsch bin. Das finden zumindest Andere. Ich selbst finde, dass es ein paar Sachen gibt, die besser sein könnten. Meine Brüste, ich finde sie einfach zu klein. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass die Nehatanerinnen immer recht große Brüste haben.
Und mich stören meine Sommersprossen. Meine Mutter findet sie toll, ich nicht so.
Mein Leben war unglaublich schön. Wir lebten zwar in einem fremden Land, hatten jedoch ein schönes Haus außerhalb der Stadt, mehrere Bedienstete und Sklaven und einen guten Ruf. Im schwarzen Land, wie wir es nannten, war das nicht selbstverständlich. Mein Vater war Händler für Stoffe. Edle Stoffe. Meine Mutter nähte Kleider und verkaufte diese. Die beiden Arbeiten passten natürlich perfekt zusammen. Ich war noch jung. Wusste nicht so richtig, was ich einmal machen wollte. Eigentlich war mein Ziel Manis. Das Land meiner Vorfahren. Auf Dauer wollte ich in Nehats nicht leben. Ich hatte bislang wirklich ein schönes Leben gehabt. Aber ich konnte mich einfach nicht frei bewegen. Ich hatte davon gehört, dass man in der manischen Stadt Hingston auch als nehatanische Frau über den Markt spazieren konnte ohne behelligt zu werden. Oder als Ragni oder Noatin. Es war im Grunde egal. Hier konnte ich es nur mit äußerster Vorsicht. Sofort waren Männer da. Nicht, dass sie mir unbedingt etwas taten, nein. Aber die Gefahr, dass irgendwann einmal einer auf die Idee kam mehr als nur schauen zu wollen, war hoch.
Ich wurde die Sklavin eines Irren. Aber meine Geschichte fängt etwas früher an. Bereits am ersten Tag dieser Woche konnte ich eigentlich erahnen, dass das Schicksal launisch war. Ich konnte nicht wissen, was wirklich auf mich zukam. Aber schon an diesem einen Tag war alles irgendwie seltsam.
Es begann damit, dass mich mein Vater weckte. Eigentlich mein Stiefvater. So richtig gut verstanden wir uns nicht. Er bevorzugte meinen Bruder, weil der sein eigenes Fleisch und Blut war.
Es war eigentlich schon spät, die Sonne war längst aufgegangen. Aber ich hatte lange geschlafen. Er wollte mit mir sprechen. Auch wenn mir sein Blick keine Hoffnung machte, dass es um etwas Positives ging, dachte ich mir nichts dabei. Ich stand auf, zog mich an und ging dann hinaus zur Essenstafel. Dort saßen meine Mutter und mein Stiefvater sowie mein Stiefonkel, der ebenfalls in Nehats lebte. Schon einige Zeit länger als wir. Er war der Bruder meines Stiefvaters. Er hatte damals meinem Stiefvater angeboten ihm beim Aufbau seines Geschäftes hier zu helfen. Damals hatte er seinem Bruder das große Glück vorgeschwärmt. Nun, uns fehlte es an nichts. Aber mein Stiefvater wäre auch in Hingston, in unserer Heimatstadt, erfolgreich gewesen. Da war ich mir sicher. Und hier waren wir im Grunde Fremde.
«Was gibt es?», fragte ich.
«Anna. Du bist ja zu einer richtigen Frau herangewachsen!», grinste mein Onkel mich an.
Ich wurde rot.
«Setz dich doch!», sagte mein Stiefvater etwas wirsch.
Ich gehorchte. Wenn auch unsicher.
«Wir müssen etwas mit dir besprechen», meinte nun auch meine Mutter. Sie klang nicht gerade so, als wäre es ein Gespräch über neue Kleider, die ich bekommen würde.
«Ja?», fragte ich leise.
«Ich würde dich gerne mit zu mir nehmen. Dich als Lehrling bei mir haben!», sagte mein Onkel. Ich nannte ihn schon immer Onkel. Im Grunde war er jedoch nicht mit mir verwandt. Zumindest nicht blutsverwandt.
«Als Lehrling?», fragte ich verwundert.
«Du musst etwas tun!», sagte mein Stiefvater: «Du kannst doch nicht ewig hier bleiben.»
Er hatte natürlich recht. Ich ging weder zur Schule, noch hatte ich wirklich einen Beruf. Ich half meiner Mutter, mehr aber auch nicht. Dennoch wollte ich auf keinen Fall zu meinem Onkel. Vor allem deshalb nicht, weil er eine Taverne besaß. Am Rande der Stadt. Das war definitiv nichts für mich.
«Du könntest irgendwann sogar meine Taverne übernehmen!», meinte mein Onkel.
Ich schüttelte den Kopf: «Bei den Göttern, nein. Ich werde Mamas Geschäft übernehmen. Irgendwann.»
Meine Mutter druckste herum. Ich spürte, dass sie mir nicht die ganze Wahrheit sagten. Doch schließlich brach es aus ihr heraus: «Ich werde in den Süden reisen. Dein Stiefvater wird mich begleiten.»
«Wirklich?», ich war überrascht: «Warum?»
«Der König hat uns an seinen Hof eingeladen. Damit wir dort für die Königin Kleider entwerfen.»
«Aber die Königsstadt ist im Osten!», meinte ich irritiert.
«Wir wollen in den Süden um Stoffe für den König einzukaufen. Das wird eine Weile dauern.»
«Warum kann ich nicht mit?»
«Wir haben das so entschieden!»
«Was ist mit Tom? Meinem Bruder?»
«Er wird mitkommen!», sagte mein Stiefvater.
«Warum er? Warum ich nicht?», natürlich wusste ich die Antwort. Weil mein Stiefvater es so wollte.
«Das geht nicht. Eine junge Frau wie dich du im wilden Süden? Nein. Das wäre nicht gut.»
«Aber in der Taverne soll ich helfen!», meinte ich mehr als schockiert und durchaus trotzig.
«Dein Onkel kümmert sich um dich», sagte mein Stiefvater.
Ich schaute hinüber zu meinem Onkel. Sein Blick war irgendwie seltsam.
Aber ich machte mir nur einen Augenblick lang darüber Gedanken. Ich schaute meinen Stiefvater an: «Das könnt ihr nicht machen. Ich möchte nicht in einer Taverne arbeiten. Warum kann ich nicht hierbleiben?»
«Du kannst hierbleiben!», sagte Mama: «Dein Onkel wird hier einziehen.»
«Na toll!», ich war wirklich nicht begeistert: «Und ab wann?»
Und dann kam der Schock. Es war für mich wie eine Ohrfeige, als mein Stiefvater meinte: «Wir fahren heute. In einer Stunde.»
«Was??», rief ich entsetzt.
«Es hat sich so ergeben. Der König hat einen Trupp zusammengestellt und diesen hergeschickt. Wir wussten nicht, dass es so schnell gehen würde.»
«Aber ihr wusstet es schon länger!», sagte ich energisch.
«Ja!», gestand meine Mutter etwas kleinlaut. Ich wusste, dass es ihr eigentlich nicht recht war. Sie hatte eine andere Meinung. Aber die zählte. Im Grunde hatte sie nie gezählt.
«Das ist nicht fair!», ich war außer mir. Doch ich wusste längst, dass ich keine Chance hatte. Vor allem deshalb nicht, weil die königlichen Truppen drängten. Niemand widersetzte sich dem König oder seinen Gefolgsleuten. Und niemand widersetzte sich meinem Stiefvater. Vor allem nicht meine Mutter. Es war nicht auf ihrem «Mist» gewachsen.
Ich rief nach einer unserer Sklavinnen. Ich hatte Hunger.
«Oh ... die Sklaven haben wir verkauft!», meinte mein Vater: «Heute morgen wurden sie bereits abgeholt.»
«Wieso das denn?»
«Um genügend Silberlinge zu haben. Um die Stoffe kaufen zu können.»
«Zahlt das nicht der König?», fragte ich irritiert.
«Erst müssen wir die Stoffe selbst bezahlen. Er zahlt uns erst, wenn wir in der Hauptstadt sind.»
Ich konnte es nicht glauben. Alles war so verrückt.
«Sei schön brav!», sagte meine Mutter, als sie abreisten. Ich weinte. Ich verstand einfach nicht, wie so schnell, in so kurzer Zeit mein Leben vollkommen auf den Kopf gestellt werden konnte.
«Hab dich nicht so, Schwesterchen!», grinste Tom, mein Bruder.
Ich schaute ihn böse an: «Fick dich!»
«Du bist ein Weib. Ich ein Mann!»
Ich schaute ihn böse in die Augen: «Du hast es gewusst, oder? Nicht erst seit heute.»
Er kam näher zu mir und flüsterte mir ins Ohr: «Vielleicht ficken sie dich. In der Taverne. Dicke fette schwarze Nehataner!»
«Arschloch!», meinte ich laut.
Mein Stiefvater kam zu mir. Gab mir eine schallende Ohrfeige. Ich schrie auf. Hielt mir meine schmerzende Wange. Dann heulte ich und ging in mein Zimmer.
Als sie schließlich weg waren, war es für mich so, als wären sie nur kurz in der Stadt. So richtig fassen konnte ich es nicht. Einzig und alleine die Anwesenheit meines Onkels brachte mich auf den Boden der Tatsachen.
«Ich werde dir einen Silberling pro Tag geben!», meinte er: «Dein erster eigener Lohn.»
Wow. Das hörte sich großartig an. Nein, nicht wirklich. Ich hatte hier nie irgendwas vermisst. Ich brauchte keinen eigenen Lohn. Ich hatte doch alles.
«Morgen früh geht es los!», meinte er, als ich nicht antwortete: «Sehr früh schon. Wir sollten deshalb früh ins Bett. Also mache mir etwas zum Essen.»
«Ich bin doch nicht dein Dienstmädchen!», sagte ich laut. Und schlagartig war mir klar, dass wir tatsächlich keinen einzigen Sklaven mehr hatten. Es war wie ein Albtraum.
«Du wirst nicht in diesem Ton mit mir sprechen!», sagte er zornig.
Ich starrte ihn an. Ich hatte noch nie viel von ihm gehalten. Aber jetzt zeigte er sein wahres Gesicht. Mir war mit einem Schlag klar, dass das keine rosige Zeit werden würde. Wenn ich schon alleine daran dachte, wie lange meine Eltern für die Reise in den Süden und schließlich in den Nordosten brauchten, Sie waren Wochen unterwegs.
«Vergib mir!», sagte ich schnell.
Er starrte mich wieder mit diesem Blick an, den ich morgens am Tisch gespürt hatte. Musterte mich von oben bis unten. Ich hatte ein weißes Kleid an. Wie es in Nehats durchaus typisch war, trug ich nichts darunter. Der Stoff meines Kleides war teuer und dünn gewebt. Ich wusste natürlich, dass meine kleinen Brüste sich gut abzeichneten.
Er kam näher zu mir. Starrte mich von oben bis unten an. Mit einem durchdringenden Blick. Ich spürte ein unheimliches Gefühl. Eine Art Schauer, der meinen Rücken Wirbel für Wirbel hinaufkroch und dann wie eine unsichtbare Hand meine Schulter erfasste. Und schließlich war mein Onkel so nah, dass ich seinen Atem an meinem Ohr spüren konnte. Leise flüsterte er: «Du wirst doch nicht ungehorsam sein?»
«Nein ...», sagte ich mit zittriger Stimme.
Er packte mich an den Haaren. Angst durchfuhr mich. Ich wurde fast schon panisch. Mein Herz klopfte wie wild. Er hatte mich noch nie angefasst. Aber ich sah ihn auch zu selten. Grob drängte er meinen Oberkörper auf den Tisch. Ich wurde stocksteif. War unfähig mich zu bewegen. Zumindest in diesem Augenblick. Dann raffte er mein Kleid nach oben.
«Bitte nicht!», schrie ich. Ich hatte panische Angst vergewaltigt zu werden.
«Was für ein Knackarsch!», meinte er lachend. Dann schlug er zu. Direkt auf meinen nackten Po. Mehrmals. Ich schrie jedes Mal laut auf. Aber hören konnte mich ohnehin niemand.
«Machst du mir jetzt endlich etwas zu futtern?», fragte er.
Ich wischte mir die Tränen aus dem Gesicht und strich mein Kleid glatt: «Ja!»
«Ja, mein Herr!», sagte er.
«Was?»
«Willst du noch einmal meine Hand spüren?»
«Ja, mein Herr!», sagte ich schnell.
«Gut so!», sagte er grinsend und setzte sich dann an den Tisch.
Ich machte ihm rasch etwas zu essen. Dann entschuldigte ich mich. Mir ginge es nicht gut. Das sagte ich ihm. Und im Grunde stimmte es.
Er lachte nur. Aber er ließ mich gehen. Rasch schloss ich mich in meinem Zimmer ein.