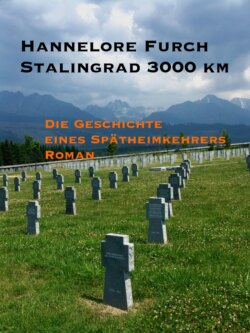Читать книгу Stalingrad 3000 km - Hannelore Furch - Страница 4
2
ОглавлениеSünders und Littmann gingen sich aus dem Weg, was auf der Baustelle gar nicht so einfach war. Der Trupp bestand aus neunzehn Arbeitern, die während der Frühstückspause im Graben aufgereiht saßen wie die Spatzen auf den Stromleitungen über ihnen. Sünders saß an dem einen, Littmann an dem anderen Ende. Wie üblich führten beide in ihrem Umkreis das Wort, die Unterhaltung zerfiel in zwei Teile und erzeugte eine unsichtbare Spannung, die jedem spürbar war. Es spiegelte sich die Situation zwischen Sünders und Littmann wider, wie sie damals schon bestand, als sich die Dorfjugend an Schumanns Ecke traf.
„Wenn der neue Bautrupp zusammengestellt wird, könnte man einen da unterbringen“, sagte Bakeberg zu Schetter, einem der Vorarbeiter, als beide nach der Frühstückspause noch zusammenstanden. Sie hatten die unangenehme Spannung wieder deutlich gespürt.
„Ja“, sagte Schetter, „aber unser Trupp ist so gut, weil wir die beiden haben, es sind die Zugpferde hier, geben das Tempo vor. Und schließlich kommt die gute Leistung des Trupps uns allen zugute.“
„Wenn die wieder zusammenrasseln, haben wir keinen von beiden mehr“, antwortete Bakeberg.
Die beiden waren eben im Begriff sich zu trennen, hielten im Schreck inne. Knappe zehn Meter von ihnen weg standen sich Sünders und Littmann mit erhobenen Schaufeln gegenüber, als gingen sie jeden Augenblick aufeinander los. Bakeberg fing sich und schrie zu ihnen hinüber: „Runter mit den Schaufeln, seid ihr toll geworden!“
Beide besannen sich schnell, die Schaufeln senkten sich zu Boden, dann die Köpfe. Littmann zog ab, Sünders blieb stehen. Bakeberg sah in die Runde: „Hat doch keiner was gesehen, oder?“ Er ging zu Sünders und warnte ihn: „Will gar nicht wissen, was da wieder war. Das allerletzte Mal, Hermann!“
Ein paar Arbeiter standen noch zusammen. „Bakeberg soll August abgeben in den neuen Trupp“, sagte Grubert zu Werremann, einem Neuen, der erst zwei Wochen da war.
„Wieso August? Den finde ich ganz in Ordnung. Aber den Hermann, mit dem hab' ich so meine Probleme. Der redet manchmal so, als hätte der allein die Knochen hingehalten im Krieg. Andere haben es auch, Littmann, soviel ich schon mitgekriegt hab', in der Normandie. Und wo war der Hermann?“
„In Stalingrad. Angeben tut der ja grade nicht, und spricht ja auch nur über die Ereignisse, nicht über sich selbst. Aber stimmt schon, es kommt dann so rüber, als ob der auf andere Kameraden bisschen herabsieht, die nicht in Stalingrad waren, aber ...“
„Jetzt besser nichts mehr“, schnitt Werremann ihm gereizt das Wort ab, als hätte Grubert seine eigene Meinung geäußert, „mein Bruder ist in Dünkirchen gefallen. Das werd' ich dem Hermann mal auf die Nase binden.“
Dazu suchte er die Gelegenheit und fand sie schon in der Mittagspause, als alle im Graben beieinander saßen und wieder einmal den Krieg nachkarteten.
„Wo warst denn du?, wandte er sich an Hermann und gab sich arglos.
„Ich?“ sagte Sünders, leicht verblüfft darüber, dass Werremann es noch nicht mitbekommen haben sollte, „in Stalingrad.“
„Und wo genau?" „LI. Armeekorps von Seydlitz-Kurzbach, 94. Infanteriedivision. Im Norden standen wir. Einen Tag nach Totensonntag Rückzug, mit Erlaubnis von Seydlitz. Wie wir später erfuhren, gegen den Befehl Hitlers. Hat uns das Leben gerettet, der Seydlitz mit seiner Eigenmächtigkeit. Werde ihm das nicht vergessen. Aber andererseits ist er ein Verräter, der im Lager Krasnogorsk den BDO mitgegründet und ihn dann zusammen mit dem Edlen von Daniels geleitet hat.“
Werremann war zufrieden, so ausführlich Antwort bekommen zu haben. Er tat, als wüsste er über alles Bescheid, was Sünders angeschnitten hatte, und nickte. Im Großen und Ganzen wusste er ja auch Bescheid und konnte ergänzen: „Ihr seid ganz schön mürbe gewesen, was? Rattenkrieg und jede Nacht die Kaffeemühlen am Himmel. Dazu sechzig Gramm Brot am Tag und geschmolzenen Schnee, damit’s runterrutscht. Wundert mich, dass man so überhaupt überleben konnte. Hast sogar die Gefangenschaft überstanden, die die Hölle gewesen sein muss, was man darüber so hört und liest.“
Er machte eine Pause, bevor er innerlich berührt fortfuhr, aber nicht von Sünders‘ Schicksal, sondern von dem, was er selbst gleich erzählen würde: „Ich hab' da einen Freund in der Südstadt, der war im Panzerkorps bei Hube, später noch in Gefangenschaft irgendwo bei Moskau. Ist aber '45 schon nach Haus gekommen, weil der kaputt war, nicht mehr arbeiten konnte. Kenn' den von früher, Karl Brehmer, war ein lustiger Kerl. Dem sind im Winter '41 auf '42 die beiden kleinen Zehen und zwei Finger abgefroren. Papier hatten die um die Füße gewickelt, Socken gab’s ja nicht, weil Hitler, der Irre, verboten hatte, einen Winterkrieg zu planen. Aber wem erzähl' ich das …
Da war bei Karl einer aus der gleichen Straße, sogar Schulkamerad von ihm, den haben sie morgens wecken wollen, weil der nicht aufgestanden war. Und der war ganz steif gefroren. Und vom Hauptmann ging wieder der Brief ab, diesmal nach Gifhorn, ‘gefallen im Heldentod für Volk und Vaterland‘, hätte nicht gelitten, ‘war gleich tot‘, und so. Und später hat der Karl seinen Nachbarn, damit die irgendwie weiterleben konnten, das so bestätigt, ‘war gleich tot‘ und so. Und Karl, der musste mit dieser Lüge leben und lebt heute noch mit ihr. Woher ich das alles weiß? Von meiner Frau, und die hat es von Brehmers Frau, der Else. Die Frauen sind alte Schulfreundinnen. Ein einziges Mal hat Karl alles erzählt, zu Hause, der Else. Und das war's dann, der Karl redet nichts mehr vom Krieg, kein Wort, der hat ein für allemal genug, der schweigt nur noch.“
Das solltest du besser auch, dachte Sünders im ersten Anflug, Werremanns Ton hatte zum Schluss wie eine versteckte Maßregelung gegen ihn geklungen, dann sagte er nur im ruhigen Ton: „Lass gut sein“.
Danach blieb Hermann still und versank in seinen Kriegs- und Gefangenschafts-Erinnerungen. Er wusste, wie richtig das alles war, was Werremann da erzählt hatte. Wie oft hatte er sie selbst gesehen, die Kameraden, die steif gefroren am Morgen in seiner Nähe lagen, tot. Und die vielen, die im Einsatz schon völlig entkräftet waren, dann, schon halb erfroren, zusammenbrachen, liegen blieben und erfroren. Die Zahl der Erfrorenen überstieg die der Gefallenen bei weitem, und dann, sie wussten es ja, die Lügenbriefe in die Heimat. Aber vieles war ihm nachträglich erst klar geworden.
Und dann die Gefangenschaft. Lager Beketowka, die Nachricht von Hitlers Tod. Bald darauf die von der Kapitulation. Ein Gefangener, der dem im Lager gegründeten Nationalkomitee Freies Deutschland angehörte, war rumgelaufen im Lager und hatte es bekannt gemacht, als verkünde er einen Sieg. Parallel dazu verkündete auch noch ein russischer Dolmetscher in jeder Baracke die Siegesmeldung. Für die beiden Boten war es eine, für ihn und die paar Kameraden, die es geblieben waren, mit denen er sich im Lager verbündet hatte, war es keine. Es war die bittere Erkenntnis, dass ihr Kampf um das Großdeutsche Reich, ihr gemeinsamer Lebenstraum, ihre Ideologie, erbarmungslos zerplatzt war, ihre Kameraden umsonst draufgegangen waren, dass es keine Kriegswende mehr gab, durch die sie aus der Gefangenschaft befreit werden würden. Und die pathetischen Versprechen vom Land im Osten für jeden, der ein Stück beanspruchte oder erträumte, wurden ihnen nachträglich zu Hohnreden.
Jeder wusste, was diese Siegesmeldung beim andern anrichtete, es war zu schlimm, um im Gespräch aufgerührt zu werden, noch ein Jahr lang zu schlimm, über das Jahr hinaus zu schlimm. Irgendwann hatten sie vorsichtig angefangen zu reden, über Anfang und Ende des Dritten Reiches, über ihre Rolle in ihm, über den Verrat an ihnen. Sünders überlegte, wer sie gewesen waren, diese Kameraden, mit denen er damals reden konnte, geredet hatte. Vier waren es, mit denen er gemeinsam den Überlebenskampf im Lager Beketowka gewonnen hatte. Er sah sie vor sich, die vertrauten Gesichter, holte sich ihre Namen in Erinnerung. Er hoffte, dass sie auch die Folgejahre überstanden hätten und heute vielleicht in Knesebeck, Erkelenz, Wolfenbüttel oder Overath wohnten. Nichts hatte er mehr von ihnen gehört, obwohl man sich damals schwor, in Verbindung zu bleiben, damals beim Abschied, Sommer 1945, als alle auf andere Lager verteilt worden waren, er selbst wurde ins Lager Nr. 50, Frolov, verlegt.
Noch einmal kam eine unerträgliche Zeit für ihn, als er vom NKWD in einem zehnminütigen Prozess zum Kriegsverbrecher abgeurteilt wurde. Ein Dolmetscher übersetzte ihm das Urteil und den Grund, die Erschießung von russischen Zivilisten in Stalingrad, und niemand gab ihm die Gelegenheit, sich zu verteidigen, dass er im Kampf Mann gegen Mann, Haus um Haus, wo es darum ging, zu schießen oder erschossen zu werden, auch durch Türen und Fenster schießen musste, wobei die Zivilisten getroffen wurden. Er und kein Mensch hatten damals angenommen, dass in der Straße noch Zivilisten sein könnten. Es war ein Schock gewesen für ihn, als er sie erschossen liegen sah in dem zerschossenen Raum. Aber er hatte sich verhalten, wie jeder Soldat im Kampfeinsatz sich verhält. Ein Kamerad von damals, der die Seiten gewechselt hatte und keiner mehr war, musste ihn verraten haben, das war ihm klar. Wahrscheinlich hatte dieser Verräter auch noch erzählt, dass er, Hermann, in der SA gewesen war, das hatte wohl zusätzlich das Strafmaß für ihn erhöht. Fünfundzwanzig Jahre Arbeitslager. Und es gab nichts und niemanden, an dem er seine Wut auslassen, niemanden, mit dem er über seine große Enttäuschung, Verzweiflung und Ohnmacht sprechen konnte. Er war den Russen und ihrer willkürlichen Aburteilung, durch die er ihnen lebenslang als billige Arbeitskraft für den Wiederaufbau zur Verfügung stehen würde, hilflos ausgeliefert. Ausgeliefert wie tausende andere hier und in den vielen anderen Lagern, jeden Tag sprachen sich diese Horrormeldungen im Lager Stalingrad 362 herum, in das er nach seiner Aburteilung kam. Nicht der Einzige zu sein, war ihm kein Trost. Er erinnerte sich, wie er und ein paar Mitgefangene damals - wieder hatten sich mit der Zeit ein paar Kameraden finden lassen - ihre Heimat, Deutschland, schlecht geredet hatten. Sie stellten sich vor, wie fremd ihnen die Heimat inzwischen geworden sein müsste, ein Vasallenstaat der West-Alliierten, die Angehörigen ihnen angepasst, vielleicht sogar zugetan. Den Kriegsgegnern zugetan, die ihnen selbst, den Gefangenen, Feinde geblieben waren. Feinde wie der Sowjetstaat, der sie auf russisch und ohne Dolmetscher im Zehn-Minuten-Prozess zu Kriegsverbrechern abgeurteilt hatte.
Was denkt man sich nicht alles, um ein unerträgliches Leben irgendwie ertragen zu können, entschuldigte Hermann vor sich selbst seine einstigen Gedanken. Dabei blieb es doch immer ihre Heimat, dieses neu geschaffene Deutschland, und nichts ersehnten sie mehr, als doch noch dahin zurückkehren zu können, zu ihren Angehörigen. Gleichzeitig diese furchtbare Hoffnungslosigkeit, dieses Erkennen, dass ihre Körper durch Schwerstarbeit, Hunger und Krankheiten langsam kaputtgingen. Es waren die Phasen, in denen die Hoffnungslosigkeit die Überhand gewann gegenüber allen anderen Empfindungen. Er und ein zweiter dieser kleinen Kameradschaftsgruppe stürzten in eine tiefe Depression. Der andere wurde dahingerafft, weil er, zuvor schon geschwächt, zusätzlich den dystrophischen Durchfall bekam und regelrecht austrocknete. Er, Hermann Sünders, überwand mit großer Mühe seine Depression, zum guten Teil aus eigener Kraft, aus einem immer noch vorhandenen, wenn auch eingedämpften Lebenswillen heraus. Was blieb, war eine große innere Leere, die nicht schwand, mit der er leben musste und irgendwie auch leben konnte.
Jetzt kam es Hermann so vor, als wäre sie noch da, diese innere Leere, nur abgemildert, man spürte sie nicht mehr so stark wie damals. Wie oft hatte er von damals bis heute versucht, diese grässliche Leere zu füllen, hatte die neuen Ideen der Zeit hin und her gedreht, hatte sich helfen lassen wollen. Sie wollten und wollten nicht passen, diese neuen politischen Ideen und Richtungen. Sie passten nur bei den hohlen Menschen, die immer hohl waren und blieben, und in denen die neuen Ideen selbst hohl wurden. Hohl war bei hohl, das passte immer. Mit ihnen wollte er nicht tauschen, dann lieber weiterkämpfen gegen die entstandene Leere. Er war Hermann Sünders, und er gab so schnell nicht auf. Auch er wollte weiterleben. Und es gab ja etwas, hier und jetzt, für das ein Weiterleben sich lohnte: sein Sohn, Ella, Mathilde, Emil. So schlecht war er nicht dran.
Wenn doch nur seine Mutter noch leben würde! Ihr Tod lag ihm wie ein großer, unverdaubarer Brocken im Magen, neben der Zeit im Kampf um Stalingrad, neben der Zeit seiner Gefangenschaft.
Das Gespräch über den Krieg war unterdessen weitergegangen, jemand fragte Werremann, wo er gestanden habe. „Ardennen. Glatter Lungendurchschuss.“ Die Arbeit hier ist der Versuch, ob's geht.“ Er atmete tief, um zu zeigen, bis zu welchem Grad es ging, es ging nicht sehr weit.
Der Trupp hatte viel geschafft an diesem Tag, und einen guten Teil des Lobes, den Bakeberg abends spendete, bezog Sünders auf sich, Bakeberg hatte ihn länger angesehen als die andern. Er fuhr zufrieden nach Hause.
Ella entnahm schon der Art, wie er in der Diele sein Rad abstellte, dass er guter Dinge sei, und war schon in der Küche, als er hereinkam. Er setzte sich zufrieden auf seinen Platz neben dem Herd, zog die Schnürstiefel aus und begann, seine Fußlappen abzuwickeln. Ella sah einen Moment zu, dann rückte sie mit ihrem Anliegen heraus: „Es gibt da ja das Geld vom Staat für Spätheimkehrer, das haben wir noch nicht beantragt, sollten es jetzt aber wirklich tun.“
Sie sah, wie Hermanns Blick sich verdüsterte, und betonte verstimmt, das hieß bei ihr mit abgesenkter Stimme: "Ich sag' das nur wegen der Kammer ganz vorn an der Dielentür. Da ist der Ausbau fertig, die könnten wir haben.“
„Wenn ich das Geld beantrage, bestimmt nicht, um es für unnütze Dinge auszugeben. Mir wird ganz übel, wenn ich von diesem neuen Staat hier Geld annehmen muss. Ist eigentlich nicht meine Sache, Hilfe vom Staat. Aber ich habe durch meine Gefangenschaft für Deutschland gebüßt, dann können die auch bezahlen dafür. Die Nazis gibt es ja alle noch, die sollen bezahlen, auch wenn sie alle abgetaucht sind, oder gerade deswegen sollen sie bezahlen, diese Betrüger im Charakterlichen. Aber das Geld wird bestimmt nicht für Konsum ausgegeben, auch nicht für Miete. Das wird dann zurückgelegt, damit man im Notfall was hat.“
„Das sind ja Töne, wie man sie von August her mehr schon zur Genüge kennt. Und wichtig ist, dass der Junge …
„Vergleich mich nicht noch mal mit diesem blöden Littmann“, drohte er, sonst mach' ich gar nichts. Ist schon schlimm genug, dass Luise uns den in die Verwandtschaft geholt hat. Und der Junge, der braucht jetzt noch keine eigene Kammer. In ein paar Jahren sehen wir weiter. Dann verdiene ich auch mehr als heute.“
„Ja wenn du denn noch Arbeit hast!“
„Wo alles kaputt ist und die Flüchtlinge Wohnungen brauchen mit Wasser und Kanalanschluss, da entlassen die mich?“, tat Hermann ironisch ab, „da mach dir man keine Sorgen um meine Arbeit.“
„Dann mietet jetzt die Bachmann für ihre Mutter die Kammer an“, sagte Ella verärgert und legte den Kaffeestreifen, den sie bei Kleimer für ihn geholt hatte, in das Fach des Kuchenbüfetts zurück, ohne sich darum zu scheren, ob er es sah oder nicht. Dann setzte sie ihm die randvolle Tasse mit dem Muckefuck vor, ohne jede Behutsamkeit, so dass er in die Untertasse schwappte. Sie setzte sich nicht zu ihm, sondern ging in die Stube. Dort saß sie und strickte, als sie seine Worte in grimmigen Gedanken wiederholte, „Ist eigentlich nicht meine Sache, Hilfe vom Staat.“
Als ob wir das Geld in Fülle haben, so hat sich das angehört. Dabei hab' ich selbst schon genug Pfunde eingebüßt. Hermann hat neulich selbst gesagt, dass ich wieder zunehmen soll. So mollig, wie ich früher war, als wir uns kennenlernten, soll ich wieder werden. Auch '42, als er auf Fronturlaub hier war, war ich noch so mollig, das hatte ihm gefallen. Aber wovon denn zunehmen?
Was war denn letzte Woche an Fleisch auf dem Tisch? Sonntag von der Dezemberschlachtung, eingemacht im Glas, die letzte Portion Schweinerippen, für fünf Personen, und für Hermann die Hauptportion, gut, soll er ja kriegen, aber denn die großen Sprüche lassen. Und abends denn die eingemachte Sülze, und Mittwoch die Speckscharte für den Kappeseintopf, und Mutter hat noch zwei Mark in die Tasse getan, als da Ebbe drin war.
Der Kaffeestreifen im Küchenbüfett fiel ihr ein. Was hat Annie Kleimer gesagt vorhin? „Ist ganz frisch aus der Backstube, Ella, und ich kann selbst nicht widerstehen.“ Dann hat Annie einen genommen und kräftig reingebissen. Wie das knusperte! Und ich hätte es doch so gern nachgemacht, aber das Geld nur gehabt für einen. Ja und jetzt? Da gibt es nix, der ist für mich, wenn der Hermann raus ist …
Sie ging, durch lautes Hühnergegacker gestört, ans Fenster. Das kommt ja wie gerufen, dachte sie, öffnete die Küchentür und sagte aufgeregt zu Hermann, so aufgeregt wie sie es ihrem Wesen nach konnte: „Ja du glaubst es nicht, das ganze Hühnervolk vom Haus ist in unserm Garten, und der Sepp von Feldners auch noch.“
Als Hermann seine Schuhe für draußen unterm Stuhl vorzog, fügte sie noch klagend hinzu: „Wie oft nur hab' ich den Kindern im Haus gesagt, 'macht die Pforte wieder zu, wenn ihr in den Garten geht.‘ Aber nee, sie machen es nicht."
Bei der Mietzahlung sprach Ella die Bäuerin auf den Antrag für das Spätheimkehrergeld an. Frau Kuhlmann klappte den Sekretär auf und holte ein Formular heraus. „Hier, lot dat von dien Kierl unnerschreven. Jo jo, darup hebbt ji woll Anspruch, dat is ook gaud so.“
„Gern beantragt der Hermann das ja nicht, er hat so seinen Stolz, und ärgert sich, dass es jetzt in Deutschland keine Leute mehr gibt, die Verantwortung für den Krieg und die Folgen übernehmen, die dazu stehen, was passiert ist. So denkt jedenfalls der Hermann als deutscher Arbeitsmann“, spöttelte Ella und redete dabei in ihrem herunterleiernden Ton.
Die Bäuerin überhörte die Ironie, sah von der Kladde auf, in der sie die Mietzahlung eintrug und meinte respektvoll: „Tje so? Tje dat sün de dütschen Lüe, de holt up sick. Tje, dat is woll so, wie dien Kierl dat seggt, Nazis givt et bi de Dütschen nich mehr, jo jo, so is dat woll.“
Nachdem sie einem Moment nachsinnend dagesessen hatte, besann sie sich ihrer Rolle als Frau des Bürgermeisters und der damit verbundenen Fürsorgepflicht für die Leute im Dorf und erklärte: „Dann mook ma wat, dat dien Kierl dat anners ankickt, dat Geld kunnt ji woll gut bruuken.
Wenn use Willem doch ook dobi wesen warr, bi de, de tröchkomen sün“, wich sie vom Thema ab und wischte hinter der Brille mit dem Finger eine Träne fort. Ihr Blick glitt zum Fenster hinüber, vor dem gerade ein Freund des Gefallenen auf der Dorfstraße vorüberging, ein Kriegsinvalide, der einen Arm eingebüßt hatte. Sie ging zum Fenster, schaute ihm traurig hinterher: „Tje, de Karl, overblieben vun de Hauermanns Jungs, man, man. „Allens hed so good anfungen, use Willem is jo bi de SA wesen, Karl Hauermann ook, un dien Hermann ook. Willem is denn Rottenführer woorn bi de SA, tje, und harr sick so öwer freut. He un de annern, all tausamm, hebben doch bloot de Krieg mitmookt, üm dat dütsche Riek scheun groot tau mooken. Wenn dat nu allens good gangen wöör, wat wöör dat ‘ne Ehr för de Soldaten und wat för ‘ne Freud bi alle Dütsche wesen. Nu ist de slecht utgangen, und nu ist de ganze Krieg und worüm de waar, slecht. Dat schall nu ‘n Minsch verstan. Un so schlimm dat allens, use Jung tot, ne ne.“
Sie wischte sich eine weitere Träne fort und ihre Stimme bebte leicht, als sie weitersprach, „wi mött mit leven, jo jo. Hermanns Mudder harr nich mit leven künn, as Hermann nicht tröchkom, as de Krieg vorbie was, un dobie dat schlappe Hart, – jo, jo …
Awers, un dat segg ich jümmer so tau mick sümst: Dat de Krieg slecht ungangen is, is de Strofe von use leve Hergott. De is runnerkomen vun Himmel und harr kiekt, wat de Hitler so mookt mit de Juden un so, un harr sick denn seggt: ‘Dat is de Düvel sülmst. Un alle Dütschen seggen nix un loten ihn mooken. So wat bruukt 'ne düchtge Strofe. Jo jo, un de is denn jo ook komen.“
„Ja, das ist wohl so“, sagte Ella, die nur wenig auf die letzte Rede der Bäuerin geachtet hatte und an die vorletzte anknüpfte: „Die Männer sind jetzt knapp im Dorf. So viele nicht zurück, es ist wirklich schlimm, und für euch tut es mir besonders leid. Der Wilhelm war immer freundlich zu uns, den Zugezogenen, es ist wirklich schade um ihn. Und ich mochte ihn auch sehr.“
Sie sah, wie die Bäuerin, die das Mietbuch aus dem oberen Fach des Sekretärs geholt und aufgeschlagen hatte, kurz innehielt und scheinbar überlegte, was sie darauf antworten sollte.
„Jo, jo, use Willem is bi de Mäkens gaud ankomen“, sagte sie dann nur und zog Tinte und Feder hervor, um die Mietzahlung ins Buch einzutragen.
Ella stand daneben und dachte dabei an „de leve Herrgott“ von Frau Kuhlmann. Der „leve Hergott“, er hätte doch nur einfach den Wilhelm gegen den Hermann auszutauschen brauchen und hätte ohne Mühe zwei Frauen glücklich gemacht, die Bäuerin und sie. Vielleicht hätte sie dann doch noch den Wilhelm gekriegt, wer weiß. Ach Quatsch, dachte sie, als Witwe eines Arbeiters schon gar nicht. Ausgeschlossen.
Aber war sie denn wirklich unglücklich? Sie gestand sich ein, dass sie sich nicht richtig vorstellen konnte, was das war. Man konnte schlecht sein, was man nicht kannte, also war sie nicht unglücklich. Bequemer hätte sie es gehabt ohne Hermann. Wirklich? Wohl doch nicht, er machte ja alles zu Hause, was schwer und unbequem war. Aber hatte eben seinen eigenen Kopf. Das störte. Aber letztlich kam es doch immer so, wie sie es haben wollte. Also bequemer oder leichter hätte sie es nicht gehabt ohne ihn. Wenn sie also nicht unglücklich war, es nicht leichter gehabt hätte ohne ihn, was war dann? War sie vielleicht doch glücklich? Sie gestand sich ein, dass sie sich auch diesen Zustand nicht richtig vorstellen konnte. Man konnte nicht sein, was man sich nicht vorstellen konnte, also war sie nicht glücklich. Wenn nicht, wieso nicht? Sie hatte doch alles, die Mutter, Luise, den Jungen, war gesund, hatte zu essen, eine gemütliche Wohnung, deren Fenster, im Sommer weinumrandet, nach zwei Seiten hin den Blick frei gaben auf das schöne Dorf, im Winter aus der warmen Stube auf verschneite Häuser und die Dorfstraße, was sie besonders liebte. Und sie hatte immer wieder schöne Ziele: Lavabel für ein Sommerkleid, zweiteilig, wie man es jetzt trug, Trägerkleid mit Bolerojäckchen, taubenblau mit weißen Tupfern, oder besser in weinrot, rot stand ihr noch besser als blau. Und dann die Kammer für den Jungen. Platz im eigenen Kleiderschrank, Platz für das neue Kleid. Ziele, die erfüllbar waren, ja, sie hatte alles! Hermann gehörte irgendwie dazu, also nahm sie ihn dazu, und so ungern auch nicht, schließlich war er doch ganz nützlich. Sie konnte zufrieden sein, und war es eigentlich auch, ja, sie sollte es zugeben: sie war es, sie war glücklich. Wie schön! Das könnte doch was sein, mit „de leve Herrgott“, auch für sie.
Die Bäuerin beendete ihren Eintrag in das Mietbuch und holte Ella in die Gegenwart zurück: „Hier, Ella, steck dat Schrieven mol in un de Antrag dotau, dien Kierl schall do glicks rinnkieken un utfüllen un dat“, sie klopfte mit ihrem dicken verarbeiteten Zeigefinger auf den Antrag, „denn wedder tröch to mick.“
„Ja, das Geld, es kommt sozusagen auf die hohe Kante. Der Hermann will davon keinen einzigen Pfennig ausgeben für Konsum und Miete, soll sozusagen der Notgroschen sein für die Familie.“
„Bi de veelen Johr in Gefangenschaft is de Notgroschen scheun grot“, sagte die Bäuerin und lächelte wohlwollend.
Wenn Hermann davon was abzwacken würde, könnten wir die Kammer dazumieten, die vorn an der Diele, die ihre gerade ausbaut. Die wäre was für Tommi, der wird ja bald dreizehn. Aber so reicht das Geld nicht.“
„So, so! Jo, de Komer. Da mött unner de Fööt noch de Bretter, Vaputz is ook no nich und de Pinsel mött noch öwer de Finsterrahmen.“
Sie strich mit der Hand übers Kinn, überlegte: "Dat künn dien Kierl sülmst mooken.“
„Ja was kostet die denn so, wenn wir das selbst machen?“ fragte Ella.
„Mött ierst mit mien Kierl dröwer snacken, awers ick snack so mit em, dat ji nich veel tau betohlen hebbt, villecht acht Mark. Is scheun, de Komer, und dat Finster kickt no de Strote hin.“
Den Weg nach Hause dachte Ella über das Gespräch mit der Bäuerin nach und überlegte kurz, wo die wohl abgeblieben sein sollten, die Nazis, was Hermann auch immer wieder mit großem Verdruss ansprach. Die freundliche Bäuerin zählte ihre Familie und sich offensichtlich nicht zu den einstigen Nazis und ihren Anhängern, oder besser gesagt, die Kuhlmann zählte ihre Familie nicht zu denen, die sich verantwortlich hielten für die Nazizeit und ihre Folgen. Andere ja auch nicht, dachte Ella, ihr fiel auch niemand ein, der sich hier in der Schuld sah, da hatte Hermann ja durchaus recht mit seinen Hassausbrüchen gegen die Abgetauchten.
Aber es war nur ein kurzer Gedanke, mehr beschäftigte sie die Sache mit der ausgebauten Kammer. Sie überschlug ihre monatlichen Ausgaben. Zur Zeit bezahlten sie 25 Mark für die drei zusammenhängenden Räume, und das war schon an der Grenze. Hermann verdiente 155 Mark 29 nach Abzug, damit kamen sie gerade so hin, weil sie jedes Jahr selbst ein Schwein durchfütterten, eine Ziege für Milch hielten, Hühner und Kaninchen im Stall und alles Gemüse im Garten hatten. Pullover, Unterwäsche und Strümpfe strickte sie mit ihrer Mutter ja selbst, und Kleidung, die die Mutter nicht selber nähen konnte, wurde nur zu Weihnachten, Ostern oder mal zum Geburtstag angeschafft. Einmal in der Woche fuhr sie zum Konsum nach Gifhorn, da die Lebensmittel dort billiger waren als hier im Dorf. Und doch trug sie zwischendurch zu viel Geld zu Kleimers. Die acht Mark waren beim besten Willen nicht aufzubringen.
Auf der großen Diele schielte sie zu der Tür hin, hinter der sie die unerreichbare Kammer wusste. Sie stellte sich vor, was es für Platz in ihrer Kammer gäbe, wenn Tommis Bett da raus wäre. Platz für eine Kommode für Unterwäsche, Pullover und so. In Gedanken suchte sie schon Tommis Sachen aus den überfüllten Fächern des Kleiderschrankes zusammen und räumte sie in eine neue Kommode, die für das neue Zimmer anzuschaffen sei. Und wo Tommis Bett stand, war Platz für eine Kommode für ihre Sachen, so dass im Kleiderschrank richtig viel Platz sein würde für neue Sachen. Oder die neuen kämen in die Kommode und die alten blieben im Schrank.
Wie auch immer, sie bekäme Platz für neue Sachen und das machte sie glücklich, auch wenn die neuen Sachen noch warten müssten bis nächstes Jahr, dann ging Tommi in die Lehre und sie könnte wieder arbeiten gehen und von ihrem Geld die neuen Sachen kaufen und die Kammermiete zahlen. Und glücklich machten sie auch die Überlegungen, wie das mit den Kommoden und dem Zimmer für Tommi dann für sie finanziell klein zu halten wäre. Die Kommoden könnte Erwin machen, der Tischler im Dorf, ein Schulfreund von Hermann, mit den gleichen damaligen Problemen wie Hermann, und davongekommen wie Hermann, Erwin würde einen Sonderpreis machen, auf alle Fälle. Die Kommoden könnten schlicht sein, die für Tommi kleiner, ihre größer, vielleicht vier Laden, fünf wären wohl übertrieben, oder doch nicht? Nein, zu hoch, das sieht komisch aus, dann lieber in die Breite. Mutter würde was zugeben, und die Kommoden würden ja auch hintereinander bestellt werden, vielleicht bezahlt Mutter Tommis Kommode ganz, für den Jungen gibt sie ihr letztes Hemd. Vielleicht zahlt sie auch für die Kammer die Miete mit, vielleicht zur Hälfte …
Dann entsann sie sich, dass es nächstes Jahr zu spät sein würde für die Kammer, Kuhlmanns würden sie sicher an die Bachmanns vermieten, die Bachmann wartete doch nur darauf. Nein! Sie muss hier und jetzt sehen, wie sie an die Kammer kommt, muss sich unbedingt was überlegen. Hermann müsste was von der zu erwartenden Entschädigungssumme abzweigen.
Bakeberg hatte immer große Mühe, ungeeignete Leute wieder loszuwerden. Wenn Grummet ihm morgens einen frisch Eingestellten zuführte, sah er auf den ersten Blick, ob dieser zumindest annähernd den Gegenwert dessen einbringe, was ihm in die Lohntüte gesteckt werden müsse. Bakeberg war drei Jahre jünger als Hermann Sünders, Jahrgang 1920. Unter vier Augen gab er Grummet seine Einschätzung. Wenn es eine negative Einschätzung war, stand er hinterher im Zwiespalt seiner Interessen. Einerseits war es später immer ein kleiner Triumph, richtig gelegen zu haben, andererseits hoffte er bezüglich der zu bewältigenden schweren Arbeit des Trupps, doch falsch gelegen und endlich mal wieder einen wirklich tüchtigen und kräftigen Mann bekommen zu haben, so wie damals, als Littmann und etwas darauf Sünders eingestellt wurden. Bei beiden wusste er gleich, dass was Handfestes kam, man sah beiden an, dass sie zupacken konnten und wollten.
Die beiden schlimmen Vorfälle zwischen ihnen, die zur schriftlichen Verwarnung geführt hatten, hatte er nicht verheimlichen können, Littmann blutete, und die Verantwortung für eine eventuell tiefere Verletzung hatte er nicht übernehmen wollen. Und er hatte es nicht riskieren wollen, von Grummet oder sogar Duderstadt auf eine Sache angesprochen zu werden, die diese nicht von ihm, wie es sich gehört hätte, sondern von Dritten erfahren hatten. Und Duderstädters Faible, über jeden Einzelnen, der bei der Stadt arbeitete, unabhängig von dessen beruflichen Status, unterrichtet zu sein, kannte er ja. Er musste sich das volle Vertrauen Duderstädters erhalten, der machte ja schon Schulungen, wollte ein paar Stufen höher kommen, und würde seine Leute mitziehen.
Sich einzuschmeicheln bei Duderstädter, wie wiederum Duderstädter es beim Stadtrat versuchte, war aber nicht Bakebergs Sache, dazu war er viel zu gradlinig. Dass andrerseits Duderstadt eine zwielichtige Gestalt war, konnte niemand behaupten. Duderstädter wollte Karriere machen wie abertausend andere auch, und es waren andere Anstrengungen nötig, als sie Bakeberg für seine Ziele machen musste. Der stellvertretende Leiter des Bauhofs würde bald pensioniert. Da könnte er in Frage kommen, wenn er die nötige Ausbildung mache, die Berufsfachschule biete da einiges an in Abendkursen. Er werde sich da umgehend erkundigen, oder vielleicht erst mal Duderstädter fragen, welche Ausbildung da überhaupt notwendig sei. Dann wäre vielleicht auch gleich die Bauhof-Leitung drin, denn Grummet müsste ja ebenfalls kurz vor seiner Pensionierung stehen, vielleicht in zwei oder drei Jahren. Auf alle Fälle müsste er jetzt schon mal sehen.., unauffällig die Weichen stellen, ein Gespräch so beiläufig.., mit Duderstädter.
Duderstädter war erst 27 Jahre alt. Die Welt der Kreisstadt stand ihm offen, dank seiner Mutter, die dafür gesorgt hatte, dass er damals bei der Stadt die ausgeschriebene Lehrstelle zum Verwaltungsfachangestellten bekommen hatte, trotz einer Vielzahl von Bewerbern. Aber sie nähte damals schon für die Frau des Bürgermeisters, und sie nähe heute noch für sie, und deren Mann, inzwischen schon an die siebzig, war immer noch Bürgermeister. Dieser Umstand war für Duderstädter ein weiteres Mal von Nutzen, denn er bekam trotz eines zweiten Bewerbers aus Braunschweig, der älter war und schon viel Berufserfahrung im Personalwesen hatte, den Posten des Fachbereichsleiters zugesprochen. Inzwischen bekleidete er ihn schon knapp zwei Jahre.
Manchmal fand sich Duderstädter zu dick. Wenn er in den Spiegel sah und unbeweglich vor ihm stehen blieb, fand er seine Ansicht bestätigt. Wenn er sich dann aber bewegte, ein paar Hüftschwünge machte oder zurückging, um bei den Schritten vorwärts die Wirkung seiner Gangart zu prüfen, oder die dicke Hornbrille, die immer wieder auf die Nase rutschte, mit dem Zeigefinger anstupste und wieder hochschob, fand er, es habe etwas. Auch die durch den besonders früh einsetzenden Haarausfall hohe Stirn passe zum Gesamtbild. Ja, er habe das gewisse Etwas.
Freitags ging er manchmal in den Gifhorner Hof zum Essen. Seine ersten Besuche dort waren zufällig auf den Freitag gefallen, dann hatte er gemerkt, dass nicht selten an diesem Tag Mitglieder des Stadtrates dort anzutreffen waren, die Stadtdirektor-Wähler. Er müsste auf Tuchfühlung gehen, sehr vorsichtig. Irgendwann ein erstes freundliches Zunicken, bald die ersten Worte miteinander, irgendwann erste Vertrautheiten, irgendwann der gemeinsame Tisch … Jeder, der was werden wollte, hatte schließlich mit solchen oder ähnlichen Ambitionen angefangen, bis er sich in die für ihn relevante Clique hineingearbeitet hatte. Lag ganz im Normalen, was er so im Blick hatte. Die Clique um Günther Adenbüttel, den CDU-Fraktionsführer und stellvertretenden Bürgermeister. Adenbüttel war so Mitte fünfzig rum und hatte gute Chancen, früher oder später den betagten Bürgermeister abzulösen.
Hauptsächlich war es diese Clique, die im Gifhorner Hof anzutreffen war. Bald hatte Duderstädter auch raus, dass Adenbüttel und seine Leute sich dort immer trafen, wenn abends offizielle Sitzungen anstanden, die in der Regel freitags waren. Mittags im Gifhorner Hof sprachen sie sich wohl ab. Und Adenbüttel hatte eine Tochter, so Anfang zwanzig und ganz leidlich im Aussehen. Er hatte sie bei Schulzes gesehen, einem Tanzlokal in der Südstadt, in die er sonnabends mit seiner Freundin Erika Sander ging. Sie hatten auf einen Martini an der Theke gestanden, neben zwei Männern ungefähr in seinem Alter, die Ausschau hielten nach Tanzpartnerinnen. Der eine entdeckte plötzlich einen Tisch mit jungen Mädchen, die zuvor hier noch nicht aufgetaucht waren und von denen er welche zu kennen schien. Er stieß den andern an und sagte: „Du, da vorn im Saal am Tisch, die dünne Blonde neben der Schwarzen, das ist die Tochter vom Adenbüttel. Nicht schlecht, was? Die arbeitet bei Teves in der Verwaltung. Die Schwarze auch.“
Duderstädter, der direkt neben ihn stand, hatte es durch den Geräuschpegel hindurch genau gehört, auch, weil die kleine Tanzkapelle gerade ausgesetzt hatte. Er hatte unauffällig zu dem Mädchen-Tisch hinübergeschielt. Erika neben sich, die es nicht sehen sollte. Wieso eigentlich nicht?
Ja wieso eigentlich nicht? hatte er gedacht und noch einmal hinübergeschielt, sodass sie es diesmal sah und sich auch darüber ärgerte. Noch mehr ärgerte es sie, dass er keine Lust zum Tanzen hatte. Ihr Ärger hatte ihm nichts ausgemacht. Es war die Luft raus aus diesem Verhältnis. Zum ersten Mal war ihm in diesem Moment der Gedanke gekommen, Schluss zu machen. Sie war sowieso zu dumm für ihn, nicht mal die Prüfung als Friseuse hatte sie geschafft. Dafür musste man schon besonders blöd sein. Er würde also Schluss machen mit ihr. Musste ja nicht gleich sein. Dann hatte er sich doch noch von ihr aufs Parkett ziehen lassen und lustlos getanzt, und immer wieder zu der Adenbüttel hingeschielt, die von einem der Männer an der Theke zum Tanz aufgefordert worden war und ganz gut tanzen konnte.
Seine Mutter sprach viel und gut vom Vater, jedoch niemals davon, dass er für Volk und Vaterland gefallen sei, was ein Feldbrief bescheinigte, an den sie, als er ihr ins Haus flatterte, vor Schmerz nicht glauben wollte, und dessen Inhalt sich später dadurch bestätigte, dass er nicht heimkam. Sie sprach überhaupt nicht vom Dritten Reich und vom Krieg. Duderstädter deutete es später so, dass sie diese Zeitspanne einfach verdrängt hatte, um mit dem Leben danach, dem Leben als Witwe, irgendwie zurechtzukommen, seine Eltern hatten sich sehr geliebt.
Ob die Verdrängung ein Weg war? Ja, es war ein Weg, hatte er gedacht, denn er selbst verdrängte ja auch, oder richtiger gesagt, er versuchte es zu verdrängen, was er in der Endphase des Krieges durchlebt hatte. Im März '45 wurde er als Sechzehnjähriger noch eingesetzt im Volkssturm, obwohl er immer gehofft hatte, aufgrund seiner starken Kurzsichtigkeit verschont zu bleiben. Vorher Kurzausbildung, theoretisch, was nichts brachte. Wie mit den Handgranaten umzugehen war, hatte er schon vergessen, als man sie ihm vor Ort austeilte. Er warf sie dann einfach, und sie explodierten natürlich nicht. Dass seine Kampfgruppe die Abwehrkämpfe einer Infanterieeinheit gegen die vorrückende 2. Armee der Briten verstärken sollte, und dass sie in die Wälder bei Hademstorf gekarrt wurden, das hatte er mitgekriegt, mehr nicht.
Mehrmals Rückzugschaos, er war einfach nur mitgelaufen, lief um sein Leben. Dann immer wieder Neuaufstellung mit den Resten anderer Kampfgruppen, schließlich die endgültige Aufreibung. Mit zwei anderen Kameraden aus Gifhorn, gleich jung und hilflos wie er, war er im Gelände herumgeirrt, an Gefallenen vorbei, von denen viele so jung waren wie sie selbst, an zerschossenem Kriegsgerät vorbei, immer in Distanz zum Gedonner der Kämpfe, um nicht ins Schussfeld zu geraten. Am nächsten Tag sahen sie an verstreut liegenden Häusern weiße Fahnen. Sie wussten nicht, welche Orte von den Briten schon besetzt waren und welche nicht, wussten nicht, was sie machen sollten. Entschieden dann, sich gemeinsam nach Hause durchzuschlagen. An Einzelheiten erinnerte Duderstädter sich gar nicht mehr, nur dass sie abends das bereits von den Briten eingenommene Gifhorn erreichten und seine Mutter, nach dem Schreck, ihn so unverhofft vor sich zu sehen, ihr Gesicht an seines drückte und ihn mit ihren Freudentränen benetzte.
Genau erinnerte er sich aber an die ständige Angst, die ihm und den Kameraden auf dem Heimweg im Nacken saß. Die Angst, auf SS-Kommandos zu treffen, die noch das Kriegsrecht anwandten. Eine Angst, die ihn bis heute traumatisierte. Noch heute suchten ihn Albträume heim, in denen Männer in pechschwarzen Uniformen von Bäumen sprangen, hinter denen er gerade Schutz vor ihnen gesucht hatte, vom Himmel fielen, wenn er im Freien ging. Wenn sie ihn einzukreisen begannen, sah er ihre Köpfe, es waren Totenköpfe. In den Händen hielten sie Sensen, die sie nach ihm ausschwenkten. Den sicheren Tod vor Augen erwachte er immer im allerletzten Moment, bevor die Mordwerkzeuge seinen Hals durchtrennten. Schweißgebadet setzte er sich im Bett auf, fasste in Panik nach seinem Hals, das Entsetzen im Nacken, das ihn noch eine Weile lähmte.
Seine Mutter sorgte nach dem Krieg dafür, dass er in der Abendschule sein Abitur machte und in Braunschweig Aufbaulehrgänge für seine Verwaltungslaufbahn absolvierte. Die gelernte Weißnäherin nähte Tag und Nacht in Heimarbeit für eine ortsansässige Textilfabrik. Duderstädter entbehrte nichts, ging morgens immer gut angezogen aus dem Haus, mit genügend Proviant in der Tasche, mit genügend Kleingeld im Portemonnaie. Es ging aufwärts mit ihm, nur die Albträume verloren sich nicht und der Schauder nicht, der ihn befiel, wenn er sich seines Volkssturm-Einsatzes erinnerte, in dem er nicht verstand, nicht durchschaute, was mit ihm und um ihn herum passierte. Nie, nie mehr wollte er in eine solche Situation kommen.
Duderstädters Interesse am Personal der Stadtverwaltung ging weit über das Maß hinaus, das man in seiner Position als üblich empfunden hätte. Man sah es als kleine Marotte, belächelte sie manchmal. Er machte sich keine Gedanken darüber, wie andere es sehen könnten, er wollte die Netzwerke um ihn herum durchschauen können, vielleicht an diesem oder jenem Fädchen mal mitziehen, mit den Leuten in Verbindung sein, auf angenehme Art. Es war nicht nur, dass er sich beliebt machen wollte, um vielleicht doch mal zur rechten Zeit eine Fürsprache zu erhalten, die er von dieser Seite eigentlich nicht glaubte, zu benötigen, es war auch die Auswirkung seines Kriegstraumas.
"Wie geben sich eigentlich Sünders und Littmann seit der Verwarnung?“ fragte er Grummet, der am Nachmittag ohne besonderen Anlass bei ihm hereingeschaut und das Angebot auf eine Tasse Kaffee gern angenommen hatte. „Gut, abgesehen von kleinen Streitereien, die zwischen allen vorkommen. Sind unsere tüchtigsten Arbeiter und jetzt schon ein Jahr hier bei uns.“
„Ja, die beiden Frontkämpfer", antwortete Duderstädter mit dem Anflug eines Lächelns, "haben wohl auch einen Sonderbonus bei Ihnen, Sie haben ja schon zwei Kriege mitgemacht.“
„Ja, und ich lass' auf die Soldaten nichts kommen, weder auf die Reichswehr noch auf die Wehrmacht. Die Soldaten sind immer diejenigen, die die Knochen hinhalten müssen. Und hinterher, wenn's es schiefgeht, kommt vom eigenen Volk die schlimmste Verdammnis.
Wie ist es denn mit Ihnen? Sind Sie nicht auch noch eingezogen worden '45? Ich glaube, Sie erzählten das mal.“
„Ja, richtig, auf der Betriebsfeier neulich hab' ich davon erzählt. Hatte schon ein paar intus, und dann wird man leicht mal sentimental. Bin damals mit meiner gesamten Klasse eingezogen worden, März '45. Kann mich noch dran erinnern, als wenn es gestern war, an den Einberufungsbefehl vom Jugendführer des Deutschen Reichs. Ich kam von der Schule nach Hause, da lag er auf dem Tisch und meine Mutter deutete nur traurig und ohne ein Wort zu sagen, zum Tisch hin, auf dem er noch ungeöffnet lag. Ich hatte Angst, ihn in die Hand zu nehmen, tat es dann doch und riss ihn auf, als wäre er selbst schon der Feind, der zu bekämpfen war. Meine Mutter sagte dann doch noch etwas, dass Sie Einspruch erheben könnte als Kriegerwitwe mit einem einzigen Sohn. Aber das wollte ich nicht, so vor den Klassenkameraden und vor dem Schulze, dem Lehrer, der uns schon wochenlang jeden Tag bearbeitet hatte. Sie kennen ihn sicher, er ist inzwischen Schulleiter geworden, in der Mittelschule.“
„Ja, den kenn' ich sogar gut. Der macht auch was in der Schlossbücherei, die haben da so einen Lesekreis. Heute redet der ganz anders.“
„Ja so ist das, wie bei allen, die sich damals für Volk und Vaterland die Kehle heiser geredet oder geschrien haben, vor allen Dingen für ihren Führer. Gerade wegen dem Schulze wollte keiner kneifen. Man dachte ja auch, dass noch die Wende kommt und dass man dann für ewig der Hasenfuß, der Geächtete sein würde, wenn man da gekniffen hätte, aus welchem Grund auch immer. Ja und dann wurden wir vor den Feind gejagt wie Hasen bei der Treibjagd. Mit Gewehren und Handgranaten bepackt, und wussten nicht, was machen damit.“
„Werfen“, sagte Grummet und versuchte zu lachen, „jedenfalls die Granaten. Und vorher schärfen.“
„Tja“, sagte Duderstädter und zog die Schultern hoch.
„Kann mir schon denken: knappe oder gar keine Einweisung. Die sollte dann direkt in der Kampftruppe erfolgen, dann wurden da in der Schnelle zuerst die Knarren erklärt, meist ging es dann gleich rund ...
„Ja, ich hab' gesehen, wie Schulkameraden gefallen sind, einer nach dem andern abgeknallt, bevor sie ihre Gewehre schussbereit hatten, und wie andere in Panik davonliefen.“
„Wie gut ich das kenne“, sagte Grummet, „Kampfschock. In der Reichswehr bedeutete das in der Regel: Diagnose Kriegsneurose. Kampfunfähig, ab in die Klappsmühle.“
„Und bei Hitler: Ab an die Wand oder gleich im Wald bumm bumm.“
„Ja, Verbrechen an den eigenen Soldaten war das, an der eigenen Jugend“, sagte Grummet und schüttelte den Kopf, „unglaublich, die Kriegsneurose einfach so abzuschaffen, eine seelische Krankheit abzuschaffen wie ein unbequemes Gesetz. Noch vor dem Krieg war das, '36.“
„Uns wurde eingebläut, bevor wir in den Wald gekarrt wurden, damit wir wussten, woran wir waren: ‘Durchdrehen oder Abhauen gibts nicht, Jungs, das ist Defätismus!' Auch Schulze hatte uns das eingetrichtert, und dabei immer so schrill gekreischt, als käme eben jetzt der Einsatz.“
Duderstädter hielt sich die Ohren zu, als hörte er sie wieder, Schulzes kreischende Stimme.
Grummet nickte ernst, trank seine Tasse leer und erhob sich: „Ich muss, erwarte noch eine Lieferung von Viekbauer.“
Mit dem Blick auf den von Erinnerungen gequälten Personalchef fügte er schuldbewusst hinzu: „Wir hätten hellhörig werden müssen damals, bei solchen Verordnungen, besonders wir Älteren, dieser Irre …“
„Da war es doch schon längst zu spät", tat Duderstädter ab, „zehn Jahre vorher hättet ihr den ausbremsen müssen.“
Er besann sich des ursprünglichen Themas: „Wenn Sie Bakeberg treffen, sagen Sie ihm, er soll Sünders und Littmann in Schach halten, diese Streithälse, damit da nicht noch mal was passiert.“