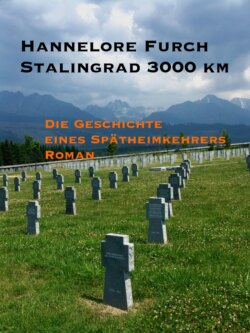Читать книгу Stalingrad 3000 km - Hannelore Furch - Страница 5
3
ОглавлениеMathilde ließ ihr Ziel nicht aus dem Auge, die beiden Schwiegersöhne an einen Tisch zu bringen. Der gescheiterte Versuch wiederholte sich mehrmals. Die nächste Chance war ihr 65. Geburtstag. Sie wollte ihn im kleinen Kreis mit den Töchtern und ihren Familien feiern, mit den kompletten Familien. Bis dahin war genug Zeit, Hermann und August zu bearbeiten, August durch Luise. Und es kam für beide Frauen die Stunde, in der sie Erfolg zu haben schienen. Hermann versprach zu Hause zu bleiben und friedlich zu sein, August sagte seinen Besuch zu. Er bereute es schon kurz darauf, konnte aber nicht mehr zurück. Gegen die Schwiegermutter hatte er ja nichts und wollte sie auch nicht kränken.
So saßen sie am besagten Tag vereint in Sünders‘ Stube bei Frankfurter Kranz, Kalter Schnauze und Butterkuchen. Die Frauen redeten, die Männer schwiegen und sahen auf die gestickte Tischdecke. Aber es schien gut zu gehen. Bis Luise, in der naiven Absicht, mit irgendeinem Gesprächsthema auch die Männer zu erreichen, vom Bauhof anfing.
„Wie ist das denn mit dem Baggerschein, von dem Walter Schimmelrogge neulich bei uns erzählt hat“, wandte sie sich arglos erst an August und dann an Hermann, „wer macht den denn da bei euch?“
„Ich“, antwortete Hermann ruhig.
„Wer sagt das?“ August war augenblicklich aufgebracht.
„Bakeberg.“
„Kann ich mir nicht vorstellen. Grummet hat gesagt, das wird mit dem ganzen Trupp besprochen.“
„Hat er sich wohl anders überlegt. Der Bagger ist für den ganzen Bauhof, erklärte Hermann an die Frauen gewandt, „bin dann mal hier und mal dort im Einsatz.“
„Das wäre ja gut“, sagte Mathilde, „dann ist die Gefahr nicht so groß, dass ihr beide euch da gegenseitig umbringt.“
„Mit dem Baggerschein, das ist noch gar nicht geklärt“, sagte August und bemühte sich, so ruhig wie Hermann zu bleiben.
„Ich hab' die Zusage“, sagte Hermann.
„Nichts hast du, willst dich hier wichtig machen.“
Mathilde sah, wie zwischen den beiden die ungesunde Spannung stieg und die Halsschlagadern anschwollen. Plötzlich sprang August auf, seine Faust fuhr dicht vor Hermanns Nase vorbei. Er ging auf die Tür zur Diele zu, besann sich dann aber und blieb stehen. Nach einem kurzen Moment des Schreckens sprang auch Hermann auf, packte August hinten am Hemdkragen, zog ihn die restlichen Meter zur Tür hin, machte sie auf, als wolle er ihn auf die Diele hinausschmeißen. Aber plötzlich ließ er August los, machte die Tür wieder zu und setzte sich an den Tisch. Mathilde schaffte es mit beschwichtigenden Gesten und unermüdlichem Einreden auf August, dass auch der sich wieder hinsetzte. Sie hatte sich über alle Maßen angestrengt in ihren Bemühungen und ließ sich anschließend mit gerötetem Kopf und schwer atmend auf den Stuhl nieder, den Luise ihr direkt dort hingeschoben hatte, wo sie gerade stand.
Schweigend ging die Geburtstagsfeier weiter, aber jede spürte, dass es wohl das letzte Mal gewesen war, dass die beiden Kontrahenten sich gemeinsam an einen Tisch bringen ließen. Später beim Abspülen in der Küche, als August schon rüber zu seinem Bruder war, fauchte Mathilde Luise an: „Wie kann man nur so dämlich sein und anfangen mit dem Bauhof.“
„Sie hat's ja gut gemeint, wollte diese schreckliche Spannung lockern, die da in der Luft lag, und beide dazu bringen, dass sie was reden“, verteidigte Ella die Schwester, „und das mit dem Baggerschein ist ihr denn gerade mal so eingefallen.“
Luise nickte, sah in den Garten hinaus, in dem eben Renate und Tommi ankamen und sofort zwischen den Beeten herumzutollen begannen. „Wie die sich freuen, dass sie hier raus sind“, sagte sie, während sie ihnen zusah, „wie leid die mir taten, als sie hier in der Stube so bedrückt rumsaßen.“
„Bedrückt? Was bist du nur für eine Beobachterin?“, lästerte Mathilde, „die sind still gewesen aus Neugier, was noch so kommt. Für Kinder ist das immer interessant zu sehen, wie Erwachsene sich aufführen, die genießen das richtig, wenn es rund geht und sie selbst nicht betroffen sind.“
Die Celler Straße war gleichzeitig die B 188 nach Hannover und zog sich auf der Höhe des Kolonialwarenladens Otto Ahrens die letzten paar hundert Meter durchs westliche Stadtgebiet. Noch etwas westlicher bildete der Celler Hof, auf den Mauern einer alten Poststation errichtet, das Schlusslicht der Gebäude. Gegenüber des anschließenden Betonsteinlagers, auf der anderen Seite der Straße, ragten kleine Inseln mit Weidengestrüpp aus einem sumpfigen Wiesengelände heraus. Südlich dieser Fläche lag der Fischerweg, der nach einer Biegung in die Celler Straße einmündete. In einer etwa zweihundert Meter entfernten Parallele zum Fischerweg floss die Aller, umgeben von Wiesen und im weiteren Hintergrund von Wald. Zwischen Fluss und Fischerweg gab es den kleinen Feldweg Am Bullenberg, dessen kurze Strecke noch zum Hauptteil durch ein kleines Wäldchen führte. Und hinter diesem lag einsam die Baracke der Littmanns. Ella bog oft von der Celler Straße in den Fischerweg ein, wenn sie von Einkäufen in der Stadt bei ihrer Schwester vorbeischauen und gleichzeitig eine Verschnaufpause einlegen wollte, bevor sie die restlichen paar Kilometer auf der B 188 fuhr, um von dort rechts die Abbiegung nach Neubokel zu nehmen.
Luise musste, wenn sie mit dem Rad zum Kolonialwarenladen wollte, den Bullenberg zurück und vom Westen her den ganzen Fischerweg bis hin zu Ahrens fahren, denn es gab nur Ackerland und keine Querverbindung von ihrer Baracke zum Fischerweg.
Die Linden an der Celler Straße begannen trotz der Maikühle des Jahres 1957 auszuschlagen, als Luise ihr Fahrrad in dem Ständer links vom Eingang abstellte und den Laden betrat.
„Guten Tag, Frau Littmann“, kam Frau Ahrens dem Gruß ihrer Stammkundin zuvor und stand freundlich und dienstbereit hinter dem Ladentisch. Luise hatte sich wie üblich einen Einkaufszettel geschrieben, las Position für Position herunter, die Händlerin stellte die gewünschten Dinge auf den Tisch und schrieb den Betrag dafür auf ihren Zettel. Es sammelte sich ein stattliche Menge an.
„Heute kaufe ich schon was mehr als sonst“, sagte Luise etwas wichtigtuend, mein Mann hat in paar Tagen Geburtstag und es kommen dann die Bokler und noch Freunde.“
Frau Ahrens nickte freundlich. Frau Littmanns Schwester kannte sie gut. Die kaufte meist auf ihrem Rückweg nach Neubokel bei ihr ein, was sie in der Stadt im Konsum vergessen hatte und im Dorf bei Kleimers nicht mehr bekommen würde, weil es kurz vor Ladenschluss war. Kein Einzelfall unter ihren Kunden aus dem benachbarten Dorf, aber Frau Ahrens sagte sich als kluge Geschäftsfrau, besser sie kaufen wenig bei mir als gar nichts.
„Wie wäre es denn mit einer Flasche Jamaica-Rumverschnitt zur Feier des Tages, Frau Littmann.“ Gleichzeitig entnahm sie dem Regal eine Halbliterflasche: „Wir haben die im Angebot, die kleine Flasche kommt diese Woche nur 1,98.“
„Am besten, wir rechnen erst mal durch, was ich auf ihrem Zettel schon stehen hab', „ich glaub', es reicht nur noch für einen Korn und da ist ja auch mehr drin.“ Luise griff aber dennoch zu der Flasche und drehte sie unschlüssig hin und her.
„Der Korn kostet ja auch schon 1,49, Frau Littmann“, gab die Händlerin zu bedenken, „und Sie wissen doch, dass Sie bei mir anschreiben können.“
„Danke ja, das weiß ich. Mach' ich grundsätzlich nicht, da würd' ich auch mit meinem Mann Krach kriegen. Und der Korn tut es auch. Dafür reicht das Geld bis auf drei Pfennig.“
An Littmans Geburtstag schob Ella ihr Fahrrad in den Vorraum der Baracke, in dem ein großer Waschkessel drei Viertel des Platzes einnahm. Gleich dahinter lag Littmanns kleine Küche, in der Luise das Herdfeuer neu entfacht hatte, um Kaffee kochen zu können. Die Herdwärme war wohltuend, umso mehr, da der seit gestern nicht nur kühle sondern auch nasse Mai die dünnen Barackenwände kühlte. August zeigte sich leutselig auf der Schwelle zur Stube und forderte zum Eintreten auf, auch bei ihm sei es warm, er habe den Ofen angemacht.
Es war eine kleine Flasche Jamaika-Rumverschnitt, die Ella dem Schwager als Geschenk überreichte, mit zwei Päckchen Juno von der Schwiegermutter, die sie wegen einer starken Erkältung entschuldigte. Luise freute sich und bedankte sich im Stillen bei Frau Ahrens. Kurz darauf klopfte es erneut und herein kam Walter Schimmelrogge, seine zwölfjährige Tochter Marianne und seine Frau Selma, eine kleine dicke mit kurzen, krausen Haaren.
„Hier für dich, August, habe ich grade noch fertig gekriegt bis heute, und danke für die Einladung“, sagte Selma und überreichte August, der erneut auf der Schwelle zur Stube erschienen war, ein weiches Päckchen, aus dem sich ein Paar Socken aus mausgrauer Wolle herauswickeln ließ, das von zwei in dunkelblau hineingestrickten Ringen am Bündchen geschmückt war.
„Muss man dir lassen, Selma, stricken kannste.“ Luise betrachtete anerkennend die sehr gleichmäßig gestrickten Socken, sah die Schwester grienend an: „Das wär' doch mal was für Hermann. Strick dem mal welche, dass der endlich von den Fußlappen wegkommt. Und wenn die denn so schön werden wie diese hier von Selma, dann hat er auch seine Freude dran.“
„Das lass' ich mal lieber“, sagte Ella, „der will nur Fußlappen. Das hat der aus Russland mitgebracht und kommt nicht mehr von los. Es wäre so schön warm und weich an den Füßen, und Löcher, wie sie immer in den Socken wären, vorn an der großen Zehe, gäb's auch nicht. Das Komische dabei ist, dass die Lappen immer so kunstvoll gewickelt sind, immer die gleiche Runden um den Fuß und immer die gleiche Reihenfolge der Runden, dass vorn bei der großen Zehe ein Luftloch bleibt, und das hätte er ja bei den Socken auch, ohne dafür was tun zu müssen.“
Alle lachten, Selma meinte, „lass ihm die Fußlappen, Ella.“
In der Stube zwängten sich die Kinder auf die Couch hinter dem Tisch, der dünne Schimmelrogge ebenfalls. August saß am Kopfende des Tisches im Winkel zu Schimmelrogge und machte es sich im Sessel behaglich: „Ist immer wieder schön, zu Hause zu sein und in der gemütlichen Stube zu sitzen.“
Wem sagste das“, antwortete Schimmelrogge, „wenn ich da an Alkansas denke. Man darf es nur nicht mit den russischen Lagern vergleichen, das ist klar.“
Selma hielt sich die Ohren zu und senkte den Kopf, Ella erkannte die Situation und wollte das Gespräch abblocken. Sie hielt den Männern den Korn hin: „Hier, das ist doch speziell was für euch. Na, 'n Schnäppsken noch vor'm Kaffe?“
„Die Gefangenschaft, ja, ja, man vergisst sie nicht", sagte Schimmelrogge, nachdem August und er auf Ellas Angebot nickend eingegangen und den Schnaps wie Seelenbalsam hinuntergekippt hatten. „Es war zwar nicht so schlimm bei den Amis wie bei den Bolschewiken, aber Schnaps gab's nur, wenn wir ihn selbst organisiert hatten, und war dann dementsprechend teuer.
Man trank auf Augusts Wohl, und auch diesmal waren die Männer schneller als die Frauen, die noch das Thema für ein Gespräch nach ihrem Geschmack gesucht hatten.
„Tja die Amis, das sind schon Typen“, sagte Walter. Dass muss ich noch erzählen von drüben, wir sind mal mit dem Zug unterwegs gewesen, ich weiß den Anlass gar nicht mehr. Es war nachts, und nur wir durften in den Schlafwagen, die Bewacher nicht. Und morgens dann war Halt in einem Kaff an der Eisenbahnlinie. Weiß nicht mehr, wie es hieß. Wir wurden in ein Lokal geführt, wo es Frühstück gab. Nur für uns, die Bewacher durften auch hier nicht mit rein. Du weißt, weshalb?“
„Sicher“, antwortete August, „waren Neger.“
„Tja die Amis, das sind schon Typen, halten alle Kriegsrechtskonventionen ein, sind diejenigen, von denen wir die Demokratie haben und von denen uns das ganze neue Zeug über den Ozean schwappt, aber ihre Neger sind für sie das geblieben, was sie immer für sie waren.“
Beide schüttelten sich vor Lachen.
„Über so was kann man nur lachen, wenn man selbst nicht richtig ist im Kopf wie du“, ärgerte sich Selma und schaute nur ihren Mann grimmig an, als wäre er der einzig Schuldige an dem ihr verhassten Gesprächsthema.
"Es geht ja noch, wenn es bei solchen Geschichten bleibt“, wandte sich Ella den beiden Frauen zu, als sie sah, dass die Männer gar nicht daran dachten, ihr Thema zu wechseln. „Kommt“, sagte sie, „lasst die beiden reden, was sie wollen, ist doch nicht zu vermeiden. Wir halten uns an den Frankfurter Kranz, den hat Luise mit guter Butter gemacht und dazu echten Bohnenkaffe. Na wenn das nichts ist.“
Aber das laute Gespräch der Männer erreichte dennoch die unwilligen Ohren der Frauen. So versuchten sie erneut, ein anderes Thema aufzubringen, und jedes Mal versiegte es, bevor es richtig in Gang gekommen war. Das Gespräch der Männer hingegen festigte sich und floss munter dahin, wenn auch nur zwischen ihnen. Walter erzählte von Erlebnissen eines Freundes, Alfred Schmeirich aus Isenbüttel, der in Frankreich in Gefangenschaft war. August kannte ihn schon von Walters Geburtstagen her.
„Da ging bei denen die Fremdenlegion im Lager ein und aus, und weißte, auf welche Leute die aus waren?“
„Waffen-SS“, sagte August, hab' ich schon von gehört.“
„Genau, die wurden richtig umgarnt, Zigaretten, Essen und so weiter.“
„Ob diese Nazis sich anwerben ließen? Hat Alfred da was mitgekriegt?“
„Weiß nicht. Kannst ihn selbst fragen, er ist ab Montag bei uns im Trupp, hab's von Schetter. Aber sicher ist, dass er und die andern sich damals ganz minderwertig vorkamen, so als zweite Wahl. Ja das hat sie richtig schlimm gewurmt, dass diese stolzen Laffen von der SS trotz aller Kriegsverbrechen jetzt wieder die Elite war.“
„Die Fremdenlegion hat ihre eigenen Maßstäbe“, meinte August, „und Recht ist nicht immer das, was wir unter Recht verstehen. Nimm nur die Genfer Konventionen. Versteht man nicht, wieso Offiziere in Gefangenschaft vom Arbeitseinsatz befreit sein sollten. Das hieß auf deutsch, die Befehlsempfänger im Krieg sollten nach dem Krieg mehr leiden als die Befehlshaber.“
„Wenn man mal davon absieht, dass die Kapitulation für viele deutsche Offiziere das Schlimmste überhaupt war, was ihnen passieren konnte“, wandte Walter ein. „Nicht wenige haben sich umgebracht. Einer fast vor unserer Haustür. Montgomerys Hauptquartier Lüneburger Heide. Von Friedeburg mit seiner Delegation. Mittags. Ein Zelt, wo man separat für die Deutschen gedeckt hat. Von Friedeburg weint beim Essen. Danach unterzeichnet er die Teilkapitulation und bringt sich dann um.“
„Das mit dem Selbstmord war aber später“, korrigierte August. „Hat erst noch bei Eisenhower in Reims mit unterschreiben müssen, neben Dönitz und Jodl, erst danach hat er sich umgebracht.“
„Ja richtig, jetzt erinnere ich mich. Aber bleiben wir bei den Offizieren im Allgemeinen. In Gefangenschaft brachte ihnen ihr Stand als General Vorteile, der eine Vorteil zog den anderen nach sich. Weil sie nicht arbeiten durften, wurden sie früher nach Hause geschickt. Unnütze Esser wie die Schwachen und Kranken, die auch früher nach Haus kamen.“
„Die Generäle wurden aber nur bei den West-Alliierten nach Hause geschickt“, ergänzte August, „in Russland wurden sie schikaniert und dann ab '49, als die Rücktransporte nach Deutschland begannen, massenhaft zu Kriegsverbrechern abgeurteilt.“
„Richtig, da hat es ja auch die einfachen Soldaten erwischt mit Gründen, die an den Haaren herbeigezogen waren, grausam, ich denke nur an Hermann, der ...“
„Bei den Rücktransporten '49“, unterbrach August die Abschweifung zum verhassten Schwager“, wurden in Königsberg aus einem Zug voller Heimkehrer mehr als hundert Offiziere wieder rausgeholt und zurückgeschickt. Muss man sich vorstellen, die hatten die Heimat schon vor Augen.“
„Ja und die Schuld am Krieg auf dem Gewissen“, mischte sich Selma ein, "diese Aktion ist für mich so eine Art höhere Gerechtigkeit.“
Die Männer wollten es weder bestätigen noch dementieren, in ihren gemischten Gefühlen vermieden sie den Blickkontakt mit den Frauen.
„Und dass die Sieger überall die Kranken und Schwachen nach Hause gelassen haben, auch“, sagte Ella, „das war auch gerecht“. Beiläufig fügte sie hinzu, ohne durch ihre gleichgültige Miene zu verraten, wie sie es meinte: „Der Hermann war nicht dabei.“
„Weil der nicht krank und schwach war“, sagte August, „das Wasser, das der im Körper hatte, hat sich langsam angesammelt, wie bei fast allen Gefangenen.“
"Und viele Heimkehrer hatten es, darum sahen die gar nicht so mager aus, wie man sie sich vorgestellt hatte“, ergänzte Ella, „das hat Dr. Schwerner uns erzählt, der Arzt aus der Bodemannstraße, der einmal in der Woche nach Bokel kommt und nach seinen Patienten sieht. Nachdem, was ihr so erzählt, hat der Hermann ja Pech gehabt, dass er sechs Jahre früher gesund war, sonst wäre er schon viel früher wieder zu Hause gewesen, so wie ihr beide“.
Auch diesmal konnte man nicht entnehmen, ob sie sich über diese frühere Heimkehr Hermanns gefreut hätte oder nicht.
„Ob das Pech war?“, zweifelte Walter an, „was hat die frühere Heimkehr denen genützt, die unheilbar krank aus der Gefangenschaft entlassen wurden, und das war doch ein großer Teil. Manche haben sich vorher richtig geschädigt, mutwillig. Weil sie hofften, dann beim nächsten Transport in die Heimat mit dabei zu sein. Die haben konzentriertes Salzwasser getrunken und sich die Mägen verätzt, oder andere schlimme Sachen gemacht. Frag mal nach, wie viele von denen noch leben. Viele sind schon gleich im Lager gestorben. In Russland passierte das hauptsächlich, da war ja alles Schlimmer als bei den West-Alliierten. Auch, wenn man diese ganzen Aburteilungen der Offiziere mal außen vor lässt. Die du als Weltgerechtigkeit siehst“, wandte er sich zum Schluss direkt an seine Frau, sein Tadel wirkte aber wenig überzeugend.
„Und, Selma“, unterstützte August seinen Freund, „das mit der Gerechtigkeit bei den Bolschewiken ist so eine Sache. Schlimm war es für alle, die keine Kommunisten werden wollten. Hermann ist da auch stur geblieben, das muss man ihm lassen ...“
„Und hat es überlebt, ein zäher Bursche, der Hermann ...“
„Tja, und hat überlebt“, wiederholte Ella leiernd und ohne Begeisterung.
„Hermann hat Glück gehabt“, redete Walter fort, „wie alle anderen, die noch zurückgekehrt sind. Zäh sein allein genügte auch nicht immer bei diesen Lebensbedingungen in den bolschewistischen Lagern, und auch in denen der West-Alliierten war das Leben kein Zuckerschlecken. Bei den Briten zum Beispiel gab es Lager, wo die SSler das Sagen hatten. Auch solche komische Geschichte. Da haben doch die Gefangenen geglaubt, der Krieg wäre vorbei für sie. Tja, der alte war ja auch vorbei, aber der neue ist gekommen.“
Die Frauen sahen ihn fragend an, August übernahm es, die Sache zu erklären: „Die Briten wollten es sich einfach machen und haben es auch noch gut dabei gemeint. Die Deutschen sollten sich selbst verwalten und versorgen. Die Briten wollten sichergehen, dass das auch klappt und haben dafür Gefangene eingesetzt, die sie geeignet hielten. Und geeignet hielten sie die Leute von der Waffen-SS, ihre Organisation als solche war vorbildlich gewesen. Und der Zusammenhalt und die Kameradschaft unter ihnen war erhalten geblieben wie bei den Japanern, die Briten wussten das wie alle andern.“
„Und haben nicht dran gedacht oder wollten nicht dran denken“, sagte Walter, „dass diese Kameradschaft nur innerhalb der SSler galt.
Tja, da ging es dann rund, gegen die eigenen Kameraden, wenn man so will, denn schließlich sind alle deutschen Soldaten Kameraden. Wie gesagt, nicht für die SSler. Wer nicht spurte, bekam nichts zu essen oder Bunker. Die Briten kamen nur einmal im Monat vorbei und sagten ‚How are you?‘. Und das nur zu den SSlern.“
„Ja“, bestätigte Walter, „ ein böser Treppenwitz der Zeitgeschichte.“
Die Frauen schüttelten ungläubig die Köpfe, sodass August noch hinzusetzte: „Fragt den Fritze Schermeier aus der Maschsiedlung, der war in einem von der SS verwalteten Lager, war nicht unbedingt die Regel, dass die SS so die totale Macht hatte, aber auch nicht die Ausnahme.“
„Dann war das in solchen Lagern ja schlimmer als in Russland“, meinte Ella, „da hat es wohl auch nichts zu essen gegeben, wie Hermann uns mal erzählt hat, viel erzählt der ja nicht, aber das hat er doch erzählt. Da gab es in den Lagern nichts zu essen, aber nicht, weil der Satan da das Sagen hatte, sondern weil für alle nichts da war. Selbst für die Lagerleitung nicht, und auch für die russische Bevölkerung nicht, die kam noch bei den Gefangenen die faulen Kartoffeln schnurren. Wenn alle nichts haben, ist es für jeden leichter zu ertragen, als wenn ihm das Unrecht den Hunger aufzwingt."
„Ja, August, so ganz versteht das keiner beim Trupp, du und Hermann, wieso ihr nicht könnt zusammen, Feindschaft seit Kindheit, das ist ja lange her und könnte doch langsam mal vergessen sein, oder?“
Walter sah auch die Frauen an, die keine Meinung zu haben schienen, Ella zuckte die Schultern.
„Hermann denkt jedenfalls so wie du, wie wir beide“, fuhr Walter fort. „Ich muss nur an neulich in der Frühstückspause denken, wo du das vom Göring so laut gesagt hast, dass Hermann es gehört hat, dass Göring die Einweihung der Deutschen Oper in Berlin mit größtem Pomp gefeiert hätte, während die Sechste Armee, oder das, was von ihr damals noch war, nichts zu fressen hatte. Verrat wäre das gewesen, aber schlimmer noch wäre gewesen, dass sie die Stellung halten sollten, wo kein Soldat mehr gesund, für keinen Panzer mehr Benzin, für kein Geschütz mehr Munition da war.“
„Ja“, bestätigte August, „hab' das so in groben Zügen gesagt und wiederhole es hier: Ein Todesurteil war das. Ein Verbrechen gegen die Wehrmacht, gegen das eigene Volk, das seine Söhne und Väter in Stalingrad hatte.“
„Und du hast auch gesehen, dass Hermann ganz vergrämt dagesessen hat. Nicht, weil du es gesagt hast, sondern weil er alles genauso empfunden hatte damals, und es, wie er das hörte von dir, noch mal nachempfand.
Es ist ein Kreuz mit euch beiden.“
„Kann sein, für mich ist und bleibt er ein Arschloch. Muss ich so ehrlich sagen, Ella.“
Ella zuckte nur die Schultern. Dann meinte sie, doch noch etwas sagen zu sollen, „na ja, 'Arschloch' passt nicht ganz. Hermann ist ganz brauchbar, nur sein Schädel ist hart, und wie er so redet über das dritte Reich, passt mir auch nicht. Ich hör' weg, wenn er so in seiner Art drüber redet, und ich werd' jetzt hier auch weg hören, wenn ihr weiter über Krieg und Gefangenschaft redet, so als ob ihr nichts draus gelernt habt.“
„Tja so ist das mit unseren Männern“, die haben wirklich nichts aus dem Krieg gelernt“, pflichtete Selma ihr bei, „und ich will jetzt auch nichts mehr von hören.“
„Ich glaub' eher, dass ihr nur immer so tut, als ob ihr nichts aus dem Krieg gelernt habt“, wandte sich Ella noch mal an die Männer, „auch bei Hermann hab' ich immer so das Gefühl, er redet nur so, aus Protest.“
„Was für ein Protest?“, frage Selma.
„Na ja“, antwortete Ella, „wohl Protest darüber, dass jetzt keiner mehr redet übers Dritte Reich, so als hätte es nie eins gegeben.“
Die Männer erwiderten erst nichts, dann sagte Schimmelrogge plötzlich, als wären er und August die Retter in der Not: „Na siehste, es gibt doch noch welche, uns. Und auf der Arbeit gibt’s auch noch welche von uns, die an der Front waren, mit denen man drüber reden kann, über das Dritte Reich und den Krieg.“
„Wie schön für euch, und für Hermann“, sagte Ella, ohne die Komik zu erkennen, die in Schimmelrogges Rede lag, auch die andern beiden Frauen erkannten sie nicht.
Zu den beiden Mädchen, die die ganze Zeit mit offenen Ohren dagesessen hatten, sagte Ella freundlich: "Na, was nichts ist für euch, das hört ihr besonders gern, nä? Nun aber raus auf den Hof mit euch.“
„Wir könnten ja auch raus gehen, alle zusammen, an die Aller“, schlug Luise vor, „ich stell' nur eben den Frankfurter Kranz in die Waschküche.“ Sie trug ihn schon zur Tür, sah, dass die Männer gar keine Anstalten machten, sich zu erheben, und kannte schon den weiteren Verlauf der Geburtstagsfeier. Sie sah ihre Schwester an, dann Selma, die verächtlich den Mund verzog, als sie die Stimme ihres Mannes vernahm, die so klang, als meinte er es in erster Linie mit den Frauen gut.
„Ja geht nur. Das ist gesund draußen an der frischen Luft und entspannt auch. August und ich, wir wissen das, sind jeden Tag an der frischen Luft und sind beide gesund.“
Luise konnte es sich nicht verkneifen, noch mal zu den Männern hineinzusehen: „Jetzt könnt ihr über den Krieg reden, bis ihr schwarz werdet, wir sind 'ne ganze Weile weg.“
In der Waschküche, in der die Frauen die Mäntel der Kinder und ihre eigenen vom Haken nahmen, spottete Ella: Da kannste aber lange warten. Die reden noch drüber, als hätten sie davon gerade erst angefangen, wenn wir zurück sind. Da hätte jetzt nur noch der Hermann gefehlt.“
„Wäre mir aber lieber, Schwester, auch Hermann würde da mit drinsitzen und reden, als diese ewige Feindschaft zwischen ihm und August.
Sie gingen über die noch winternassen Wiesen, in denen sie ihre tief eingedrückten Fußstapfen hinterließen, auf denen sich am Boden das Wasser sammelte.
„Wie gut, dass wir die Stiefel angezogen haben, auch die Kinder“, stellte Selma fest, „obwohl Marianne unbedingt die Halbschuhe anziehen wollte.“
Es ging Richtung Aller, die beiden Mädchen sprangen voraus wie Fohlen, die zum ersten Mal auf die Wiese durften.
„Ist gesund für die“, setzte Selma ihre Rede fort, „da hat Walter schon Recht gehabt. Und die Anstrengung, hier auf den nassen Wiesen herumzutollen, tut ihnen auch mal gut.“ Ärgerlicher klang schon, was sie dann noch hinzufügte: „Im Gegensatz dazu war das Kriegsgerede in der Stube ungesund für sie, besser gesagt, gefährlich, weil sie ein falsches Bild vom Krieg erhalten, so was ist nicht gut. Und wie sie dann immer dasitzen, auch vorhin, so mit gespitzten Ohren ...“
„Ach, die lernen schon in der Schule, was das war mit dem Krieg“, beschwichtigte Luise die Freundin, „und wir sind ja auch noch da. Und was Renate und Tommi betrifft, da ist ja unsere Mutter noch da, „die hat den klaren Blick auf die Dinge und sagt den Kindern schon, was ist. Mit dem Tommi redet sie doch viel. Doch wohl auch jetzt noch?“
Sie sah die Schwester fragend an, die nur nickte, und setzte noch hinzu: „Der wird ja Ende des Monats schon vierzehn und hat sicher eigene Interessen.“
„Vom Krieg hört der immer gern was, leider!“
„Stimmt es eigentlich, Ella, dass eure Mutter sich damals durchgesetzt hat bei Hermann, damit du den Kleinen auf den Namen Thomas taufen lassen konntest? Hat Hermann bei der Arbeit selbst mal zum Besten gegeben, und Walter hat es mir dann abends brühwarm zu Hause erzählt, weiß aber nicht mehr genau...“
„Die Geschichte stimmt“, sagte Ella, „Hermann wollte den Namen erst nicht, weil er befürchtete, dass aus dem Thomas schnell ein Tommy wird. Wir haben ihm versprochen, den Jungen immer Thomas zu nennen und er hat dem Namen dann zugestimmt. Das ging noch auf dem Postweg im Winter '42 auf '43, wir wollten das rechtzeitig klären mit dem Namen und Hermann als werdenden Vater nicht übergehen.
„Und der war dann ganz schockiert, als er aus der Gefangenschaft zurück war, dass alle ihn Tommi nannten“, wusste Luise zu berichten.“
„Ja“, sagte die Schwester, „das schmerzte ihm im Ohr, als hätte er den Feind direkt im Haus.“
„Mein Gott“, sagte Selma, „der Sohn ein Feind.“
„Nein, das ja nicht“, stellte Ella richtig, „den Tommi liebte er ja, nur seinen Namen nicht. Aber langsam hat er sich dran gewöhnt. Und wir sind damals, ohne dass uns das ganz bewusst wurde, darauf übergegangen, den Namen zu umgehen und „Junge“ zu sagen, bis heute, obwohl Hermann sich damals schnell gewöhnte und bald selbst 'Tommi' sagte.“
„Ist eigentlich eine ulkige Geschichte, wenn nur dieser blöde Nachgeschmack nicht wäre. Dass es dir noch nicht gelungen ist, dieses Nazidenken aus dem Hermann rauszukriegen“, kritisierte Selma und überdachte im gleichen Moment ihre Kritik, „ach, Walter ist ja mindestens ebenso schlimm. Und ob sie noch wirkliche Nazis sind, unsere Männer, bezweifle ich auch, da liegst du wohl gar nicht so daneben, Ella. Wenn sie über die Nazizeit reden, reden sie über ihre Jugend- und Lebenszeit, es gehört zu ihnen. Diejenigen, die nicht mehr reden über diese Zeit, das sind wohl eher die, die im Innern noch die echten Nazis sind, die Angst haben, sich zu verraten, wenn sie reden.“
„Dann hätten wir jetzt ja auch dableiben und den beiden zuhören können“, spöttelte Ella, „aber mal im Ernst, „es wird ja schon weniger, was sie so über die Hitlerzeit reden, jedenfalls merke ich das an Hermann zu Hause. Nur weiß er, das Tommi gern solche Sachen hört und dann erzählt er was, und auch ganz gern. Aber wenn er heute 'Tommi' sagt, meint er immer nur den Jungen und die Stimme ist so väterlich lieb. Ja, es wird weniger bei unsern Männern, das denke ich schon, nur wenn sie zusammen kommen wie jetzt August und Walter hier bei euch, wird wieder viel geredet drüber.“
Luise nickte, während Selma seufzte: "Ich hab es schwerer als ihr beiden, hab' wirklich echte Nazis in der Familie: meine Eltern. Aber die vertuschen nichts, stehen offen dazu. Mein Vater hat sich im September '44 noch zum Volkssturm gemeldet, und ist stolz darauf, für Führer, Volk und Vaterland noch den letzten Kampf gekämpft zu haben. Und meine Mutter ist ebenfalls stolz darauf, bis heute, dass Papa damals mit achtundsechzig Jahren noch seinen Einsatz gebracht hat. Sie finden bloß nicht mehr viele, bei denen sie mit dieser Geschichte Eindruck machen können. Das ist ihr Pech. Ja was willste machen, solche Leute kannste nicht mehr ändern. Sind meine Eltern und sonst brave Leute wie andere auch.“
„Was haben wir da bloß für ein Glück mit unseren Alten“, sagte Ella, „unser Vater hat schon vor '33 gesagt: ‘Ja wenn der Hitler rankommt, denn gibts Krieg!' Und unsere Mutter hat es immer bestätigt und gesagt, als die Nazis denn gewählt waren: ‘Es wird schlimm, dass glaubt man, guckt dem Hitler in die Augen, wenn der redet, dann wisst ihr alles. Aber wir müssen da durch und kommen auch durch.'
Tja, was unseren Georg angeht, der kam nicht durch. Und was die Heimat meiner Mutter angeht, sie kam auch nicht durch. Mutter trauert heute noch um ihr Varzin.“
„Ja, Pommerland ist abgebrannt“, sagte Selma traurig, „da hat sie Heimat und Sohn verloren durch den Krieg.“
„Sag lieber Sohn und Heimat“, das klingt besser und ist auch richtiger“, meinte Luise, „aber mit dem Verlust der Heimat, das ist schon schlimm für sie, obwohl sie ja vorher freiwillig in den Westen ging auf Arbeit.“
„Trotzdem“, sagte Selma, „die Gewissheit, niemals mehr zurück zu können …“
„Unsere Großeltern hatten da einen kleinen Hof und eine Gänsezucht. Und zwei Ochsen“, ergänzte Ella sich selbst, „mit dem Gespann sind sie sogar bis nach Stolp kutschiert, Mutter durfte als Kind immer mit und hat sich jedes Mal teuflisch drauf gefreut, wenn's los ging. Heute nimmt der Milchkutscher Mutter mit, wenn sie in die Stadt will, und der hat Gäule eingespannt. Wenn das kein Fortschritt für sie ist!“
Die Frauen kicherten, bis Luise wieder ernst geworden sagte: „Aber dass unser Georg gefallen ist, das tut schon weh, allen, und Mutter redet nicht drüber, weil es zu weh tut. Unser Vater ist seelisch dran zerbrochen. Bei Mutter man merkt, dass sie oft an Georg denkt. Diese schlimme Vergangenheit, sie musste diese Sache verdrängen, um leben zu können.“
„Tja“, da wird eure Mutter wohl nicht die Einzige sein.“
„Sicher nicht. Bloß unsere Männer, die verdrängen und vergessen nichts, die kramen die Vergangenheit hervor, um sie zu bearbeiten und so herzurichten, dass sie nachträglich mit ihr zufrieden sind.“
„Ja?“, überlegte Luise.
„Kommt“, setzte Ella mit frischer Stimme ein, „lasst uns über anderes reden, über die frische Mailuft, über die Bäume dahinten, ich glaube es sind Eichen, die jetzt gerade ausschlagen.“
„Ja, du hast Recht, es ist schön hier, August und ich und Renate, wir wohnen hier wie im Paradies, und wir sind gleich an der Aller. Man sieht schon das Wasser glitzern. Es sieht alles so frühlingshaft aus, man spürt den Mai trotz der Kühle.“
Ella sah die Gelegenheit gekommen, von der neuen Zeit und ihren Errungenschaften zu reden: „Die frische neue Zeit ist angekommen und wir wollen sie. Wart ihr diese Woche schon in der Stadt?
Hallo ihr zwei“, rief sie zu den Mädchen hinüber, die schon den Fluss erreicht hatten und dicht am Ufer entlang gingen, „nicht so dicht am Wasser, weg da! Neulich ist ein Kind in einen Fluss gefallen und ertrunken, das war ganz schlimm, im Radio und in der Zeitung wurde drüber berichtet. Also passt auf, dass ihr nicht abrutscht. Am Ufer gibt es gefährliche Strudel, da hilft's auch nicht, dass ihr schwimmen könnt. Also weg da vom Ufer“, rief sie zum Schluss noch mal hinüber, ärgerlicher als zuvor, weil die Mädchen nicht gleich reagierten.
„Ja“, wandte sie sich wieder den Begleiterinnen und ihrem Thema zu, „die neue Zeit ist gekommen und bringt schöne Sachen mit. Ich war bei Schwannecke, die haben neue Lavabelstoffe, wunderschön, und Farben, rot, grün, blau mit weißen Blümchen, Kringeln oder Tupfer, ja einfach wunderschön.“
„Und welchen Stoff haste gekauft?“
„Dunkelrot mit weißen Punkten. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Ich hab' den gleichen Stoff in dunkelblau für dich zurücklegen lassen bis nächste Woche“, sagte sie zu Luise.
„Dann geh' ich ihn holen, sobald die Männer ihren Lohn gekriegt haben, sagte Luise, „und in der Mappe für's Eingesparte sind auch noch ein paar Mark, das müsste dann reichen.
„Ob eure Mutter für mich auch eins nähen könnte? Ein Kleid mein' ich. Muss ja nicht auch noch diesen Monat sein, nächsten vielleicht.“
„Ich frag' sie gleich heute Abend. Sie näht jetzt nicht mehr für andere. Aber ich denke, für dich näht sie, und sicher auch gern.“
„Danke Ella. Den Lavabel hole ich mir morgen auf alle Fälle. Lass dann über die Männer Bescheid sagen, ob ich mit dem Stoff dann zu euch kommen kann.
Ich war auch bei Döpke letzte Woche. Da gibt es schöne Söckchen für die Kinder, auch alle Farben und so lustige bunte Kringel, und so schöne dünne für den Sommer kann man ja nicht stricken.“
Ella nickt interessiert, fragte dann die Schwester, obwohl sie die Antwort schon kannte: „Hast du dem August auch schon ein Nylonhemd gekauft?“
„Ach, du kennst doch den knickrigen August. Aber, weil der so knickrig ist, gibt es für das Geld, was ich mir selbst gespart habe, keine Nylonhemd für ihn, sondern Lavabelstoff für mich.“
„Richtig, Schwester!“
"Er gibt mir immer nur das Haushaltsgeld“, erklärte sie Selma, „keine Mark mehr. Alles andere kommt gleich aufs Sparbuch. Er spart immer auf was, da kann man nichts machen. Walter hat doch sicher auch noch keins, kein Nylonhemd mein ich, oder?“
„Nee, aber er kriegt eins. Jedenfalls gibt er mir Geld, wenn ich was haben will.“
„Ich kauf' dem Hermann auch eins“, sagte Ella, obwohl der es nicht verdient hat, wenn ich da an die Geschichte mit unserer Kommode denke.“
„Die Geschichte mit der Kammer, erzähl das mal, die kennt Selma ja noch nicht, obwohl sie schon fast ein Jahr alt ist.“
"Das ist kurz gesagt. Der Hermann wollte sie nicht, hat aber dann doch unterschrieben, als ich sie bei Frau Kuhlmann von acht Mark auf sechs Mark fünfzig runtergehandelt habe und Mutter zusagte, drei Mark beizusteuern. Und eine neue Kommode wollte er auch nicht. Die hat dann Mutter bei Erwin für sich bestellt, und als sie fertig war und Erwin noch was abgelassen hatte vom Preis, da hat er sie doch akzeptiert und bezahlt.“
„Ja letztlich kriegt Ella doch alles, was sie will, und wenn Hermann wirklich mal streikt und was zu unterschreiben ist, muss der Papa herhalten.“
“Ach, ja nur einmal“, winkte Ella ab, „das will ich eigentlich gar nicht, dass der Papa für so was herhalten muss.“
Und du, was hast du so vor für die Zukunft?", fragte sie Selma.
„Na erst mal ein richtiges Fahrrad. Selmas Gedicht wurde heiter wie die der andern beiden, „so eins ohne Stange, ein echtes für Damen, und denn ein elektrisches Bügeleisen und denn“, sie hob die Brauen hoch wie ein Clown, der in Übermut den Spaß überzieht „ja doch, einen Plattenspieler, das wäre was.“
„Das sind ja Wünsche", staunte Luise, „und eine Reise soll es nicht sein?" Sie begann zu singen und dabei albern mit dem Po zu wackeln, 'Komm ein bisschen mit nach Italien', oder nicht lieber gleich ein Auto von VW, der Leiding fährt ja schließlich auch schon eins. Aber ein Käfer wäre vielleicht nicht so das Richtige für dich, ein bisschen mickrig. Willst lieber einen Borgward, eine schöne Isabella.“
„Lass man, so abwegig sind Selmas Wünsche nicht, es geht vorwärts in Deutschland, der Adenauer macht das schon, oder der Ehrhard. Wohlstand für alle. Es geht schon damit los, dass jeder nur noch fünfundvierzig Stunden die Woche arbeiten soll. Zehn Jahr weiter, na sagen wir mal fünfzehn, und das Auto ist da, auch für uns, und du lachst nur noch, wenn du die Drahtesel im Schuppen stehen siehst, so verrostet, das sie kaum noch zu erkennen sind.“
„Wenn nur noch 45 Stunden gearbeitet wird“, überlegte Luise, „geht das wahrscheinlich vom Sonnabend ab, da sind die Männer dann früher zu Hause.“
„Tja, es gibt eben nichts, wo nur Vorteile sind“, brummelte Ella und dachte dann in besserer Stimmung an die Vorteile, „wenn sie dann für weniger Arbeit sogar mehr Geld kriegen als vorher mit mehr Arbeit, können wir auch öfter zu Döpke oder Schwannecke gehen, und das ist wieder gut. Dort gibt es dann öfter neue Sachen, weil die im Geschäft wissen, die Leute kaufen, weil sie mehr Geld haben.
Luise, Selma: Es geht aufwärts in Deutschland!“ Die Freude darüber stand ihr im Gesicht.
„Die Plattenspieler gibt es jetzt sogar in so einem Schrank, bei Radio-Schulze steht einer im Schaufenster. Ich glaub' 39 Mark“, kam Selma auf ihren Wunsch zurück."
„Jetzt, wo Walter den Bagger fährt, könnt ihr euch das wohl leisten.“
„Ach Ella, da haben eure Männer selbst Schuld, dass Walter und nicht einer von euren beiden den Baggerschein machen konnte. Grummet und Bakeberg haben zusammen entschieden, dass keiner von beiden den Baggerschein kriegt, damit nicht schon wieder ein neuer Streit zwischen ihnen ausbricht. Sie wollten wohl auch keinem von beiden vor den Kopf stoßen, und so kriegte ein Dritter den Schein, in diesem Fall Walter.“
„Klar haben die selber Schuld, diese Streithähne“, sagte Ella. Glaub' jetzt'aber nicht, dass ich dem Walter den Baggerschein nicht gönne. Selbst Hermann gönnt ihm den, und ich denke, August auch. Sonst wäre das Verhältnis zwischen ihnen wohl getrübt, und davon kann ja wohl keine Rede sein.“
Selma verlor ihr Thema nicht aus den Augen und sagte begeistert: „Wisst ihr, dass ich für den Plattenspieler, den ich noch nicht habe, schon zwei Platten habe, Das alte Försterhaus und Mit der kleinen Bimmelbahn. Das ist vom Harz, da ist Walter ja her. Und er liebt die Bimmelbahn, die so durch den Harz fährt, und er liebt das Försterhaus, das für ihn auch im Harz steht. Das hatte mir eine Kellnerin vom Itschenkrug erzählt, die ich kenne, und wo er immer diese beiden Platten hört. Die haben da so einen Plattenspieler stehen wie bei Schulzes im Schaufenster, solchen, wie es die heute gibt für Kneipen, an der Seite steckt man Geld rein und wählt, dann kommt so ein Greifarm...“
„Nichts Neues mehr, steht bei Marwede auch schon“, sagte Ella wie nebenher, um zu zeigen, dass sie auf dem Laufenden ist.
„Und die nächste Platte, die ich kaufe, mir selbst zum Geburtstag, ist Catharina Valente: 'Tiitipitipso beim Calypso ist dann alles wieder gut, ja das ist mexikanisch'“, sang sie und tanzte ein paar Schritte den Wiesenweg entlang, den sie jetzt erreicht hatten und der ihnen einen festeren Boden gab als das Querfeldein durch die Wiesen.
„Das mit den Platten, Selma“, sagte Ella und musste unterbrechen, weil sie ihr Kichern nicht unterdrücken konnte, „ist ja so, hi hi hi, als wenn du Socken strickst und hast, hi hi hi, noch keine Füße.“
„Das ist nicht so“, widersprach Selma gelassen ruhig, „wenn du Platten hast, kannst du dir den Plattenspieler nachträglich kaufen, aber es gibt keine Füße zu kaufen, für die du schon Socken gestrickt hast.“