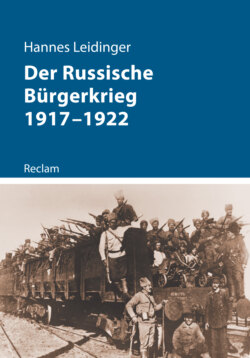Читать книгу Der Russische Bürgerkrieg 1917–1922 - Hannes Leidinger - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Föderalismus, Autonomie, Separatismus
ОглавлениеDer Zerfall des alten Russischen Reichs spiegelte sich auch in der Nationalitätenfrage wider. Seit dem Frühjahr 1917 brachten Vertreter der verschiedenen Minderheiten zunächst ihre Forderung nach Autonomie zum Ausdruck. Sozialisten und insbesondere Sozialisten-Revolutionäre befürworteten ein Föderalismuskonzept, wonach die im September ausgerufene Republik als Bundesstaat neu gebildet werden sollte.
Die Konfrontation zwischen Petrograd und der Peripherie des Vielvölkerstaates kam nicht überraschend. Im Grunde hatte schon die Revolution von 1905 eine Revision der bisherigen zentralistischen Politik nahegelegt. Mehr als die Hälfte der Bewohner des von kultureller und konfessioneller Vielfalt geprägten Reiches waren keine Russen. Der [32]Begriff »russländisch« beschrieb das Reich daher zutreffender als die ethnische Bezeichnung »russisch«. Seit dem späten 19. Jahrhundert durchlief es zudem eine Phase des erstarkenden Regional- und Nationalbewusstseins.
Anfänglich getragen von lokalen Eliten, sickerte die Abneigung gegen eine von der Obrigkeit vorangetriebene Russifizierung allmählich auch in die Unterschichten ein. Das Gros der Bevölkerung, die zu weit über 80 Prozent auf dem Land lebte, hielt zwar an seiner räumlich [33]beschränkten Lebenswelt fest, ohne eine genaue Vorstellung von den Vorgängen in den Machtzentren zu haben. Allerdings verfügten manche Ortsvorsteher über beträchtlichen Einfluss, wenn sie sich für Programme mit sozialen und nationalen Inhalten aussprachen. In dieser Hinsicht gelang es besonders den Sozialisten-Revolutionären in der Ukraine, die Interessen des Dorfes mit Forderungen nach ethnischer Autonomie und der Anerkennung von regionalen Sprachen und Kulturen zu verbinden.
[35]Die liberalen Konstitutionellen Demokraten (Kadety) in der Provisorischen Regierung taten sich mit derartigen Entwicklungen schwer. Die nichtrussischen Völker schienen ihnen für die Gewährung von Selbstverwaltungsrechten oft noch nicht reif genug. Im Laufe des Jahres 1917 schwenkte nahezu die gesamte Führung der Kadety auf einen russisch-nationalistischen Kurs ein. Nur den Polen gestand das Kabinett LwowLwow, Georgij J. (Fürst) die Unabhängigkeit zu. Für diesen Kurs bedurfte die Staatsspitze eines Rückhalts, den sie von den Räten auch bekam. Diese schärften in den ersten Monaten nach der Abdankung des ZarenNikolaus II. (Nikolaj Romanow, russ. Zar) beispielsweise den Finnen ein, einseitige Schritte zur Erreichung der Selbstständigkeit zu unterlassen.
Die Anerkennung einer ukrainischen Volkvertretung, und damit der nationalen Autonomie, löste in Petrograd schließlich zur Jahresmitte 1917 eine Regierungskrise aus. Nach rechts abdriftende Kadety zeigten sich empört, drei ihrer Wortführer und Minister traten zurück. Die Befürworter eines russischen Zentralstaates mochten mit einem verhältnismäßig schwach ausgeprägten Nationalgefühl vor allem der Bauern rechnen. Allerdings übersahen sie, dass ihre Unnachgiebigkeit den Trend zum Separatismus begünstigte. Die auf Selbstbestimmung pochenden Kräfte in den Randgebieten des Reiches erhielten nun durchaus massenhafte Unterstützung. Als die immer wieder hinausgeschobenen Wahlen zur Konstituierenden Versammlung (Konstituante) nach der Oktoberrevolution schließlich stattfanden, gewannen etwa in der Ukraine sowie in Estland, Georgien, Finnland und Armenien sozialistische Parteien mit nationalen Forderungen die Mehrheit der Stimmen. Nicht zuletzt unter solchen Bedingungen erkannte der Rat der Volkskommissare in seiner Deklaration vom November 1917 die Loslösung und völlige Unabhängigkeit der Randvölker von Russland an.
Mit den Dekreten unmittelbar nach dem Sturz KerenskijsKerenskij, Alexander F. reagierte LeninLenin, Wladimir Iljitsch sowohl auf nationale Unabhängigkeitsbestrebungen als auch auf die Bodenumverteilung auf dem Land und die allgemeine Friedenssehnsucht der Bevölkerung. Hinter den Kulissen dieser propagandistisch ausgeschlachteten Allianz mit dem Volk dominierten hingegen ideologisch eingefärbte Machtkalkulationen. Der »bürgerliche« Nationalismus werde, glaubten führende Bolschewiki, von der grenzüberschreitenden Klassensolidarität überwunden werden. In den Sitzungen der Sowjetregierung war das Bekenntnis zum »Weltproletariat« nicht mehr vom [36]großrussischen Chauvinismus zu trennen. Noch immer zählte man die Randgebiete zum eigenen Einflussbereich. Zwar befürwortete Josef StalinStalin, Josef als Volkskommissar für Nationalitätenfragen die Unabhängigkeit Finnlands von Russland. Und auch LeninLenin, Wladimir Iljitsch akzeptierte die finnischen Bestrebungen; das Land wurde am 6. Dezember ein selbstständiger Staat. In Wirklichkeit jedoch schürte das Oktoberregime in der Region einen Konflikt, um die frühere russische Vormachtstellung wiederherzustellen.
Das galt auch für die Ukraine, wo die Bolschewiki mindestens ebenso energisch vorgingen. LeninsLenin, Wladimir Iljitsch Gefolgschaft, die die Abspaltung der wichtigen Kornkammer des untergegangenen Zarenreiches fürchten musste, installierte in Charkow eine von Petrograd inspirierte Räteregierung. In der Folge rückten sowjetische Truppenverbände auf Jekaterinoslaw, Poltawa und schließlich auf Kiew vor.
Dort proklamierte die ukrainische Volksvertretung (Rada) nun den souveränen Staat. Fast zeitgleich bekundeten regionale Kräfte im Baltikum und im Kaukasus ihren Wunsch nach Selbstständigkeit. Bis dahin hatten die meisten ethnischen Minoritäten eine Föderation innerhalb der Grenzen des untergegangenen Zarenimperiums zumindest nicht pauschal abgelehnt. Anfang 1918 änderten sich die Voraussetzungen aber grundlegend: Unter anderem wären die Anliegen der Ethnien und damit die Umstrukturierung des Gesamtreiches Sache der Verfassunggebenden Versammlung gewesen – die aber wurde von den Bolschewiki aufgelöst. Da LeninLenin, Wladimir Iljitsch und seine Gefolgschaft in der weitgehend frei gewählten Volksvertretung keine Mehrheit stellten, entschieden sie sich, eine demokratische Entwicklung frühzeitig zu vereiteln. Gewaltsam wurden Gegendemonstrationen in Petrograd unterdrückt.
Zugleich mussten die Wahlsieger, die Sozialisten-Revolutionäre, erkennen, dass die Bauern, die für sie gestimmt hatten, wenig Anteil an den Vorgängen in der Hauptstadt nahmen und sich mit den Verfügungen der Volkskommissare prinzipiell zufriedengaben. Hinzu kam die Schwäche der nunmehrigen Opposition, die vor allem auf die Konflikte seit der Februarrevolution zurückging. Die Partei der Sozialisten-Revolutionäre war gespalten: Ihre ukrainischen Mitglieder freundeten sich mit nationalen Programmen an, eine linke Fraktion wiederum brach mit der Mutterpartei, um mit den Bolschewiki eine Koalitionsregierung zu bilden. Der Schulterschluss zwischen Arbeitern und Bauern schien sich sowohl auf Regierungsebene als auch in den Räteorganisationen zu [37]manifestieren, zumal die Arbeiter-, Soldaten- und Bauernsowjets zu einer Einheit verschmolzen.
Die rechten Sozialisten-Revolutionäre blieben unterdessen nicht von internen Auseinandersetzungen verschont. Überdies sahen sie sich von liberalen, konservativen und noch weiter rechts stehenden Kräften sowie von autoritären Offizierskreisen herausgefordert. Die Zersplitterung des Parteienspektrums drückte sich in Konflikten zwischen antibolschewistischen Gruppierungen aus, die in Sibirien, im Wolga- und Uralgebiet entstanden. Deren programmatische Uneinigkeit und handfeste politisch-ökonomische Interessenkonflikte beruhten unter anderem auf unterschiedlichen Besitzverhältnissen und Sozialstrukturen in den einzelnen Regionen.
Bisweilen nahmen die Rivalitäten den Charakter von internationalen Konfrontationen an. Das traf zunächst und vor allem für den Gegensatz zwischen den von den Bolschewiki kontrollierten Territorien und jenen Gebieten zu, in denen ihre Widersacher das Sagen hatten. Bezeichnenderweise riefen die Donkosaken wenige Wochen nach der Oktoberrevolution eine eigene Republik aus und spalteten sich damit vom russischen Zentrum ab.
Donkosaken im Spätherbst 1914
[38]Viele Gegner LeninsLenin, Wladimir Iljitsch sprachen es offen aus: Der »Abfall vom Vaterland« war eine Reaktion auf die »despotische Macht«, die »zerstörerische Politik der bolschewistischen Anführer«. Dass auch nach deren erhoffter Niederlage ein föderativer Reichsaufbau Schwierigkeiten bereiten würde, konstatierten indessen britische Beobachter angesichts der Eigenständigkeitsbestrebungen unterschiedlicher Kräfte in der Ukraine, in Weißrussland, am Don und im Kuban-Gebiet: Der Zusammentritt eines wiedereröffneten Zentralparlaments, der von LeninLenin, Wladimir Iljitsch aufgelösten Verfassunggebenden Versammlung, würde neue Kämpfe zwischen den ethnischen Gruppen mit sich bringen.
Manche Völker lehnten ohnehin eine übergeordnete Staatlichkeit ab und verfolgten separatistische Ziele. 1919 baten etwa Vertreter Aserbaidschans, Georgiens, Estlands, Lettlands, Litauens und der Ukraine um internationale Anerkennung als unabhängige Staaten.
Selbst ohne derartige Bekundungen der Souveränität gingen zudem viele Kosaken, die man lange als patriotische Beschützer des Zarenimperiums und seiner Grenzen betrachtet hatte, auf Distanz zu Großrussland. Zumindest orientierten sie sich nicht an den Machtkämpfen in Moskau oder Petrograd, sondern an der selbstbestimmten Entwicklung ihrer Siedlungsgebiete. Fremdstämmige wurde dort bisweilen brutal verfolgt. Eine regelrechte ethnische Säuberung setzte ein.
Ethnische Russen stellten in den Randgebieten oder in den Städten und Industriegebieten einen durchaus hohen Anteil an der Gesamtbevölkerung. Insofern es sich um Angehörige unterprivilegierter Gesellschaftsschichten handelte, sympathisierten sie mit sozialistischen und probolschewistischen Kräften. Die dünne bürgerlich-aristokratische Schicht mit ihren zerstrittenen politischen Führungsgruppen wurde hingegen im Gefolge der revolutionären Umwälzungen bedeutungslos. Sie musste an der Peripherie den Aufschwung von nationalen Selbstbestimmungsbewegungen mit ansehen, die allerdings erst allmählich eigene Vertretungskörper etablierten. Vorläufig boten die neuen Verwaltungsstrukturen gegen das gleichfalls noch keineswegs gefestigte Oktoberregime kaum Stabilität. Die Zukunft hing deshalb von anderen Einflussfaktoren ab.