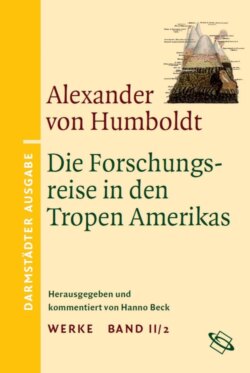Читать книгу Werke - Hanno Beck - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
[Über das Zodiakallicht]
ОглавлениеWährend meines Aufenthalts in den Tälern von Tuy und Aragua zeigte sich das Zodiakallicht fast in jeder Nacht überaus hell glänzend. Ich hatte unter den Wendekreisen zum ersten Mal in Caracas, am 18. Januar [1800], nach 7 Uhr abends wahrgenommen. Die Spitze der Pyramide fand sich bei 53° Höhe. Der helle Schein verschwand gänzlich um 9h 35′ (wahre Zeit), fast 3h 50″ nach Sonnenuntergang, ohne daß die Klarheit des Himmelsgewölbes sich vermindert hätte. La Caille war schon auf seiner Reise nach Río de Janeiro und dem Kap von der Schönheit des Zodiakallichts zwischen den Wendekreisen beeindruckt, nicht so sehr seiner weniger geneigten Position als der großen Reinheit der Luft wegen. Man könnte es sogar befremdlich finden, daß nicht schon lange vor Childrey und Dominique Cassini Seefahrer, die häufig die Meere beider Indien besuchten, die Gelehrten Europas auf diesen durch bestimmte Form und Gang ausgezeichneten hellen Schein aufmerksam gemacht haben, wenn man nicht wüßte, wie wenig sich diese überhaupt bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts um Dinge kümmerten, die sich nicht unmittelbar auf den Lauf des Schiffes und die Kunst des Steuermanns bezogen.
Wie glänzend das Zodiakallicht im trockenen Tal von Tuy auch war, habe ich es doch viel schöner auf dem Rücken der mexicanischen Cordilleren an den Ufern des Tezcuco-Sees 1160 Toisen über der Meeresfläche gesehen. Delucs Hygrometer geht auf diesem Plateau bis zu 15° zurück, und unter 21 Zoll 8 Linien des barometrischen Druckes ist die Extinktion des Lichts um 1/1006 schwächer als in den Ebenen. Im Januar 1804 stieg die Helle zuweilen mehr als 60° über den Horizont. Die Milchstraße schien vor dem nahen Glanz des Zodiakallichts zu erblassen; und wenn sich zerstreute bläuliche Wölkchen gegen Westen gesammelt hatten, sah es aus, als wolle der Mond aufgehen.
Ich will hier einer anderen, sehr seltsamen Erscheinung gedenken, die mehrmals in meinen an Ort und Stelle geführten Tagebüchern verzeichnet steht. Am 18. Januar und am 15. Februar 1800 trat eine sehr merkliche Veränderung des Zodiakallichts von zwei zu zwei Minuten abwechselnd ein. Bald war es ungemein schwach, bald übertraf es wieder den Glanz der Milchstraße im Schützen. Die Wechsel ereigneten sich in der ganzen Pyramide, besonders aber im Inneren, von den Rändern entfernt. Während dieser Veränderungen des Zodiakallichtes deutete das Hygrometer große Trockenheit an. Die Sterne vierter und fünfter Größe stellten sich dem unbewaffneten Auge in unverändert gleicher Stärke des Lichts dar. Keine Spur von Nebel war vorhanden, und es schien durchaus nichts die Reinheit der Atmosphäre zu stören. In anderen Jahren sah ich in der südlichen Halbkugel eine Zunahme des Lichts eine halbe Stunde vor seinem Verschwinden. Dominique Cassini ließ „eine Abnahme des Zodiakallichts in gewissen Jahren und eine Wiederkehr seiner früheren Helle“ gelten. Er glaubte, diese allmählich eintretenden Wechsel rührten „von den gleichen Ausströmungen her, welche die periodische Erscheinung der dunklen und hellen Sonnenflecken darstellen“, aber dieser treffliche Beobachter spricht nicht von dem Wechsel der Stärke des Zodiakallichts, den ich mehrmals in den Tropenländern innerhalb weniger Minuten wahrgenommen habe. Mairan bezeugt, in Frankreich sehe man gar nicht selten in den Monaten Januar und Februar das Zodiakallicht sich mit einer Art Nordlicht mischen, die er unbestimmt nennt und deren nebulöse Materie sich entweder rings um den Horizont verbreitet oder sich im Westen zeigt. Ich glaube nicht, daß bei den Beobachtungen, deren ich soeben gedachte, eine Vermischung beider Lichtarten stattgefunden hat. Der Wechsel der Stärke ging in sehr großer Höhe vor sich; das Licht war weiß und nicht farbig, ruhig und nicht flatternd. Daneben ist die Erscheinung des Nordlichts in den Tropenländern so selten, daß in fünf Jahren, obgleich ich im Freien schlief und das Himmelsgewölbe mit der angestrengtesten Aufmerksamkeit beobachtete, ich doch niemals auch nur die mindeste Spur davon zu sehen bekam.
Wenn ich alles zusammenfasse, was sich über die Veränderungen des Zodiakallichts in meinen Tagebüchern verzeichnet findet, bin ich geneigt zu glauben, diese Veränderungen seien nicht bloß scheinbare Ergebnisse gewisser Modifikationen, die unsere Atmosphäre erleidet. Bisweilen habe ich in nicht minder hellen Nächten das Zodiakallicht vergeblich gesucht, wenn es am vorhergehenden Abend in größtem Glanz erschienen war. Soll man annehmen, daß Ausströmungen, die das weiße Licht zurückstrahlen und die mit den Kometenschweifen Ähnlichkeit zu haben scheinen, in gewissen Zeiten weniger reichlich vorkommen? Die Untersuchungen über das Zodiakallicht werden interessanter, seit messende Gelehrte uns beweisen, daß wir die wahre Ursache dieser Erscheinung nicht kennen. Der berühmte Verfasser der ›Mécanique céleste‹ [Joseph de Lalande] hat gezeigt, daß die Sonnenatmosphäre sich nicht einmal bis in die Bahn des Merkurs erstrecken kann und daß sie in keinem Fall die Linsenform darstellte, in der das Zodiakallicht dem Beobachter erscheint. Es lassen sich übrigens hinsichtlich der Natur dieses Lichts die gleichen Zweifel wie über die des Kometenschweifs erheben. Ist es wirklich ein zurückgestrahltes oder doch ein unmittelbares Licht? Hoffentlich werden reisende Naturforscher, die künftig die Äquinoktialländer besuchen, sich mit solchen Polarisationsvorrichtungen versehen, welche die wichtige Frage zu lösen geeignet sind.
*
Wir verließen am 11. Februar [1800] bei Sonnenaufgang die Pflanzungen von Manterola. Der Weg führte längs der anmutigen Ufer des Tuy; der Morgen war kühl und feucht; die Luft war mit dem herrlichen Geruch des Pancratium undulatum und anderer großer Liliaceen erfüllt. Um nach La Victoria zu gelangen, kommt man durch das hübsche Dorf Mamón oder Consejo, das durch ein Wunderbild der Jungfrau in der Provinz berühmt ist. Nahe vor dem Dorf machten wir in einer der Familie Monteras gehörigen Hacienda halt. Eine mehr als hundertjährige Negerin saß vor einer kleinen, aus Erde und Rohr aufgeführten Hütte. Man kannte ihr Alter, weil sie eine Creolensklavin gewesen war. Sie schien noch sehr gesund zu sein. „Ich halte sie an der Sonne (la tengo al sol) “, sagte ihr Enkel, „die Wärme erhält ihr Leben.“ Das Mittel kam uns gewaltsam vor, denn die Sonne warf fast senkrechte Strahlen. Die Völkerstämme mit schwarzbrauner Haut, die wohlakklimatisierten Neger und die Indianer erreichen in der heißen Zone ein glückliches Alter. Ich habe anderswo die Geschichte eines Eingeborenen von Peru erwähnt, der im 143. Lebensjahr starb, nachdem er 90 Jahre im Ehestand gelebt hatte.
Don Francisco Montera und sein Bruder, ein junger, sehr aufgeklärter Geistlicher, begleiteten und führten uns nach ihrem Haus in La Victoria. Fast alle Familien, mit denen wir zu Caracas in freundschaftlichen Verhältnissen gelebt hatten, bewohnten die schönen Talgründe von Aragua. Als Besitzer der reichsten Pflanzungen wetteiferten sie, uns unseren Aufenthalt angenehm zu machen. Ehe wir in die Wälder des Orinoco eindrangen, genossen wir nochmals alle Vorteile einer vorgeschrittenen Zivilisation.
Der Weg von Mamón nach La Victoria wendet sich nach Süden und Südwesten. Den Tuy-Fluß verloren wir bald aus den Augen, da er sich am Fuß der hohen Gebirge des Guayraima östlich wendet und eine Krümmung bildet. In dem Maß, wie man sich La Victoria nähert, wird das Land flacher und gleicht dem Grund eines ausgelaufenen Sees. Man könnte sich in das Haslital des Kantons Bern versetzt glauben. Die aus Kalktuff bestehenden Hügel der Nachbarschaft sind nur 140 Toisen hoch, fallen aber senkrecht ab und rücken wie Vorgebirge in die Ebene vor. Ihre Form deutet das alte Seeufer an. Das östliche Ende des Tals ist dürr und unbebaut. Die von den nahen Bergen bewässerten Schluchten sind noch unbenutzt, dagegen hat zunächst um die Stadt her eine schöne Landeskultur begonnen. Ich sage der Stadt, obgleich zu meiner Zeit Victoria nur als ein einfaches Dorf (pueblo) betrachtet wurde.
Man kann sich nicht leicht einen Ort als Dorf vorstellen, der 7000 Einwohner, schöne Gebäude, eine mit dorischen Säulen geschmückte Kirche und alle Hilfsmitteln des Handelsfleißes besitzt. Längst schon haben die Bewohner von Victoria beim spanischen Hof um die Benennung Villa und um die Berechtigung, einen cabildo oder Munizipalrat zu ernennen, nachgesucht. Das spanische Ministerium widersetzte sich ihrem Begehren, obgleich es zur Zeit der Expedition von Iturriaga und Solano zum Orinoco auf das dringende Ersuchen der Franziskaner-Mönche etlichen Gruppen indianischer Hütten den hochtönenden Namen ciudad bewilligt hatte. Die Munizipalregierung sollte ihrer Natur nach eine wesentliche Grundlage der Freiheit und Gleichheit der Bürger sein, in den spanischen Kolonien ist sie aber zur Munizipalaristokratie ausgeartet. Anstatt den Einfluß mächtiger Familien klug zu benützen, fürchten die Inhaber einer unbeschränkten Gewalt das, was sie den Unabhängigkeitsgeist der kleinen Gemeinden nennen. Lieber wollen sie den Staatskörper gelähmt und kraftlos lassen, als Aktionszentren zu begünstigen, die ihrem Einfluß entgehen und ein partielles Leben unterhalten, das die Gesamtmasse beseelt, weil es mehr vom Volk als von der höchsten Gewalt ausgeht. Zur Zeit Karls V. und Philipps II. wurde die Munizipaleinrichtung vom Hof weise begünstigt. Angesehene Männer, die während der conquista des Landes eine Rolle gespielt hatten, gründeten Städte und die ersten cabildos nach spanischen Vorbildern. Damals bestand eine Rechtsgleichheit zwischen den Bewohnern des Mutterlandes und ihren Abkömmlingen in Amerika. Die Politik war damals, ohne frei zu sein, weniger argwöhnisch als heutzutage. Der kürzlich eroberte und verwüstete Kontinent wurde als eine entlegene spanische Besitzung betrachtet. Die Idee einer Kolonie in dem Sinn, der gegenwärtig damit verbunden wird, entwickelte sich erst infolge des neueren Systems der Handelspolitk; und diese erkannte zwar die wahrhaften Quellen des Nationalreichtums, wurde aber auch bald engherzig, argwöhnisch und exklusiv. Sie verursachte Zwietracht zwischen dem Mutterland und den Kolonien; sie stellte zwischen den Weißen eine Ungleichheit her, die der ersten Gesetzgebung Indiens fremd gewesen war. Die Konzentration der Gewalten schwächte nach und nach den Einfluß der Munizipalitäten, und die gleichen cabildos, die im 16. und 17. Jahrhundert berechtigt waren, beim Tod eines Statthalters das Land interimsweise zu verwalten, wurden vom Hof in Madrid als gefährliche Hindernisse der königlichen Gewalt angesehen. Von da an wurde es auch den reichsten Dörfern trotz des Wachstums ihrer Bevölkerung sehr schwer, die Benennung von Städten und das Recht der eigenen Verwaltung zu erhalten. Hieraus ergibt sich, daß die Philosophie die neueren Veränderungen der Kolonialpolitik nicht alle begünstigte. Um sich davon vollends zu überzeugen, darf man sich nur mit der Gesetzgebung Indiens [›Leyes de Indias‹, als die ältesten] näher bekanntmachen, soweit sie die nach Amerika verpflanzten Spanier und ihre Nachkommen, die Rechte der Gemeinden und die Einrichtung der Munizipalitäten betrifft.
Die Gegend von Victoria gewährt einen merkwürdigen Anblick hinsichtlich des Landbaus. Das bebaute Land liegt 270 bis 300 Toisen über dem Meeresspiegel, und doch sieht man hier Getreidefelder zwischen Pflanzungen von Zuckerrohr, Kaffee und Banane. Mit Ausnahme der inneren Landschaft der Insel Cuba trifft man fast nirgends anderswo in den Äquinoktial-Gegenden der spanischen Kolonien die europäischen Getreidearten auf so geringer Höhe im großen angebaut. In Mexico liegen die schönen Getreidefelder zwischen 600 und 1200 Toisen absoluter Höhe; nur selten steigen sie auf 400 Toisen hinab. Wir werden bald sehen, daß der Ertrag der Zerealien von den hohen Breiten gegen den Äquator hin in Verbindung mit der mittleren Temperatur des Klimas sich bedeutend vermehrt, wie der Vergleich verschieden hoher Gegenden belegt. Der Erfolg des Feldbaus hängt von der Trockenheit der Luft ab, von den Regen, die zwischen verschiedene Jahreszeiten verteilt oder nur auf die Winterzeit zusammengedrängt sind, von beständigen Ostwinden oder solchen, welche die kalten Nordwinde in niedere Breiten (wie im mexicanischen Golf) herabführen, von Nebeln, durch welche monatelang die Kraft der Sonnenstrahlen gedämpft wird, von einer Menge anderer örtlicher Umstände endlich, die weniger auf die mittlere Jahrestemperatur als auf die Verteilung einer gleichen Wärmemasse unter die verschiedenen Jahreszeiten Einfluß haben. Es ist eine merkwürdige Erscheinung, die europäischen Zerealien vom Äquator bis nach Lappland durch 69 Breitengrade in Ländern, die +22° bis — 2° mittlerer Wärme haben, überall angebaut zu sehen, wo die Temperatur des Sommers über 9 bis 10° beträgt. Man kennt das Minimum der zum Reifen des Weizens, der Gerste oder des Hafers erforderlichen Wärme; ungewisser ist man hinsichtlich des Maximums, welches diese sonst so flexiblen Grasarten ertragen. Wir kennen selbst den Inbegriff der Umstände nicht, die dem Getreidebau in den Tropenländern auf geringen Höhen günstig sind. Victoria und das benachbarte Dorf San Mateo erbringen 4000 Zentner Weizen. Die Aussaat geschieht im Dezember. Nach 70 oder 75 Tagen erfolgt die Ernte. Die Körner sind groß, weiß und reich an Kleber; ihr Häutchen ist dünner und weniger hart als das des Weizens der sehr kalten mexicanischen Plateaus. Ein Morgen Land bringt in der Gegend von Victoria gewöhnlich 3000 bis 3200 Pfund Weizen. Der Durchschnittsertrag ist demnach hier wie in Buenos Aires zwei- bis dreimal so groß wie in den nördlichen Ländern. Man erntet ungefähr die 16fache Saat, während den Ergebnissen von Lavoisiers Forschungen zufolge der Boden Frankreichs im Durchschnitt nur die 5- bis 6fache Aussaat oder 1000 bis 1200 Pfund auf den Morgen bringt. Trotz dieser Fruchtbarkeit des Landes und dieses günstigen klimatischen Einflusses ist die Pflanzung des Zuckerrohrs in den Tälern von Aragua einträglicher als die der Zerealien.
Der kleine Río Calanchas fließt durch La Victoria; er mündet nicht in den Tuy, sondern in den Río Aragua; daraus folgt, daß diese schöne Landschaft, in der gleichzeitig Zuckerrohr und Weizen reifen, bereits dem Becken des Sees von Valencia und einem System innerer Flüsse angehört, die mit dem Meer in keiner Verbindung stehen. Das auf der Westseite des Río Calanchas gelegene Stadtviertel führt den Namen la otra banda und ist der vorwiegend handeltreibende Teil. Überall sind Waren ausgelegt, und die Straßen bestehen aus Reihen von Krambuden. Durch La Victoria führen zwei Handelsstraßen, die von Valencia oder von Puerto Cabello und die Straße von Villa de Cura oder der Ebenen, die den Namen camino de los Llanos führt. Man trifft hier verhältnismäßig mehr Weiße an als in Caracas. Bei Sonnenuntergang erstiegen wir den kleinen Kalvarienberg, der eine ungemein schöne und ausgedehnte Fernsicht hat. Westwärts übersieht man die anmutigen Täler von Aragua, deren weites Erdreich mit Gärten, angebauten Feldern, wilden Baumgruppen, Haciendas und Dörfern besetzt ist. Im Süden und Südosten sieht man, so weit das Auge reicht, die hohen Gebirge von la Palma, Guayraima, Tiara und Guiripa, hinter welchen die unermeßlichen Ebenen von Calabozo liegen. Diese innere Kette dehnt sich westwärts aus, dem See von Valencia entlang gegen Villa de Cura, Cuesta de Yusma und die zackigen Berge von Güigüe. Sie ist steil und immer mit dem leichten Dunst bedeckt, der in heißen Klimaten entfernten Gegenständen eine hellblaue Färbung erteilt und ihre Umrisse keineswegs verhüllt, sondern ihnen vielmehr einen kräftigeren Ausdruck verleiht. Unter den Bergen der inneren Kette erreichen, wie man glaubt, die von Guayraima an die 1200 Toisen Höhe. In der Nacht des 11. Februar [1800] fand ich die Breite von Victoria zu 10° 13′ 35″; die magnetische Inklination war 40,80°, die Intensität der entsprechenden Kräfte betrug 236 Schwingungen in 10 Minuten und die Abweichung der Nadel 4° 40′ nordöstlich.
Wir setzten unsere Route langsam durch die Dörfer San Mateo, Turmero und Maracay fort nach der Hacienda de Cura, einer schönen Pflanzung des Grafen Továr, wo wir erst am 14. Februar [1800] abends eintrafen. Das Tal erweitert sich zunehmend; es ist von Hügeln aus Kalktuff, der hier tierra blanca heißt, eingefaßt. Die Gelehrten des Landes haben verschiedene Versuche unternommen, um diese Erde zu benennen. Sie verwechselten sie mit der Porzellanerde, die aus verwitterten Feldspatschichten entsteht. Wir verweilten einige Stunden bei einer ebenso achtenswerten wie kenntnisreichen Familie, den Ustariz in Concesión. Das Haus, worin sich auch eine ausgewählte Büchersammlung befindet, steht auf einer Anhöhe; es ist von Kaffee- und Zuckerrohrpflanzungen umgeben. Ein Wäldchen aus Balsamsträuchern [Amyris elata] gewährt der Anlage Schatten und Kühlung. Mit lebhafter Teilnahme sahen wir die zahlreichen im Tal zerstreuten und von Freigelassenen bewohnten Häuser. Die Gesetze, die Institutionen und die Sitten sind der Freiheit der Neger in den spanischen Kolonien günstiger als in denen der übrigen europäischen Nationen.
San Mateo, Turmero und Maracay sind reizende Dörfer, worin alles den größten Wohlstand zeigt. Man glaubt, sich im gewerbefleißigsten Teil Kataloniens zu befinden. In der Nähe von San Mateo sahen wir die letzten Weizenfelder und die letzten Mühlen mit waagerechten Wasserrädern. Man erwartete eine Ernte von 20 facher Aussaat, und als wäre dies noch ein mäßiger Ertrag, fragte man mich, ob in Preußen und Polen das Getreide mehr bringe. Einem in den Tropenländern allgemein verbreiteten Irrtum zufolge glaubt man, die Zerealien seien Pflanzen, die, sowie sie sich dem Äquator nähern, ausarten und in den nördlichen Ländern reichere Ernten lieferten. Seit man gelernt hat, einerseits den Ertrag der Ernten in den verschiedenen Zonen und andererseits die Temperaturen, unter deren Einfluß die Zerealien sich entwickeln, zu berechnen, überzeugte man sich, daß über den 45. Breitengrad hinaus nirgends der Weizen einen so reichen Ertrag liefert wie an den Nordküsten Afrikas und auf den Plateaus von Neu-Granada, Peru und Mexico. Beim Vergleich der mittleren Temperaturen nicht des Gesamtjahres, sondern allein der Jahreszeit, die den Vegetationszyklus der Zerealien betrifft, ergeben sich für drei Sommermonate im nördlichen Europa 15 bis 19°; in der Berberei und in Ägypten 27 bis 29°; in den Tropenländern, zwischen 1400 und 300 Toisen Höhe, 14 bis 25, 5° des hundertteiligen Thermometers.
Die reichen Ernten in Ägypten und im Königreich Algier, in den Tälern von Aragua und im Innern der Insel Cuba beweisen genügend, daß der höhere Wärmegrad dem Ertrag des Weizens und anderer nährender Grasarten keineswegs nachteilig wird, wenn nämlich dieser höheren Temperatur kein Übermaß von Trockenheit oder Feuchtigkeit beigestellt ist. Diesem letzteren Umstand müssen ohne weiteres die augenscheinlichen Anomalien zugerechnet werden, die zuweilen in den Tropenländern an der unteren Grenze der Zerealien bemerkt werden. Mit Erstaunen sieht man östlich von Havanna, in dem sehr bekannten Landstrich der Cuatro villas, diese Grenze bis zur Fläche des Ozeans herabsteigen, während westlich von Havanna, am Abhang der mexicanischen Berge in der Nähe von Jalapa, auf 677 Toisen Höhe der Pflanzenwuchs noch dermaßen üppig ist, daß der Weizen keine Ähren bildet. In den ersten Zeiten der conquista wurden die europäischen Zerealien mit Erfolg in mehreren Gegenden angebaut, von denen man heutzutage glaubt, sie seien zu warm oder zu feucht für diesen Zweig der Landwirtschaft. Die eben erst nach Amerika verpflanzten Spanier waren nicht an die Maisnahrung gewöhnt und den europäischen Gewohnheiten noch mehr zugetan; man berechnete nicht, ob der Ertrag des Getreides dem des Kaffees oder der Baumwolle nachstehe; man versuchte alle Aussaaten; man befragte die Natur mit mehr Unternehmungslust, weil man weniger aufgrund falscher Theorien räsonierte. Die Provinz Cartagena, durch welche sich die Bergketten von Maria und Guamoco hinziehen, lieferte Getreideernten bis in das 16. Jahrhundert. In der Provinz Caracas ist dieser Anbau in dem gebirgigen Terrain von Tocuyo, Quibor und Barquisimeto, das die Küstenkette mit der Sierra Nevada von Mérida verbindet, sehr häufig. Er hat sich darin glücklich erhalten, und die Umgegend der Stadt Tocuyo allein führt jährlich fast 8000 Zentner vortreffliches Mehl aus. Aber obgleich die Provinz Caracas mit ihrer weiten Ausdehnung mehrere zur Entwicklung des europäischen Weizens sehr geeignete Gegenden bietet, denke ich, daß im allgemeinen dieser Zweig der Landwirtschaft dort niemals sehr bedeutend sein wird. Die temperiertesten Täler sind zu schmal; es sind keine echten Plateaus, und ihre mittlere Erhöhung über dem Meeresspiegel ist zu unbeträchtlich, als daß die Einwohner es nicht vorteilhafter finden sollten, Kaffeepflanzungen anzulegen, statt Zerealien anzubauen. Gegenwärtig wird das Mehl, dessen Caracas bedarf, entweder aus Spanien oder aus den Vereinigten Staaten eingeführt. Wenn für Gewerbefleiß und öffentlicher Ruhe günstigeren politischen Umständen der Weg von Santa Fé de Bogotá nach dem Stapelplatz des Pachaquiaro gebahnt ist, werden die Einwohner von Venezuela gewiß ihr Mehl aus Neu-Granada auf dem Río Meta und dem Orinoco empfangen.
Vier lieues von San Mateo befindet sich das Dorf Turmero. Der Weg führt ununterbrochen durch Pflanzungen von Zuckerrohr, Indigo, Baumwolle und Kaffee. Die in der Anlage der Dörfer vorhandene Regelmäßigkeit erinnert daran, daß sie alle den Mönchen und den Missionen ihren Ursprung verdanken. Die Straßen laufen der Schnur nach parallel miteinander und kreuzen sich rechtwinklig; auf dem in der Mitte befindlichen, ein Viereck bildenden Großen Platz steht die Kirche. Die von Turmero ist ein kostbares, aber mit architektonischem Zierat überladenes Gebäude. Seit die Missionare den Pfarrern Platz machten, haben sich die Wohnungen der weißen Einwohner mit denen der Indianer vermischt. Die letzteren verschwinden nach und nach als gesonderter Stamm, das heißt, sie werden in der Gesamtübersicht der Bevölkerung durch die Mestizen und die Zambos repräsentiert, deren Anzahl stetig wächst. Indessen habe ich doch noch 4000 zinspflichtige Indianer in den Tälern von Aragua angetroffen. Die von Turmero und Guacara sind die zahlreichsten. Sie sind klein, aber weniger untersetzt als die Chaimas; ihre Augen zeigen mehr Lebhaftigkeit und Verstand, was vielleicht weniger von anderer Rasse als vom höheren Grad der Zivilisation herrührt. Sie arbeiten gleich den Freien im Tagelohn; während der kurzen Zeit, die sie der Arbeit widmen, sind sie tätig und fleißig; aber was sie in zwei Monaten gewinnen, verwenden sie in einer Woche auf den Ankauf starker Getränke in den kleinen Wirtschaften, deren Zahl bedauerlicherweise von Tag zu Tag größer wird.
In Turmero sahen wir den abschließenden Teil einer Versammlung der Landmiliz; allein ihr Anblick zeigte uns, daß diese Täler seit Jahrhunderten in ununterbrochenem Frieden gelebt haben. Der Generalkapitän, der glaubte, dem Militärdienst einen neuen Anstoß zu geben, hatte große Übungen angeordnet; in einem Scheingefecht hatte das Bataillon von Turmero auf das von La Victoria gefeuert. Unser Wirt, ein Leutnant der Miliz, unterhielt uns mit einer langen Schilderung dieser gefahrvollen Manöver: Er sah sich von Gewehren umgeben, die jeden Augenblick zerspringen konnten; er mußte vier Stunden lang an der Sonne stehen, und seine Sklaven durften nicht einmal einen Sonnenschirm über ihn ausbreiten! Wie schnell nehmen die anscheinend friedfertigsten Völker kriegerische Gewohnheiten an! Damals lächelte ich über eine Furchtsamkeit, die sich mit solch naiver Treuherzigkeit aussprach – und zwölf Jahre später sind eben diese Täler von Aragua, die stillen Ebenen von La Victoria und Turmero, der Engpaß von La Cabrera und die fruchtbaren Gestade des Valencia-Sees Schauplatz der blutigsten und erbittertsten Gefechte zwischen den Eingeborenen und den Soldaten des Mutterlandes geworden.
Südwärts von Turmero rückt eine Masse von Kalkgebirgen in die Ebene vor und trennt zwei schöne Zuckerpflanzungen, die von La Guayavita und die von Paja. Letztere ist Eigentum der Familie des Grafen Továr, der in allen Teilen der Provinz Besitzungen hat. Nahe bei Guayavita hat man braunes Eisenerz entdeckt. Nordwärts von Turmero in der Küstencordillere erhebt sich ein Granitgipfel, der Chuao, von dessen Höhe herab man zugleich das Meer und den See von Valencia erblickt. Wenn man diesen Felsenkamm übersteigt, der sich unabsehbar nach Westen ausdehnt, gelangt man auf ziemlich schwierigen Fußpfaden nach den reichen Cacaopflanzungen, die das Küstenland in Choroni, Turiamo und Ocumare aufweist und die wegen der Fruchtbarkeit ihres Bodens ebenso wie wegen ihres ungesunden Klimas bekannt sind. Turmero, Maracay, Cura, Guacara, jeder Punkt des Tals von Aragua hat seinen Bergpfad, der nach einem der kleinen Küstenhäfen hinführt.
Beim Verlassen des Dorfes Turmero entdeckt man in Entfernung einer lieue einen Gegenstand, der sich am Horizont wie ein abgerundeter Hügel, wie ein mit Vegetation bedeckter tumulus darstellt. Es ist aber kein Hügel und keine Gruppe nahe beisammenstehender Bäume, sondern ein einziger Baum, der berühmte Zamang del Guayre, der in der ganzen Provinz wegen der ungeheuren Ausdehnung seiner Zweige bekannt ist, die einen halbkugelförmigen Wipfel von 576 Fuß Umfang bilden. Der Zamang ist eine schöne Mimosenart, deren gewundene Zweige sich gabelförmig teilen. Sein zartes und dünnes Blätterwerk stellt sich gegen den Azur des Himmels angenehm dar. Wir verweilten lange unter diesem Pflanzengewölbe. Der Stamm des Zamang del Guayre, der eigentlich auf der Straße von Turmero nach Maracay steht, hat nicht mehr als 60 Fuß Höhe und 9 Fuß Durchmesser, seine eigentliche Schönheit aber besteht in der Gesamtform seines Wipfels. Die Äste dehnen sich wie ein weiter Sonnenschirm aus und neigen sich überall dem Boden zu, von dem sie gleichmäßig 12 bis 15 Fuß entfernt bleiben. Der Umkreis der Verästelung oder des Wipfels ist so regelmäßig, daß ich bei Aufnahme mehrerer Durchmesser diese zu 192 und 186 Fuß gefunden habe. Die eine Seite des Baums war völlig entblättert infolge der Trockenheit; auf einer anderen Seite waren gleichzeitig Blätter und Blüten geblieben; Tillandsien, Lorantheen, Pitahaya-Opuntien und andere Schmarotzerpflanzen bedecken die Zweige und zerstören deren Rinde. Die Bewohner dieser Täler, vorzüglich die Indianer, hegen eine große Verehrung für den Zamang del Guayre, den die ersten Eroberer ungefähr schon in eben dem Zustand, worin er sich gegenwärtig befindet, angetroffen zu haben scheinen. Seit er genauer beobachtet wird, haben sich weder Größe noch Gestaltung des Baumes verändert. Der Zamang muß wenigstens das Alter des Drachenbaumes von Orotava haben. Es liegt etwas Imponierendes und Majestätisches in dem Anblick alter Bäume; auch wird die Beschädigung dieser Denkmäler der Natur in Ländern, die keine Denkmäler der Kunst haben, streng bestraft. Wir hörten mit Genugtuung, der gegenwärtige Eigentümer des Zamang habe einen Prozeß gegen einen Pächter angestrengt, der sich angemaßt hatte, einen Ast von dem Baum abzuschneiden; der Prozeß wurde geführt und der Pächter verurteilt. Es stehen in der Nähe von Turmero und der Hacienda de Cura andere Zamangs, deren Stamm dicker ist als der von Guayre, während ihr halbkugelförmiger Wipfel nicht so breit und ausgedehnt ist wie dieser.
Anbau und Bevölkerung vermehren sich in dem Maß, wie man auf dem nördlichen Ufer des Sees nach Cura und Guácara vorankommt. Im Tal von Aragua zählt man über 52.000 Einwohner auf einem Areal, das 13 lieues lang und 2 lieues breit ist. Das ergibt eine relative Bevölkerung von 2000 Seelen auf die Quadratlieue, was den bevölkertsten Gegenden Frankreichs gleichkommt. Das Dorf oder eher der Flecken Maracay war einst der Mittelpunkt der Indigopflanzungen, zur Zeit, als dieser Zweig des kolonialen Gewerbefleißes am meisten blühte. Im Jahr 1795 zählte man dort bei einer Bevölkerung von 6000 Einwohnern 70 Kaufleute, die Buden betreuten. Die Häuser sind alle in Mauerwerk aufgeführt; in jedem Hofraum stehen Cocosbäume, deren Gipfel über die Gebäude emporragen. Die Ansicht des allgemeinen Wohlstands ist in Maracay noch auffallender als in Turmero. Der anil oder Indigo dieser Gegenden wurde jederzeit im Handel dem von Guatemala gleichkommend oder noch besser erachtet. Seit 1772 ist dieser Anbau dem des Cacao gefolgt; er war Vorläufer des Baumwoll- und Kaffee-Anbaus. Die Vorliebe der Kolonisten wandte sich der Reihe nach jedem dieser vier Erzeugnisse zu; aber der Cacao und der Kaffee sind die wichtigsten Objekte des Handels mit Europa geblieben. Zur günstigsten Zeit glich die Indigoerzeugung fast der Mexicos; in Venezuela stieg sie auf 40.000 arrobas oder 1.000.000 Pfund an, deren Wert über 1.250.000 Piaster betrug. Ich will hier nach amtlichen, bisher nie bekanntgemachten Angaben das zunehmende Wachstum dieses Zweiges der Landwirtschaft von Aragua mitteilen.
In dieser Tabelle ist der Schleichhandel nicht berücksichtigt, der, für den Indigo wenigstens, auf ein Viertel oder Fünftel der jährlichen Ausfuhr berechnet werden muß. Um sich von dem äußerst reichen Ertrag der Landwirtschaft der spanischen Kolonien einen Begriff zu machen, muß man daran denken, daß der Indigo von Caracas, dessen Wert im Jahr 1704 auf mehr als 6.000.000 Franken anstieg, der Ertrag von 4 oder 5 Quadratlieues ist. In den Jahren 1789 bis 1795 begaben sich jährlich 4000 bis 5000 freie Menschen in die Täler von Aragua, um bei Anbau und Erzeugnung des Indigo zu helfen. Sie arbeiteten zwei Monate lang im Tagelohn.
| Indigoausfuhr von La Guaira | |
| Durchschnittsertragder Jahre 1774 bis 1778 | 20.300 Pfd. |
| 1784 | 126.233 Pfd. |
| 1785 | 213.172 Pfd. |
| 1786 | 271.005 Pfd. |
| 1787 | 432.570 Pfd. |
| 1788 | 505.956 Pfd. |
| 1789 | 718.393 Pfd. |
| 1792 | 680.229 Pfd. |
| 1794 | 898.353 Pfd. |
| 1796 | 737.966 Pfd. |
Der Indigo erschöpft mehr als jede andere Pflanze das Land, auf dem er mehrere Jahre nacheinander angebaut wird. Man sieht den Boden von Maracay, von Tapatapa und von Turmero als erschöpft an, und der Ertrag der Pflanze hat sich auch ständig verringert. Die Seekriege ließen den Handel stocken, und die beträchtliche Indigo-Einfuhr aus Asien verringerte die Preise. Die Ostindische Gesellschaft verkauft gegenwärtig in London über 5.500.000 Pfund Indigo, während sie 1786 aus ihren weitläufigen Besitzungen nicht mehr als 250.000 Pfund bezog. In dem Maß, wie der Indigoanbau in den Tälern von Aragua abnahm, hat er sich in der Provinz Barinas und in den heißen Ebenen von Cucuta vermehrt, wo an den Ufern des Río Tachira jungfräulicher Boden eine reichliche Ernte der schönsten Färbung liefert.
Wir trafen sehr spät in Maracay ein. Die Personen, denen wir empfohlen waren, waren abwesend; kaum hatten die Einwohner unsere Verlegenheit wahrgenommen, als sie uns wetteifernd ihre Wohnungen, die zur Aufstellung unserer Instrumente erforderlichen Örtlichkeiten und die Unterbringung unserer Maultiere anboten. Es ist tausendmal gesagt worden, aber der Reisende fühlt sich stets neu bewegt, es zu wiederholen: Die spanischen Kolonien sind das Land der Gastfreundschaft; sie sind es selbst da noch, wo Gewerbefleiß und Handel unter den Kolonisten Wohlstand und einige Kultur verbreitet haben. Eine canarische Familie nahm uns mit der liebenswürdigsten Herzlichkeit auf; man rüstete uns eine treffliche Mahlzeit und vermied sorgfältig alles, was unsere Freiheit stören konnte. Der Hausherr [Don Alejandro Gonzales] war auf einer Handelsreise abwesend; seine junge Frau genoß seit kurzem Mutterfreuden. Sie drückte das lebhafteste Vergnügen aus, als sie vernahm, daß wir auf der Rückkehr vom Río Negro, an den Ufern des Orinoco, durch Angostura kämen, wo sich ihr Mann aufhielt. Durch uns sollte er die Kunde von der Geburt seines ersten Kindes erhalten. Wie im Altertum werden in diesen Ländern reisende Gäste als die sichersten Boten angesehen. Es gibt zwar Eilboten, aber diese Eilboten machen so weite Umwege, daß Privatleute ihnen nur selten Briefe für die Llanos oder Savannen des Landesinneren anvertrauen. Im Augenblick der Abreise wurde uns das Kind gebracht. Wir hatten es am Abend schlafend gesehen und sollten es nun des Morgens auch wachend sehen. Wir versprachen seine Gesichtszüge alle treulich dem Vater zu überbringen; allein der Anblick unserer Bücher und Instrumene erregte bei der jungen Frau Besorgnisse. Sie meinte, auf einer langen Reise und unter so viel anderweitigen Geschäften könnten wir leicht die Farbe der Augen ihres Kindes vergessen. Süße Bräuche der Gastfreundschaft! Naiver Ausdruck eines dem ersten Zeitalter der Zivilisation eigentümlichen Vertrauens!
Auf dem Wege von Maracay nach der Hacienda de Cura öffnet sich von Zeit zu Zeit die Aussicht auf den See von Valencia. Die Granitkette des Küstenlandes sendet südwärts einen Arm in das flache Land; er bildet das Vorgebirge von Portachuelo, wodurch das Tal fast geschlossen würde, wenn nicht ein schmaler Engpaß das Vorgebirge vom Felsen von Cabrera trennte. Es hat dieser Ort in den letzten Revolutionskriegen von Caracas eine traurige Berühmtheit erhalten: Alle Parteien haben sich um den Paß, der den Weg nach Valencia und nach den Llanos öffnet, lebhaft gestritten. Cabrera bildet gegenwärtig eine Halbinsel; noch sind keine 60 Jahre verflossen, seit es eine Felseninsel im See war, dessen Wasser zusehends abnimmt. Wir verweilten sieben Tage lang sehr angenehm in der Hacienda de Cura in einem kleinen, von Gebüschen umgebenen Gartenhaus, da im Wohnhaus der schönen Zuckerpflanzung die bubas, eine unter den Sklaven dieser Täler sehr häufig vorkommende Hautkrankheit, ausgebrochen war.
Wir lebten nach der Art der wohlhabenden Leute des Landes, indem wir innerhalb 24 Stunden zwei Bäder nahmen, uns dreimal zur Ruhe legten und drei Mahlzeiten genossen. Die Temperatur des Seewassers ist ziemlich hoch und steigt auf 24 bis 25° an; dagegen gibt es ein anderes, sehr kühles und erquickendes Bad im Schatten der Ceibas und dicker Zamangs bei Toma in einem aus den Granitbergen des Rincón del Diablo kommenden Strombett. Beim Einsteigen in dieses Bad hat man keine Insektenstiche, wohl aber die kleinen rötlichen Haare zu fürchten, womit die Schoten vom Dolichos pruriens besetzt sind, die, in der Luft zerstreut, vom Wind herbeigeführt werden. Wenn diese Haare, denen man sehr passend den Namen Picapica gegeben hat, sich auf der Haut festsetzen, erregen sie ein äußerst brennendes Jucken. Man fühlt sich gestochen, ohne zu wissen woher.
In der Nähe von Cura fanden wir alle Einwohner damit beschäftigt, den Boden urbar zu machen, der mit Mimosen, Sterculia und Coccoloba exoriata bewachsen war, um den Anbau der Baumwolle zu vergrößern. Dieser Kul turzweig, der zum Teil den des Indigo ersetzt, war seit einigen Jahren derart erfolgreich, daß die Baumwollstaude nun an den Ufern des Valencia-Sees wild wächst. Wir fanden acht bis zehn Fuß hohe, mit Bignonien und anderen holzigen Rankengewächsen durchschlungene Sträucher. Noch ist jedoch die Ausfuhr der Caracas-Baumwolle unbedeutend; sie betrug in La Guaira im Durchschnitt kaum 300.000 oder 400.000 Pfund im Jahr; aber in allen Häfen der Capitanía general stieg sie infolge der schönen Pflanzungen von Cariaco, Nueva Barcelona und Maracaibo über 22.000 Zentner an. Das ist fast der halbe Ertrag der ganzen Inselgruppe der Antillen. Die Baumwolle der Täler von Aragua ist von sehr schöner Art; nur die brasilianische übertrifft sie, und man zieht sie der von Cartagena, von der Insel Santo Domingo und von den Kleinen Antillen vor. Die Baumwollpflanzungen dehnen sich einerseits vom See Maracay nach Valencia, andererseits von Guayca nach Güigüe aus. Die großen Pflanzungen erbringen 60.000 bis 70.000 Pfund jährlich. Wenn man sich erinnert, daß in den Vereinigten Staaten, also außerhalb der Tropenländer, in einem mancherlei Wechsel unterworfenen und darum öfters dem Anbau ungünstigen Klima die Ausfuhr der einheimischen Baumwolle innerhalb 18 Jahren (von 1797 bis 1815) von 1.200.000 auf 83.000.000 Pfund angestiegen ist, mag man sich in der Tat kaum einen Begriff von der gewaltigen Ausdehnung machen, die dieser Handelszweig erhalten wird, wenn einst dem Gewerbefleiß der Nation in den vereinigten Provinzen von Venezuela, in Neu-Granada, in Mexico und an den Ufern des La Plata die Fesseln abgenommen sein werden. Im gegenwärtigen Zustand der Dinge sind es nach Brasilien die Küsten des holländischen Guayana, der Golf von Cariaco, die Täler von Aragua und die Provinzen von Maracaibo und Cartagena, die im südlichen Amerika die meiste Baumwolle erzeugen.
Während unseres Aufenthalts in Cura machten wir zahlreiche Ausflüge nach den in der Mitte des Sees von Valencia sich erhebenden Inseln, nach den warmen Quellen von Mariara und auf den hohen Granitberg, der El Cucurucho de Coco heißt. Ein schmaler und gefährlicher Fußpfad führt zum Hafen von Turiamo und zu den berühmten Cacaopflanzungen der Küste. Auf allen diesen Ausflügen sahen wir uns angenehm überrascht, nicht nur wegen der Fortschritte des Landbaus allein, sondern wegen des Wachstums einer freien, tätigen, an Arbeit gewöhnten Bevölkerung, die zu arm ist, um auf Sklavenhilfe zu rechnen. Überall hatten kleine Pächter, Weiße und Mulatten, vereinzelte Ansiedlungen gebildet. Unser Wirt, dessen Vater 40.000 Piaster Einkommen hat, besaß mehr Land, als er anbauen konnte; er verteilte es in den Tälern von Aragua an arme Haushaltungen, welche Baumwolle zu pflanzen wünschten. Er suchte in der Nachbarschaft dieser großen Pflanzungen die Ansiedlung freier Menschen zu befördern, welche ihm freiwillig und abwechselnd auf eigenem Land oder auf dem der benachbarten Pflanzer in der Erntezeit Tagelöhner sicherten. In großmütiger Beschäftigung mit den Maßnahmen zur allmählichen Abschaffung der Sklaverei der Neger in diesen Gegenden überließ sich der Graf Továr der doppelten Hoffnung, die Sklaven den Landeigentümern entbehrlicher zu machen und die Freigelassenen in den Stand zu setzen, Pächter zu werden. Bei seiner Abreise nach Europa hatte er einen Teil seiner Grundstücke in Cura, westlich am Fuß des Felsens von Las Viruelas gelegen, verteilt und verpachtet. Vier Jahre später, bei seiner Rückkehr nach Amerika, traf er an eben dieser Stelle schöne Baumwollpflanzungen und einen kleinen Weiler von 30 bis 40 Häusern an, der Punta Zamuro heißt und den wir öfters mit ihm besucht haben. Die Bewohner dieses Weilers sind fast alle Mulatten, Zambos und freie Neger. Dies Beispiel der Verpachtungen ist glücklicherweise von mehreren anderen großen Eigentümern nachgeahmt worden. Der Pachtzins beträgt 10 Piaster auf die fanega Land. Er wird bar oder in Baumwolle bezahlt. Weil die kleinen Pächter öfters in Verlegenheit geraten, geben sie ihre Baumwolle zu sehr mäßigen Preisen ab. Sie verkaufen solche wohl auch vor der Ernte, und diese von reichen Nachbarn gemachten Vorschüsse bringen den Gläubiger in eine Abhängigkeit, die ihn zwingt, öfter seine Dienste als Tagelöhner anzubieten. Der Tagelöhner erhält hier geringeren Lohn als in Frankreich. Ein Freier, der im Tagelohn (als peón) arbeitet, erhält in den Tälern von Aragua und in den Llanos vier bis fünf Piaster monatlich, die Nahrung ungerechnet, die beim Überfluß von Fleisch und Gemüsen überaus billig ist. Ich behandele diese Details der kolonialen Landwirtschaft gern, weil die Einwohner Europas den Beweis darin finden können, daß bei den aufgeklärten Bewohnern der Kolonien längst kein Zweifel mehr waltet, daß der Kontinent des spanischen Amerika in freier Arbeit Zucker, Baumwolle und Indigo erzeugen kann und daß die unglücklichen Sklaven sehr wohl Bauern, Pächter und Eigentümer werden können.