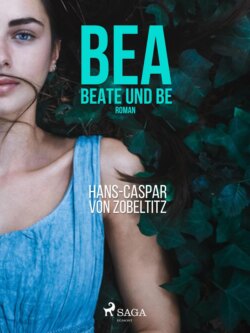Читать книгу Bea, beate und Be - Hans-Caspar von Zobeltitz - Страница 3
1
ОглавлениеIn der Sommeschlacht 1916 fiel der Generalleutnant Cornelius. Eine Maschinengewehrkugel traf ihn, als er in der vordersten Linie der Infanterie seiner Division eine Erkundung vornahm. Die Nachricht von seinem Tode verbreitete sich schnell über alle Haupt- und Stabsquartiere der Westfront und löste ein stolzes Bedauern aus. Generalleutnant Cornelius war in der Armee ein bekannter Mann gewesen, ein hervorragender Soldat, bei Vorgesetzten und Untergebenen gleich beliebt, nur vielleicht etwas zu weich zum eigentlichen Führer. Kameraden, die ihn persönlich näher kannten, schoben diese Weichheit auf seine häuslichen Verhältnisse. Er hatte ziemlich spät wohlhabend geheiratet und stand, wie man sich lächelnd erzählte, stark unter dem Pantoffel. Er hatte seine Frau stets über die Massen verwöhnt, und es liefen Anekdoten um, die ihn bei Einkäufen für den Haushalt und mit dem Staubwedel in der Hand schilderten. Diese Geschichten wurden auch jetzt mit leisen Stimmen wieder aufgefrischt, man entsann sich bei ihnen aber auch voll Beileids der Frau, die jetzt einsam und wohl recht hilflos, führerlos dastand. Man sandte ihr, auch aus dem Grossen Hauptquartier in Charleville, Telegramme, und ein Vertreter des Kaisers war bei der Beisetzung zugegen, die nach der Überführung in Berlin stattfand.
Dass sie in Berlin stattfand, war für alle Eingeweihten ein Zeichen dafür, dass die Witwe nun zu ihrer einzigen Tochter ziehen würde, die mit einem Arzt, dem Doktor Karl Bürgler, verheiratet war. Auch über diese Ehe wurde allerlei berichtet. Sie war eigentlich gegen den Willen der Mutter zustande gekommen, der ein Sanitätsoffizier nicht hoch genug in Rang und Ansehen für ihre Tochter erschienen war; hier sollte aber der General ein Machtwort gesprochen haben, vielleicht das einzige zwischen seiner grünen und silbernen Hochzeit. Doktor Bürgler, der zwei Jahre vor dem Kriege seinen Abschied aus dem aktiven Dienst genommen und sich als Facharzt für Lungenleiden in Berlin niedergelassen hatte, war bei der Beisetzung seines Schwiegervaters nicht anwesend. Man war darüber nicht verwundert, denn man wusste, dass er als Chefarzt eines Feldlazarettes an der Westfront in diesen Grosskampfzeiten unabkömmlich war.
Es waren trübe und ernste Tage, als Frau Beate Cornelius in das Bürglersche Haus in der Königsmarckstrasse in Berlin-Dahlem einzog. Der Krieg lastete nun doppelt schwer auf ihr. Sie fühlte sich nicht in der Lage, den eigenen Haushalt in Kassel, der letzten Garnisonstadt ihres Mannes, selbst aufzulösen, sie überliess dies ihrer Tochter, während sie sich im Fremdenzimmer der Villa einkapselte, sich hierher auch die Mahlzeiten erbat und nur ein menschliches Wesen um sich duldete, ihre dreijährige Enkelin Be. Als dies Kind im Spätherbst 1913 geboren worden war, hatte es nicht einen Augenblick für die Mutter einen Zweifel gegeben, dass es den Vornamen Beate bekommen musste, an dem seine Grossmutter so hing und den sie auch selbst trug.
Beate Bürgler fand in Kassel ungewohnte Arbeit vor. Die elterliche Wohnung war gross und vollgesteckt mit Möbeln. Sie wusste sich kaum Rat, wo sie mit den vielen Sachen bleiben sollte, besonders mit den Stücken, von denen sie annehmen musste, dass die Mutter besonders eng mit ihnen verbunden war und die sie jetzt in ihrer Trauer ständig vermissen würde. Schliesslich gab sie in dem Gefühl, dass es ihre Pflicht sei, der Mutter erst einmal wieder die gewohnte Umgebung zu schaffen, den Auftrag, das Arbeitszimmer des Vaters, das Wohnzimmer der Mutter und Teile der Einrichtung von Schlaf- und Ankleidezimmer nach Berlin zu verladen, während der Rest an Möbeln, Bildern, Teppichen, Geschirr und so weiter in Kassel eingespeichert wurde. In Dahlem aber liess sie im Erdgeschoss das Sprech-, das Ordinationszimmer und die daneben gelegene Bücherei ihres Mannes ausräumen und deren Inhalt auf den glücklicherweise grossen Boden des Hauses schaffen, so dass Platz für eine abgeschlossene Zimmerflucht wurde, die sie nun der trauernden Mutter zur Verfügung stellen konnte.
Bea Cornelius nahm von diesen Räumen fast unbewusst Besitz, und als sie in den ersten Monaten noch dieses oder jenes vermisste, fuhr Beate wiederum nach Kassel, um auf dem Speicher herauszusuchen, was der Mutter fehlte. Es ging der Tochter nicht anders, als es ihrem Vater gegangen war: sie beugte sich dem Willen und den Wünschen Beas, obgleich Wille wie Wünsche eigentlich nie geäussert wurden. Sie trat langsam die eigentliche Herrschaft in ihrem eigenen Hause ab und widersprach nie, wenn das Dienstmädchen oder das Kinderfräulein berichteten: Ihre Exzellenz hätten dieses oder jenes so oder so angeordnet. Ängstlich war sie auch um das leibliche Wohl der Mutter besorgt, sie suchte und fand Schleichwege, auf denen sie in dieser Zeit schweren Mangels an Nahrungsmitteln Fleisch, Butter, Kaffee und anderes heranholte. Es war ja Geld genug vorhanden, um auch Überpreise zu bezahlen: die Zinsen aus Beas erheblichen Vermögenswerten und aus dem, was Beate als Heiratsgut mitbekommen hatte, liefen pünktlich auf den Bankkonten ein, die Post brachte zu jedem Monatsersten die stattliche Pension, die Bea als Generalswitwe erhielt, und die Summe, die Karl Bürgler seiner Frau von seiner Feldbesoldung anweisen liess. Ja, trotzdem Beate nicht sparte, sammelten sich auf der Bank Überschüsse an, die sie in Kriegsanleihe anlegte, denn Bea überliess ihr die Vermögensverwaltung. „Du wirst das schon richtig machen, Kind, und die Herren auf der Bank sind ja zuverlässig. Ich verstehe von diesen Dingen nichts. Das hat immer dein guter Vater für mich erledigt.“
Alle diese Dinge erforderten aber Zeit; allein die Wege, die zurückzulegen waren, kosteten Stunden, denn die Verkehrsmittel waren im Kriegsnotstand eingeschränkt und die Droschken verschwunden. So kam Beate, die vor dem Einzug Beas still als Kriegsfrau vor sich hingelebt hatte, in eine Hetze des täglichen Lebens hinein, die sich noch dadurch verstärkte, dass sie die Pflichten, die sie in einer Leichtverwundetenküche und in einer Büchersammelstelle übernommen hatte, nicht aufgeben wollte. Sie bemerkte gar nicht, dass dabei eines an Mutterfürsorge und Mutterliebe zu kurz kam: Be, ihr Kind.
Und sie beging — jung und eigentlich noch recht töricht, wie sie war — einen grossen Fehler: aus einer gewissen Scheu schrieb sie ihrem Manne nicht, welche Veränderungen sie im Hause hatte vornehmen lassen. Sie schob diesen Brief von einer Woche auf die andere, von einem Monat auf den anderen, sie sagte: weshalb soll ich ihn bei seiner schweren Arbeit draussen aufregen, ich teile es ihm mit, wenn er mir einen Urlaub ankündet, dann erfährt er es noch früh genug; es ist ja auch alles nur vorübergehend, er braucht die Räume jetzt nicht; und wenn der Krieg vorbei ist, muss sich Bea doch ein eigenes Heim suchen.
Ein trübes Kriegschristfest ging vorüber. Das Frühjahr 1917 kam und mit ihm Beates Geburtstag, ihr fünfundzwanzigster. Und am frühen Morgen dieses Tages war Karl plötzlich da, stand vor Beate, nahm sie in den Arm, küsste sie. „Ich hab’ mich freimachen können, Lieb, auf eine knappe Woche, zu deinem Geburtstag, zu deinem fünfundzwanzigsten Geburtstag.“ Draussen strahlte der Mai, und der Mann, ganz von Urlaubsstimmung ergriffen, war gleich die Treppe herauf in Beates Schlafzimmer gestürzt, sass nun auf ihrem Bettrand, fuhr ihr durchs wirre dunkle Haar, lachte. „Liebhaben will ich dich, liebhaben, du.“ Dann sprang er auf. „Wo ist Be? wo ist mein Mädel?“ Ins Kinderzimmer lief er, jauchzte und schrie, und das Kind jauchzte und schrie auch. Beate aber hockte erschreckt und bewegungslos in ihren Kissen. Denkt er denn gar nicht daran, dass wir Trauer im Hause haben? Und dann überfiel es sie heiss: Seine Zimmer, um Gotteswillen, seine Zimmer. Sie sprang auf, warf sich ihren Schlafrock über, hastete ihm nach. „Sei doch nicht so laut, Karl, Bea schläft doch noch.“ Er hatte das Kind spielerisch hochgehoben, nun setzte er es nieder. Ein Schatten fiel auf sein frohes Gesicht. „Ach so — richtig — Mama.“ — Aus den Tagen, die ihm die Heimat schenken sollten, die er sich von Liebe und Entspannung erfüllt ausgemalt hatte, wurden trübe Stunden, voll ewigen Rücksichtnehmen-Müssens. Er sagte kein Wort, dass man ihn aus seinem eigensten Reich verdrängt, aber er bat: „Lass uns irgendwohin fahren, Beate, für die paar jämmerlich kurzen Tage, die uns geschenkt sind, und wenn es nur nach Potsdam ist.“ Aber sie meinte: „Ich kann doch Bea nicht allein lassen.“ Er wurde ernst: „Denk doch daran, dass ich wieder hinausgehe, es kann doch das letztemal sein ...“ Sie weinte auf. „Sag so etwas nicht, ich flehe dich an, sag so etwas nicht“, um dann doch zu enden: „Ich kann nicht fort. Du musst das verstehen. Beas Trauer ist noch zu frisch, sie würde nicht begreifen, dass wir froh sein können.“
Karl Bürgler nahm keinen Urlaub mehr. Ihm war dies Heim verleidet. Die eine verfehlte Urlaubswoche hatte seine Ehe zerbrochen.
Und als er dann aus dem Felde kam und forderte: „Mama muss ’raus, ich brauche meine Räume wieder, ich muss mir eine Praxis neu aufbauen“, hiess es: „Warte doch noch, bis die Zeiten etwas ruhiger geworden sind.“
Im Frühjahr 1919 bot sich ihm die Gelegenheit, ein Sanatorium im Schwarzwald zu übernehmen. Es war Heimatlazarett gewesen und wurde nun geräumt. Sein Ruf war vor dem Kriege gross gewesen, aber er musste neu erobert werden. Der Preis war nicht hoch, das Kapital zur Neuausstattung lag auf der Bank bereit. Die Aufgabe reizte, sie versprach Arbeit und Erfolg. Und die leidige Frage des Dahlemer Hauses musste sich so von selbst lösen: die Schwiegermutter blieb wohnen, sie zogen zu dritt, er, Beate und Be, nach Hochfried. Als er von der Besichtigung zurückkehrte, war er beglückt von seinem Plan. Hochfried lag herrlich, ganz einsam, zwei Stunden über Baden-Baden, mitten im dunklen, hochstämmigen Tannenwald, hatte aber doch volle Südsonne. Er sah wieder froh und fest in die Zukunft. Aber alles wurde ihm verschüttet. Beate war für nichts zugänglich. „Was denkst du? Bea jetzt hier allein lassen? in ihrem Alter? bei den unsicheren Verhältnissen?“ Er fuhr auf: „Du redest baren Unsinn. Mama ist achtundvierzig, das ist kein Alter. Aber ihr seid hier alle vom Exzellenzwahnsinn befallen. Ihre Exzellenz hier — Ihre Exzellenz da. Ich kann es schon nicht mehr hören. Ihr macht sie künstlich zur Mumie. Es ist zum Blödsinnigwerden. Mama bleibt hier, und du kommst mit, und damit Schluss.“ Doch so leicht liess sich Beate nicht unterkriegen. „Und das Kind? Nächste Ostern ist Be sechs Jahre. Wo soll sie dort zur Schule gehen? mit Bauernkindern ins nächste Dorf vielleicht?“ — „Wir nehmen eine Erzieherin ins Haus. Das ist doch keine Schwierigkeit.“ — „Und die harten Winter dort oben? Glaubst du, dass die Be guttun werden?“ — „Es kommen doch Kranke zur Heilung hin.“ — „Und zwischen diese Kranken soll ich mein Kind stecken, mitten in deinen Bazillenkasten!“ Da gab er es auf. Er verliess das Haus und leitete, obgleich sein Anwalt ihm abriet, die Scheidung ein.
Es gab einen jahrelangen Kampf, einen Kampf um Be. Sowohl Vater wie Mutter forderten das Kind für sich. Schliesslich einigten sich die Parteien, ohne dass die Scheidung ausgesprochen wurde. Be blieb bei Beate, vier Wochen im Sommer jeden Jahres hatte Karl Anspruch auf die Tochter. Er verpflichtete sich ausserdem zu einer Erziehungsbeihilfe und zur Zahlung der Prämien einer Aussteuer-Versicherung in beträchtlicher Höhe. Alles, wie es der Anwalt vorschlug.
In diese Zeit des Kampfes um Be fiel ein Liebeserleben Beates. Sie war immer eine hübsche Frau gewesen, in ihrer Rundlichkeit und ihren frischen Farben eigentlich mehr ein Wiener als ein Berliner Typ; sie war auch nicht ohne Temperament, nur dass ihre Neigung zu Gefühlsausbrüchen in ihrer Jugend durch die Mutter, der gute Formen über alles gingen, und durch die militärische Erziehungsart des Vaters gebremst worden war. Ehe sich aber in ihrer Ehe ein Eigenwille herausbilden konnte, war der Krieg da und schob durch seine grossen Ereignisse jedes eigene Ich in den Hintergrund. Als dann Bea ins Haus kam, wurde der letzte Gedanke in Beate, dass auch sie Anrecht auf Glück hätte, zurückgedrängt. Es war eine Zufallsbekanntschaft, die sie aufrüttelte, ein Mann slawischer Art, heftig, mit der Neigung, sich selbst sehr wichtig zu nehmen, seine Begabungen auf kaufmännischen und künstlerischen Gebieten — er spielte leidlich Klavier — stark zu betonen; ein ständig fordernder Mensch. Ihm musste Beate erliegen. Sie empfand keine Seligkeiten in dieser Zeit, im Gegenteil, sie litt; sie fühlte sich immer gehetzt, weil sie die Stunden für ihr Eigenleben in ihren Pflichtenkreis um Bea und Be, den sie nicht zu vernachlässigen wagte, einschalten musste. Immer quälte sie ein schlechtes Gewissen, aber sie gehorchte trotzdem diesem Mann. Als er schliesslich davon sprach, dass sie seine Frau werden solle, ging sie zu ihrem Anwalt und erklärte, dass sie nunmehr bereit sei, in die Scheidung zu willigen. „Gewiss“, sagte der Anwalt, „aber Sie werden dann auf Ihr Kind verzichten müssen.“ Diese Auskunft genügte, um Beate in masslose Furcht zu stürzen. Sie brach sofort alle Beziehungen zu jenem Mann ab, es bereitete ihr Schmerz, aber dieser Schmerz tat ihr wohl, denn sie fühlte sich als Märtyrerin und behauptete von sich selbst, dass diese verhetzte Zeit, die nun hinter ihr lag, die glücklichste ihres Lebens gewesen sei.
Eines hatte sie während dieses Abschnittes, der fast drei Jahre ihres Daseins füllte, versäumt: sie hatte sich nicht um ihr eigenes und das Vermögen ihrer Mutter sorglich gekümmert. Sie hatte diesen und jenen Rat ihres Freundes halb verstanden aufgenommen, hatte ohne Überlegung spekuliert, Papiere verkauft und gekauft, die üblichen Inflationsgewinne sofort verbraucht, da der Bedarf an baren Mitteln im Dahlemer Hause stets gross war, und musste, als die Festmark alle Scheinwerte verblassen liess, erschreckt feststellen, dass die beiden grossen Vermögen kläglich zusammengeschmolzen waren, ohne sich jedoch schon jetzt über die ganze Tragweite dieser Verluste klar zu sein.
Von dem, was Beate durchwachte, sowohl an Glück wie an Unglück, merkte Bea nichts, da Beate im Gefühl, die Mutter ja nicht ängstigen zu dürfen, weder wagte zu klagen noch zu jubeln. Eine Erkrankung Beas verstärkte noch diese sorgende Angst in ihr: nur keine Aufregung, Mutter könnte einen Rückfall haben.
Dabei ging es Bea eigentlich sehr gut. Sie hatte sich im Hause Bürgler eine Tageseinteilung geschaffen, nach der, ohne dass sie es je gefordert hätte, Beate die Maschinerie des Haushalts minutiös und ängstlich ablaufen liess. Niemand durfte sich verspäten, nur Bea selbst durfte es, sie, die nie etwas zu tun hatte. Sie führte ein Leben, das durch Mahlzeiten, Spaziergänge, Lektüre und eine kleine Geselligkeit, Pflege ihres Körpers und Besorgungsgänge für ihre Toilette voll erfüllt war.
Zwischen diesen beiden Frauen wuchs Be heran, ständig von der Mutter zu Ruhe und Artigkeit ermahnt, immer darauf hingewiesen, dass die Grossmutter eine alte Dame sei, nach deren Wünschen man sich zu richten hätte. Freundschaften, die Be in der Schule schloss, kamen nicht zur Auswirkung, weil sie fremde Kinder nicht ins Haus, nicht einmal in den Garten mitbringen durfte, da es die Grossmutter stören könnte; ebenso waren Besuche bei den Eltern der Freundinnen unerwünscht. „Die Gefahr, dass du uns Krankheiten aus der Schule einschleppst, ist schon gross genug“, sagte Beate.
Das Kind hatte es nicht leicht. Das Wunder war, dass es, obgleich ihm von Beate dauernd Rücksichtnahme auf Bea gepredigt wurde, diese Grossmutter liebte, denn wenn es in ihren Räumen war, durfte es sich viel freier bewegen als vor ihren Türen. Be war immer wieder erstaunt, dass Bea gar nicht schalt, wenn sie im Spieleifer bei ihr einmal lauter wurde. Dass Grossmutter nicht zusammenschreckte, wenn ein Gegenstand mit Gepolter zu Boden fiel. Das Schönste war aber, dass sie erlaubte, dass Be bei ihr „Verkleiden“ spielte. Bea hatte in einem Schrank ein Schubfach, das voll bunter Tücher und farbiger Bänder steckte. Schon mit fünf Jahren begann Be sich aus diesen Schätzen phantastische Gewänder zusammenzustellen, die Seiden geschickt zu falten und zu stecken, sich Schleifen ins Haar zu flechten oder die Grossmutter selbst festlich und dabei merkwürdig zu schmücken. „Verkleiden“ war Bes liebstes Spiel und blieb es bis in die Jahre hinein, wo die Puppen schon längst ausgeschaltet waren. Mit Kostümbildern konnte sie stundenlang allein gelassen werden, und als Bea sie mit elf Jahren das erstemal zu einem Einkauf mitnahm, gestand sie nachher Beate: „Ich habe mir doch wirklich den Hut gekauft, den Be für mich ausgesucht hat. Das Mädel hat bereits einen fertigen, ausgesprochenen Geschmack.“
Die liebste Zeit im Jahr waren Be aber doch die Ferientage in Hochfried. Beate gab ihr stets eine Erzieherin mit auf den Weg, jedoch der Vater wusste diese steifen Damen sehr bald abzuschütteln; er betraute mit der körperlichen Pflege seines Kindes eine Sanatoriumsschwester, liess ihm im übrigen völlige Freiheit. — Hochfried war von einem grossen Waldpark umgeben, den eine hohe Mauer rings einhegte; es konnte Be also nichts zustossen. Der Park war kreuz und quer von Fusswegen durchzogen, ein herrlicher Irrgarten für ein Kinderhirn, er barg Turnwiesen und Tennisplätze und schien Be unermesslich. Sie durfte in ihm tollen, jagen, schreien, jauchzen. Alle Abgeschlossenheit des Hauses der Mutter löste hier Freiheit ab, niemand verbot ihr, mit den Sanatoriumsgästen Freundschaften zu schliessen und mit ihnen zu sprechen, wie sie wollte. In Hochfried wurde Be natürlich, aller Zwang fiel von ihr, und es gab keinen Patienten, der das Kind nicht liebte. Karl, der gefeierte Doktor Karl Bürgler, wurde stolz auf sein kleines Mädel, denn er sah selbst, dass von Jahr zu Jahr gesteigert hervortrat, was seine Gäste ihm schmeichelnd versicherten: Be war schön. Nicht landläufig schön, nein, dazu war das Gesicht im Stil zu gemischt aufgebaut, die Kopfform schmal, gotisch-gestreckt, Nase und Kinn aber stupsig-barock; zu dem dunklen Haar, das feingesponnen und etwas eigenwillig lockig war wie das der Mutter, wollten die hellen blauen Augen, Erbteil Beas, eigentlich nicht recht passen. Aber dieser Gegensatz von dunkel und licht war wieder reizvoll.
Etwas zeigte Be in Hochfried, was im Hause der Mutter nie zum Ausdruck kommen konnte: Ansätze zu einem eigenen Willen, manchmal auch zu Starrkopf und Bock. Hatte Be hier einen Wunsch, so steuerte sie ihn zielsicher an. Karl musste manchmal lächeln, weil das Kind immer wieder auf andere Weise zu erreichen suchte, was er ihm abgeschlagen; oft vergingen Tage, bis die Bitte in einer neuen Form wieder auftauchte, aber sie tauchte wieder auf und wurde schliesslich gewährt. Vergessen wurde ein ernster Vorsatz nie. Verständlich war, dass Karl Be in diesen Ferientagen verwöhnte; er war aber Pädagoge und Menschenkenner genug, um Be nicht durch übergrosses Wunschgewähren zu schädigen. Wenn er einmal mehr nachgab, als er vielleicht verantworten konnte, so geschah es im Bestreben, die Liebe Bes für sich so zu stärken, dass sie für ein ganzes Jahr in ihrer Seele haften blieb. War Be abgereist, schien ihm Hochfried leer. Er spielte dann mit dem Gedanken, seinen Anwalt zu neuen Schritten zu veranlassen, um Be ganz für sich zu gewinnen, verwarf solche Pläne jedoch wieder, weil er fürchtete, dass das Kind durch Beate gegen ihn verstimmt werden könne, wenn diese erfuhr, dass er Be von neuem für sich begehre.
Kehrte Be nach solchen Ferientagen in die Königsmarckstrasse zurück, litt sie zwar einige Tage unter der Engnis, überwand die Trennung von Vater und Freiheit aber schnell, weil das Alte im Dahlemer Haus doch wieder neu war, weil die Schule sofort Anforderungen stellte und Beas Schalkasten lockte. Kinder sind ja von einer glückvollen Anpassungsfähigkeit und haben die wunderbare Gabe in sich, auch aus Schlechtem stets das Gute herauszulösen.
Die Jähre liefen allen davon. Im Arbeitstrott für Karl, ungenutzt von Bea und Beate. Be allein erfasste sie ungewollt und füllte sie mit Erraffen von Wissen. Sie war eine gute Schülerin, sie legte die Quarta, die Tertien und Sekunden hinter sich und trat mit siebzehn Jahren in die Unterprima ein, jetzt schon ein denkender Mensch.
Beate sah dieses Wachsen mit Sorge. Nicht um Bes inneres Leben und ihre Entwicklung bangte sie sich, denn sie fühlte, dass ihre Tochter, die ihr an Grösse jetzt gleichkam, keinen Fehl in sich hatte, aber die Angst vor der Zukunft packte sie. Sie wusste: sie lebte von der Masse. Längst hatte sie den Rest ihres Vermögens mit dem Rest des Vermögens der Mutter zusammengeworfen, aber seit dem Ende der Inflation hatten die Zinsen nie mehr gereicht, um die laufenden Unkosten des Haushalts zu decken. Die Grundsteuern des Hauses frassen diese Einkünfte aus dem Kapital fast allein auf. Die Versuche, sie durch Spekulationen zu erhöhen, hatte Beate nach einigen Fehlschlägen aufgegeben. So verkaufte sie ein Papier nach dem anderen. Als sie wieder einmal eine Aktie zum Verkauf aufgab, riet ihr der Beamte der Bank ab, weil der Kurs der Papiere weit unter Wert stand. „Was soll ich denn machen“, fragte sie verzweifelt, „ich brauche doch bares Geld.“ Der Beamte, der sie seit Jahren kannte, sagte: „Sie müssen sich einschränken, gnädige Frau. Stossen Sie das Haus ab, damit Sie die Steuerlast loswerden, oder vermieten Sie wenigstens ein paar Räume, damit Sie einen Zuschuss bekommen. Wenn Sie so weiter-wirtschaften, sind wir in ein paar Jahren am Ende.“ Auf dem Weg von der Bank zur Königsmarckstrasse fasste Beate die stärksten Entschlüsse, aber als sie dann vor Bea stand, die harmlos und nichtsahnend durch ihre Räume wanderte und sofort ein Gespräch über irgend etwas, was sie sich unbedingt kaufen müsse, begann, wagte sie nichts mehr zu sagen. Ich kann doch Bea nicht in eine Etagenwohnung sperren, sie braucht den Garten, sie braucht ihre Zimmer, ihre gewohnten Spaziergänge. Sie lag nachts schlaflos, sie sah den Zusammenbruch vor sich, aber sie änderte nichts. Die Zeiten müssen sich ja wandeln, die Zinsen werden wieder steigen, die Lasten fallen, log sie sich vor. Nur wenn sie an Bes Zukunft dachte, wurde ihr angst. Wenn es nur reicht, bis das Mädel die Universität hinter sich hat und sich sein Leben selbst weiterbauen kann. Es gab für sie keinen Zweifel, dass Be Medizin studieren müsse, Arzt werden, wie der Vater. Dieser Gedanke beruhigte sie, ja er erfüllte sie mit einem gewissen Stolz: Meine Generation Frauen hat diesen Mädeln die Freiheit des Studiums und der Berufe erkämpft, wie dankbar müssen sie uns sein.
Als die Primanerin Be nach Hochfried kam, nun allein, ohne Erzieherin, selbständig bei ihrer Schlafwagenfahrt von Berlin nach Baden-Baden und sicher in jeder Anweisung, die sie dem Chauffeur des Sanatoriums gab, der sie vom Bahnhof abholte, war der Vater, der sie ein volles Jahr nicht gesehen, fast erschrocken. Eine junge Dame, die ebensogut eine Patientin hätte sein können, stand vor ihm. Doch Be fiel ihm so kindlich-froh um den Hals, dass er sich gleich wieder als Vater fühlte. Be lief wie immer durch Park und Haus, war selig im Entdecken von Erinnerungen, war lieb gegen die Schwestern, bestellte sich in der Küche ihr Leibgericht und kroch auf den Boden, um ihre Schwarzwaldtracht vom Vorjahr zu suchen. Lachend kam sie zurück. „Sie passt nicht mehr, Vater, nirgends.“ Auf die Hüften schlug sie sich dabei und auf die Brust. „Ich muss aber eine neue haben, ohne meinen bunten Rock fühl’ ich mich hier nicht wohl.“ Da war gleich wieder ihr zielsicheres Wünschen. Er hörte beruhigt heraus: sie ist noch die alte, sie ist noch das Kind.
Hochfried war in diesem Sommer voll besetzt. Doktor Karl Bürgler hatte alle Hände voll zu tun; es entging ihm daher, dass Be sich besonders an Doktor Franz Schellberg, seinen Anwalt, anschloss, mit dem er nicht nur geschäftlich verbunden war, sondern dem er sich im Laufe der Zeit auch freundschaftlich genähert hatte. Schellberg, der Mitte der Dreissig stand und seit Jahren verheiratet war, kannte Be bereits, denn er hatte auch in den Vorjahren auf Hochfried seine Kuren genommen. Er war ein äusserst gescheiter Mensch, fernab jeder juristischen Trockenheit, belesen, kunstverständig. Was er im Schwarzwald suchte, war Erholung nach fast übergrosser Arbeit, nicht etwa Heilung eines Leidens. Die Freundschaft zwischen ihm und Be wurde schon am ersten Tage nach Bes Ankunft geschlossen: sie trafen sich unverabredet sehr früh am Morgen am Tor des Parkes, beide zu einem grösseren Ausflug gerüstet. Sie hatten das gleiche Ziel, gingen daher zusammen, und es ergab sich, dass ihre Schritte einen Rhythmus hatten. So fanden sie Gefallen aneinander, und gemeinsames Wandern wurde die Regel. Im Schreiten schwiegen sie meist, aber wenn sie rasteten, kam es zu lebhaften Gesprächen, und hier wurde es ein Erleben für Be, dass sie zum erstenmal mit einem erwachsenen Mann allein Rede und Gegenrede tauschen konnte. Sie war verwundert, dass Schellberg ihre Ansichten nicht einfach kurz abtat, wie sie es von Beate und deren Kreis, von den Lehrern und den Eltern ihrer Schulgenossinnen gewohnt war, sondern dass er sich darauf einliess, mit ihr Wortgefechte zu führen, ja sich mit ihr zu streiten. Viel sprachen sie über Politik, die in der Schule heftig umkämpft war, im Hause Bürgler von Mutter und Grossmutter aber kaum berührt wurde, besonders nicht in Bes Gegenwart. Be hatte also ihr Wissen auf diesem Gebiet in der Hauptsache aus der sehr engen und einseitigen Zeitung bezogen, die man in Dahlem las, und diese Kenntnisse nur durch die Hetzereien erweitert, mit denen die Mitschülerinnen sich befehdeten. Nun eröffnete ihr Schellberg eine Welt der grossen Gesichtspunkte, dämpfte das Leidenschaftlich-Extreme in ihr. Zuerst wehrte sie sich, versuchte ihren Standpunkt mit Schulschlagworten zu verteidigen, aber bald fühlte sie, dass sie auf lockerem Sande sass und nichts von dem vor Schellberg Halt hatte, was sie vorzubringen in der Lage war. So kam es, dass sie, durstend wie ein Tier in der Wüste, seine Reden in sich saugte und schliesslich in jugendlicher Wandlungsfähigkeit von seinen ruhigen und massvollen Anschauungen begeistert war. Er gab in allem den wirtschaftlichen Fragen, die Be bisher völlig fremd gewesen, den Vorrang und riet ihr dringend, sich mit diesen zu befassen. „Kein Mensch in Deutschland kann heute zu früh damit anfangen, denn sie werden die Zukunft beherrschen.“ Nun lag auch der Satz nahe: „Was wollen Sie eigentlich werden, Be?“ Ihre Antwort war gleich da, denn es gab auch für sie keinen Zweifel: „Arzt wie Vater.“ — „So“, sagte er nur und wechselte dann aber den Gesprächsstoff, ehe Be, die eine Ablehnung aus diesem einen Wort wohl herausgehört hatte, weiter in ihn dringen konnte.
Erst in Berlin merkte Be, dass Schellberg ihr Gleichgewicht gestört hatte. Sie überwarf sich mit ihren Freundinnen, die sich fest an Flugblattleitsätze gebunden fühlten, ihre gewandelten Ansichten rückständig, sie selbst eine Abtrünnige, eine Verräterin nannten; sie scheuchte Beate von sich, als sie versuchte, mit ihr über wirtschaftliche Dinge zu reden und die Frage stellte: „Wovon leben wir eigentlich?“; sie fand bei Bea keinen Widerhall, die einfach sagte: „Warum quälst du mich mit solchen Sachen, Kind, überlass das doch den Männern.“
Sie vermisste Schellberg. Er hatte ihr gesagt, dass er sich freuen würde, sie in Berlin einmal wiederzusehen. So machte sie Besuch im Schellbergschen Hause, traf nur seine Frau, die ihr herzlich unbedeutend schien, so unbedeutend, dass sie nicht verstand, dass er sie geheiratet hatte. Diese Ehe kann diesem Mann ja nichts geben, war ihr schnelles, jugendliches Urteil. Er tat ihr leid, und durch dies Gefühl wurde sie tiefer in eine Schwärmerei für ihn hineinaetrieben. Sie ging in die Strasse, in der sein Anwaltsbüro lag, hegte die Hoffnung, ihn hier zufällig zu treffen, wartete vergeblich, ging wieder fort und stand doch zwei Tage später von neuem vor dem Hause. Aber es dauerte fast vierzehn Tage, ehe sie den Mut aufbrachte, das Büro selbst zu betreten. Da der Name Bürgler dem Bürovorsteher bekannt war, wurde sie vorgelassen, fand einen ganz anderen Mann als den, den sie von Hochfried her im Gedächtnis hatte. Er lächelte, als sie auf seine Frage, was sie zu ihm führe, antwortete: sie hätte nur einen guten Tag sagen wollen, und sie bemerkte dieses Lächeln. Es tat ihr weh. Sie verstand wohl seine Eile: das Telephon schnarrte, die Sekretärin kam, das Wartezimmer war voller Menschen. Aber dass er so lächeln konnte! Sie klagte bitter: mir ist etwas Grosses zerstört. —