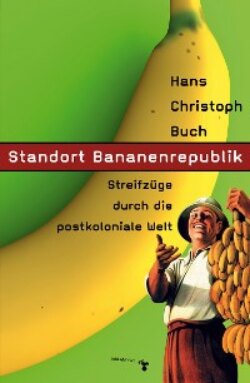Читать книгу Standort Bananenrepublik - Hans Christoph Buch - Страница 7
Land ohne Schatten
ОглавлениеNachrichten aus Darfur
N’djamena, Mai 2004
Dies ist die heißeste Jahreszeit in Tschad, 29 Grad Celsius um vier Uhr früh bei der Landung am Flughafen, und tagsüber klettert das Thermometer auf über 50 Grad. »Das Wetter wird oben entschieden, genau wie die Politik«, sagt Omar, der Nachtwächter des »Novotel«, »und uns bleibt nichts übrig, als die Knie zu beugen – il faut se plier!«–»Die Flüchtlinge aus Darfur sind eine Plage für unser Land«, fügt er ungefragt hinzu, während er mit dem Käscher herabgefallene Blätter aus dem Schwimmbecken fischt. »Der Osten des Tschad ist staubtrocken und bitterarm, und die Menschen dort haben selbst nicht genug zu essen. Die Vertriebenen sind unsere Vettern, aber sie kommen bewaffnet über die Grenze mit Frauen, Kindern und Tierherden, die alles kahlfressen, und vermutlich gehen sie nie wieder weg. Inschallah!«
Hinter dem Hotel fließt der Chari-Fluß vorbei, der in der Trockenzeit nur noch wenig Wasser führt. Schwimmende Inseln, unter denen sich Flußpferde verbergen, die nachts an Land waten, um in Ufernähe gelegene Felder abzugrasen. Früh am Morgen herrscht reger Fährbetrieb: Pirogen aus ausgehöhlten Baumstämmen transportieren Passagiere über den Fluß und kehren, mit Fahrrädern und Gießkannen beladen, wieder zurück. Auf der anderen Seite des Chari liegt Kamerun, und Schmuggler nutzen das Preisgefälle aus – ein kleiner Grenzverkehr, der von den Behörden geduldet wird.
Das in der Sahelzone gelegene Tschad gehört zu den ärmsten Ländern Afrikas, und die Hauptstadt N’djamena, früher Fort Lamy, sieht aus wie ein Wüstencamp. Glühendheißer Wind treibt Staub durch die Straßen, und Lastwagen, Land Rover und Jeeps fahren zwischen Ministerien, Botschaften und Büros von Hilfsorganisationen hin und her. Die Mauern sind mit bunten Bildern bemalt zur Warnung vor Landminen, Cholera und Aids; auf Schautafeln ruft die Regierung zu regelmäßigem Händewaschen und zur Benutzung von Kondomen auf. Schwer zu glauben, daß diese von Wellblechhütten umbrandete Stadt einst ein Zentrum afrikanischer Großreiche war. Im historischen Museum wird der Unterkiefer des homo tschadensis gezeigt, Lucys älterer Bruder, der vor 3,5 Millionen Jahren gelebt haben soll.
»Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht«, sagt der hochrangige Vertreter einer westlichen Supermacht, dessen Namen ich nicht nennen darf – das gehört zu den Spielregeln, auf die wir uns vor dem Gespräch geeinigt haben. Im Vorzimmer seines Büros laufen rund um die Uhr Nachrichten von CNN, so als sei die Botschaft mit dem Sender verkabelt, und an der Wand hängt ein Evakuierungsplan mit der Aufforderung, im Fall eines Angriffs Geheimdokumente zu vernichten und alle Türen offen zu lassen, damit kein Botschaftsangehöriger im Innern des Gebäudes eingeschlossen wird. Daneben ein Poster mit Gebrauchsanweisungen zum Nachladen einer »Beretta«, wie sie Geheimagent 007, alias James Bond, zum Töten benutzt. Trotz der Sicherheitsmaßnahmen wirkt die Atmosphäre zivil und entspannt.
»Die gute Nachricht ist, daß Darfur kein zweites Ruanda ist. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich war lange in Kigali stationiert.« Er zeigt auf eine großflächige Landkarte, die neben Farbfotos des Außenministers und des amtierenden Präsidenten über seinem Schreibtisch hängt. »Die schlechte Nachricht ist, daß es sich um den schlimmsten Konflikt im heutigen Afrika handelt. Ethnische Vertreibung – kein Völkermord, aber nahe daran!«
Der Diplomat zwingt sein zuckendes Knie zur Ruhe und erläutert anhand der Landkarte, daß der in der Sahelzone liegende Osten des Tschad ein ökologisches Krisengebiet und zugleich Schauplatz einer humanitären Katastrophe ist. Das fragile Gleichgewicht sei schon jetzt zerstört durch zu viele Menschen, zu wenig Wasser und zu viel Vieh – und mit ihm der innere Frieden des Vielvölkerstaats Tschad. »Arabischstämmige Milizen morden, plündern, stehlen und vergewaltigen in Komplizenschaft mit der sudanesischen Armee, die ihnen Waffenhilfe leistet, während die Regierung in Khartum die Augen verschließt und angeblich von nichts weiß. In der Provinz Darfur leben zwei Millionen Menschen, von denen 800 000 aus ihren Dörfern vertrieben worden sind und seit Monaten schutzlos umherirren. 110 000 Flüchtlinge haben die tschadische Grenze überschritten, und mindestens 10 000 Männer und Frauen, Kinder und Greise wurden von Janjaweeds – so heißen die Nachfahren der arabischen Sklavenjäger – massakriert oder verschleppt. Die Zahlen sprechen für sich!«
Zum Abschied überreicht man mir einen Computerausdruck: Die Rede des amerikanischen Delegationsleiters Richard S. Williamson bei der Genfer Sitzung der UN-Menschenrechtskommission, die sich nur zu einer verhaltenen Verurteilung Sudans durchringen konnte. Ohne Namen zu nennen, geißelt Williamson die Halbherzigkeit der Europäer und vergleicht die ethnische Vertreibung in Darfur mit den Killing Fields in Kambodscha und dem Völkermord in Ruanda.
Der sudanesische Botschafter ist nicht einverstanden mit dieser Sicht. Hassan Bechir Abdulwahab – sein Name unterliegt nicht der Geheimhaltung – trägt ein weißes Gewand mit Turban und empfängt mich mit orientalischer Höflichkeit. Er war vor Öffnung des Eisernen Vorhangs in Prag stationiert und fuhr von dort nach Weiden in die Oberpfalz zum Einkaufen. Bechir liebt Deutschland und ging als zahlungskräftiger Kunde bei Mercedes in Sindelfingen aus und ein. »Europa versteht uns besser als Amerika«, sagt der Diplomat und schiebt mir eine Silberschale mit Datteln zu. »Ihr trinkt Tee mit uns und hört zu, was wir zu sagen haben. Die Amerikaner sind daran nicht interessiert. Sie wollen uns ihren Willen aufzwingen durch Diktat an Stelle von Dialog.«
Er winkt einem folkloristisch gekleideten Diener, der mir bittersüßen Tee einschenkt – eine Wohltat bei der trockenen Hitze hier. Der Botschafter lehnt sich zurück und erklärt, die Regierung in Khartum wolle freundschaftliche Beziehungen zu den USA. Sie sei Washington in jeder Hinsicht entgegengekommen: Durch die Auslieferung des Terroristen Carlos und durch frühzeitige Hinweise auf Osama Bin Laden, dessen Firma im Sudan Straßen gebaut habe. Anstatt die Hinweise ernstzunehmen, habe das Pentagon als Vergeltung für den Bombenanschlag von Nairobi eine Medikamentenfabrik in Khartum zerstört und die zugesagte Wiedergutmachung nie bezahlt. Dabei habe die sudanesische Regierung mit Terroristen nichts im Sinn – im Gegenteil: Den fundamentalistischen Heißsporn Turabi habe sie politisch kaltgestellt. Er kenne ihn persönlich: Hassan Turabi sei ein anerkannter Experte für islamisches Recht, aber statt sich auf Gelehrsamkeit zu beschränken, predige er Haß und habe sich durch seinen Fanatismus selbst ins Gefängnis gebracht. Der Mann sei verrückt!
»Und was sagen Sie zu den Menschenrechtsverletzungen im Westsudan?«
Bechir beugt sich vor und zündet sich eine Zigarette an. »In Darfur lebten zahlreiche Ethnien friedlich nebeneinander: Zaghawa, Fur, Massalit und andere. Letztes Jahr zettelten die Zaghawas einen Aufstand gegen die Zentralregierung an, unterstützt durch Waffen und Soldaten aus dem Tschad. Dessen Staatschef Déby ist unser Freund, denn er kam mit sudanesischer Hilfe an die Macht.« Doch die tschadische Armee werde von Zaghawas dominiert, die in Darfur einen separaten Staat errichten wollten. Sie glaubten, der Moment zum Losschlagen sei gekommen, als die Regierung in Khartum, als Zeichen ihres guten Willens, Waffenstillstand schloß mit den Rebellen im Südsudan. Um den Friedensprozeß zu stören, hätten die Zaghawas Polizei- und Militärposten angegriffen. »Wir sind verpflichtet, unsere nationale Souveränität zu verteidigen, und die sudanesische Armee hat den Aufstand niedergeschlagen. Falls es dabei zu Menschenrechtsverletzungen kam, bedauern wir dies und haben unsere Bereitschaft erklärt, UN-Beobachter und Hilfsorganisationen nach Darfur einreisen zu lassen. Trotzdem wird Sudan als Schurkenstaat verteufelt und in den Medien an den Pranger gestellt!«
Szenenwechsel. Carnivore heißt Fleischfresser, und das Restaurant trägt seinen Namen zu Recht. Hier gibt es die besten Steaks von N’djamena, und nach Einbruch der Dunkelheit findet eine andere Art Fleischbeschau statt. Junge Frauen aus Kamerun, die im Tschad Abitur machen – das Kameruner Abitur wird in Frankreich nicht anerkannt – geben sich ein Stelldichein mit Geschäftsleuten, Diplomaten und Entwicklungshelfern. Einer von ihnen ist Georges, der seit drei Jahren in einer Oase im Norden des Tschad arbeitet, wo es weder Alkohol noch Frauen gibt: Ehemänner, Brüder und Väter halten sie eifersüchtig unter Verschluß. Alle zwei Wochen fährt er in die Hauptstadt, um Pernod zu trinken und sich sexuell auszutoben. Ich will wissen, wie er sich gegen AIDS schützt. »Es gibt zwei Denkschulen. Mein russischer Kollege behauptet, Wodka sei das sicherste Mittel gegen AIDS. Aber das ist russisches Roulette. Am besten legt man sich eine feste Freundin zu!« Zur Zeit hat Georges Liebeskummer: Seine Ex-Geliebte hat Abitur gemacht und ist nach Jaunde zurückgekehrt, und er kann sich nicht entscheiden zwischen Frau und Kind in Lyon und einer anderen Kamerunerin. Während Georges das Für und Wider erörtert, fegt eine Sturmbö durch das Gartenlokal, die Äste von den Bäumen und Speisekarten über die Tische wirbelt – ein Vorbote der Regenzeit, die den Osten des Tschad in eine Schlammwüste verwandeln wird.
Georges Nummer zwei, ein Namensvetter des Entwicklungshelfers, ist aus anderem Holz geschnitzt. Der Jesuitenpater arbeitet seit 36 Jahren im Tschad, trägt ausgelatschte Sandalen, und Malaria oder Hepatitis hat seine Haut gelb gefärbt. 1984 – 86 hat er eine katastrophale Dürre miterlebt, in der die Bauern Haus und Hof verließen und ihre Kinder im Busch aussetzten, weil sie weder Wasser noch Nahrung fanden. Zehn Jahre zuvor hatte ein Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd das Land in feindliche Lager geteilt; wer die unsichtbare Front überschritt, wurde verdächtigt, ein Kollaborateur oder Verräter zu sein.
»Stammesfehden haben hierzulande Tradition, denn alle ethnischen Gruppen haben alte Rechnungen miteinander zu begleichen«, sagt Pater Georges, der mir im Büro des Erzbischofs, der Procure, unter einem Papst-Poster gegenübersitzt. »Nicht nur Polizei und Armee, auch die Nachbarstaaten Sudan und Libyen mischen in undurchsichtiger Weise mit. Es geht um die Verteilung immer knapper werdender Ressourcen, und für Nomaden ist Viehdiebstahl kein Verbrechen, sondern Ehrensache. Die Zaghawas sind ein altes Kriegervolk, und bevor sie in Darfur rebellierten, haben Zaghawa-Söldner in der Zentralafrikanischen Republik einen dem Tschad genehmen Putschoffizier namens Bozizé an die Macht gebracht. In letzter Zeit aber nehmen die Verteilungskämpfe immer bestialischere Formen an, und was derzeit an der sudanesischen Grenze passiert, sprengt den Rahmen der üblichen Banditentätigkeit und ist offener Krieg. Passen Sie auf sich auf!«
»Die Vertreibung aus ihren Häusern ist schlimmster Stress für Kinder, alte und behinderte Menschen, die am verwundbarsten sind«, lese ich in einer Broschüre des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen. Wir fliegen in 23 000 Fuß Höhe, unter uns die von ausgetrockneten Flüssen durchzogene Savanne, eingehüllt in gelbbraunen Dunst. Es war nicht leicht, einen Platz in einem der Hilfsflüge zu ergattern; prominente Politiker, VIPs genannt, haben Vorrang, oder die Maschinen bleiben wegen technischer Pannen am Boden. Stundenlanges Warten auf der Piste hat das Flugzeug aufgeheizt; im Innern ist es heiß wie in einem Hochofen, und die Passagiere – zwei italienische Entwicklungshelfer und eine deutsche Mitarbeiterin von Caritas International – fächeln sich mit Faltblättern Luft zu. Noch heißer ist es bei der Landung in Abéché; um dem Gluthauch zu entkommen, suchen wir unter dem Heck der »Beechcraft 200« Schutz, während eine »Transall« der französischen Luftwaffe mit apokalyptischem Donnern auf der Piste niedergeht. Seit dem Einfall libyscher Truppen in den siebziger Jahren ist französisches Militär hier stationiert. Am Rand des Flugfelds wächst ein zerzauster Kameldornbaum, in dessen löchrigem Schatten sich das Empfangskomitee zusammendrängt: Vertreter örtlicher Hilfsorganisationen, aber der für mich zuständige Pressesprecher des Welternährungsprogramms ist nicht dabei. Nach kurzer Beratschlagung schließe ich mich der Caritas-Mitarbeiterin an. Sie heißt Christine Decker, kommt aus Freiburg und hat dasselbe Ziel wie ich: Die Flüchtlingslager entlang der Grenze zu besuchen, um sich ein Bild zu machen von der Lage der Vertriebenen, das nicht auf bloßem Hörensagen, sondern auf persönlichem Augenschein beruht.
Doch das ist leichter gesagt als getan, denn vorher sind bürokratische Hürden zu überwinden und administrative Genehmigungen einzuholen, ohne die der Aufenthalt im Grenzgebiet illegal und doppelt gefährlich ist: Reporter, die unangemeldet einreisen, werden als Spione verhaftet und verhört, abgeschoben oder ausgewiesen. Philippe, Büroleiter eines katholischen Hilfswerks namens SECADEV, das mit der Caritas kooperiert, weckt den Ortskommandanten aus seiner Siesta. Der schickt uns weiter zum Polizeichef und von dort zum Gouverneur, der uns bei Einbruch der Dämmerung in seinem Palast empfängt. Ein leerer Repräsentationsraum mit vom Wind bewegten Vorhängen, verstaubten Teppichen und einem überlebensgroßen Porträt des Staatspräsidenten, unter dem der Gouverneur sich auf einer Art Thron niederläßt, während ich wie ein angezählter Boxer erschöpft in einen Ledersessel sinke. Der Polizeichef holt eine Taschenlampe, und im tanzenden Lichtkegel zeigt der Gouverneur uns die Lage der Provinz Ouaddai auf der Landkarte, die sich immer wieder unter seinen Händen zusammenrollt. Die Grenze mit Sudan sei über tausend Kilometer lang und deshalb schwer zu kontrollieren, erläutert er, während ein Bedienter lauwarme Limonade ausschenkt. Die sudanesische Regierung halte sich nicht an den kürzlich vereinbarten Waffenstillstand; bei der Verfolgung von Flüchtenden seien die Reitermilizen wiederholt auf tschadisches Gebiet vorgedrungen, um Vieh zu rauben und grenznahe Dörfer zu plündern; letzte Nacht hätten Janjaweeds bei Koulbous die Grenze überschritten, wie Radio France meldete. Ich will wissen, wer die Milizen sind und in wessen Auftrag sie handeln. »Sie nennen sich Araber«, sagt der Gouverneur, »aber sie sind keine. Jan heißt Waffe und Ja heißt Pferd. Es sind bewaffnete Reiter, hellhäutige Sudanesen, Zivilisten und Armeeangehörige, die in offiziellem Auftrag morden, stehlen und vergewaltigen, um die autochthone Bevölkerung aus Darfur zu vertreiben. Die sudanesische Regierung lügt, wenn sie behauptet, sie wisse von nichts, und gleichzeitig verspricht, die Übergriffe zu unterbinden. Das sind leere Worte, um Zeit zu gewinnen und vollendete Tatsachen zu schaffen vor Beginn der Regenzeit, die das Gebiet unpassierbar machen wird. – Wir haben nichts gegen unsere sudanesischen Brüder«, fügt der Gouverneur nach einer Pause hinzu und zündet sich eine Filterzigarette an. »Ich war kürzlich in Khartum als Mitglied einer Verhandlungsdelegation, und ich frage Sie: Wenn in Darfur wirklich Frieden herrscht, wie die sudanesische Regierung beteuert – warum kommen dann täglich mehr Flüchtlinge über die Grenze?«
»Und was verspricht sich Khartum vom Einsatz der Milizen?«–»Die Janjaweeds alimentieren sich selbst – durch Raub und Mord. Sie kosten nichts, sind niemandem zur Rechenschaft verpflichtet und nirgendwo offiziell registriert. Wenn einer von ihnen verwundet wird oder stirbt, kräht kein Hahn nach ihm.«
Der Gouverneur kommt aus der Hauptstadt und ist seit vier Jahren in Abéché stationiert. Um Loyalitätskonflikte zu vermeiden, werden alle leitenden Funktionen mit Auswärtigen besetzt – teile und herrsche auch im Tschad. Als ich ihm meine Visitenkarte überreiche, entsteht große Verlegenheit. Der Polizeichef schwärmt mit der Taschenlampe aus, und es dauert lange, bis er den Managerkoffer des Gouverneurs gefunden hat, aus dem dieser, zwischen Banknoten und Dokumenten, eine arabisch bedruckte Karte hervorzieht, auf die er mit goldenem Füllfederhalter seinen Namen schreibt: Haroun Saleh, Gouverneur du Ouaddai.
Am nächsten Tag brechen wir in aller Frühe auf. Der gemietete Land Rover ist vollgepackt mit Trinkwasser und Lebensmitteln, hauptsächlich Keksen; dazwischen eine mit Diesel gefüllte Tonne, die bei jeder Unebenheit des Bodens gegen die Wagendecke schlägt. Im Grenzgebiet gibt es weder Tankstellen noch Geschäfte, kein Wasser und keinen Strom – ganz zu schweigen von Hotels oder Restaurants. Issah, der Chauffeur, sieht aus wie ein Tuareg; außer französisch und arabisch spricht er mehrere afrikanische Sprachen, und es ist mir schleierhaft, wie er sich ohne Straßenschilder und Wegmarkierungen orientiert: Einziger Anhaltspunkt sind nebeneinander herlaufende oder sich überkreuzende Reifenspuren, die irgendwann in andere Richtungen abbiegen. Wir fahren durch die mit Felstrümmern übersäte Savanne und rasen im Eiltempo durch Flußbetten, die an Stelle von Wasser nur Sand und Steine führen. Links und rechts der Piste Dornbüsche und Krüppelakazien, an denen von Kindern gehütete Esel und Ziegen knabbern. Die Wüste sieht biblisch aus: Ein schattenspendender Baum ist ein Labsal hier, wo nur selten ein Auto vorüberfährt und jede Panne lebensgefährlich ist. Der Boden ist aufgeheizt wie eine Elektrokochplatte, und unter dem Sand liegt eine wasserundurchlässige Tonschicht, die das Land bei Regen in einen See verwandelt oder in zähen Morast, in dem die mit Hilfsgütern beladenen Lastwagen steckenbleiben. Ouaddai-Dörfer, kreisrunde Lehmhütten mit Strohdächern, die wie verrutschte Zipfelmützen aussehen, Pferde und Kamele, die bei der Annäherung unseres Autos in Panik davonstieben.
Nach dreistündiger Fahrt kommt das Lager Kounoungo in Sicht: Ich zähle 500 in Reih und Glied aufgebaute Zelte mit dem Aufdruck des Flüchtlingshilfswerks UNHCR, die zehnmal soviel Menschen Obdach bieten, hauptsächlich Frauen, Kindern und Greisen: Viele Männer im wehrfähigen Alter haben sich den Zaghawa-Rebellen angeschlossen oder wurden von Janjaweed-Milizen umgebracht. Ihre Familien, die in der Zeltstadt untergekommen sind, haben das Schlimmste überstanden. Sie werden medizinisch betreut und mit Lebensmitteln und Wasser versorgt, wenn auch nur unzureichend, und sie haben ein Dach über dem Kopf. Aber außerhalb des Lagers warten noch einmal soviele Flüchtlinge, die seit Tagen, Wochen, Monaten in der Savanne umherirren, ohne Wasser und Lebensmittel unter sengender Sonne in einer der menschenfeindlichsten Regionen der Welt. Rinder und Pferde sind auf der Flucht verendet oder wurden von Janjaweeds gestohlen, nur Esel und Ziegen haben den langen Marsch überlebt. Die Flüchtlinge verkaufen ihr letztes Vieh – für Nomaden Lebensversicherung und Sparkonto zugleich – und mit dem mageren Erlös bezahlen sie die Mitfahrgelegenheit auf der Pritsche eines LKW, der sie am Lagertor absetzt, wo sie vergeblich auf Einlaß warten. Vor der Aufnahme ins gelobte Land steht eine bürokratische Prozedur, die sich lange hinziehen kann: Die Neuankömmlinge werden von Flüchtlingskomitees der tschadischen Regierung registriert, um sicherzustellen, daß sie keine Einheimischen sind, die von der Gratisausgabe von Lebensmitteln profitieren wollen; Familienzugehörigkeit, Herkunft und Namen werden sorgfältig überprüft, und erst wenn diese Hürden genommen sind, bekommen sie vom UNHCR Plastikfolien, Wasser und Nahrung zugeteilt. Bis dahin vergeht viel Zeit, und die Flüchtlinge leiden Hunger und Durst, während vor ihren Augen mit Lebensmitteln beladene LKW ins Lager ein- und ausfahren. Von den Hilfsgütern fällt wenig für sie ab: Nur Säuglinge und schwangere Frauen, Alte und Kranke werden mit Milchpulver und proteinhaltigen Keksen versorgt, die selbst ein Gesunder nur mit Mühe kauen kann.
Der Flüchtling, das unbekannte Wesen: Auf einer Karikatur der Zeitung Le Progrès ist ein Verdurstender in der Wüste zu sehen, der von Reporterteams mit Kameras und Mikrophonen umlagert und gefragt wird, wie er sich fühlt. Hier ist es umgekehrt: Als ich aus dem Auto steige, kommen von allen Seiten Flüchtlinge auf mich zu. Zuerst Kinder, dann Frauen in leuchtend bunten Gewändern, zuletzt die Männer, von denen einer, ein grauhaariger Alter im langen Kaftan, fließend englisch spricht. Er ist Lehrer von Beruf und trägt einen Kugelschreiber in der Brusttasche. Der Junge, der ihn an der Hand führt, schreibt mir seinen Namen auf den Oberarm: Er heißt Yakub Abdallah und stammt aus einem Dorf im Innern von Darfur. Berittene Janjaweed-Milizen zündeten die Hütten an und töteten seine blinde Mutter, weil sie nicht schnell genug weglaufen konnte, und ein »Antonow«-Flugzeug der sudanesischen Luftwaffe warf mit Schrappnells gefüllte Bomben ab und nahm die Fliehenden unter Beschuß. Yakub Abdallah gehört zum Volk der Saghawas und hat Englisch und Arabisch unterrichtet; sein Freund Adam Mussah ist 45 Jahre alt, Schuldirektor vom Stamm der Fur. Er bestätigt die Angaben des Alten: Der Krieg in Darfur habe 1984 begonnen mit Viehdiebstählen und Überfällen, bei denen 800 Dörfer zerstört und viele Angehörige des Fur- und Zaghawa-Volks massakriert worden seien. 1989 habe Präsident Baschir Frieden mit ihnen geschlossen und die Bewohner von Darfur aufgerufen, ihre Waffen abzugeben. Als Wiedergutmachung für das erlittene Unrecht habe er ihnen eine Eisenbahnladung mit Zucker geschickt, aber die Aufständischen hätten, durch Schaden klug geworden, den Zucker gegen Waffen eingetauscht – Zucker ist in Afrika ein Grundnahrungsmittel. »Bitte lassen Sie uns nicht allein«, mit diesen Worten beschließt Adam Mussah seinen Bericht. »Unsere Brunnen und Felder werden mit Chemikalien vergiftet, und ganz Darfur ist ein einziges Massengrab. This is genocide!«
Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Es sind immer nur Männer, die sprechen, und die meisten sind Lehrer von Beruf – der Kugelschreiber am Revers ist ein Statussymbol wie bei den Funktionären der SPLA im Südsudan. Ihre Berichte stimmen wörtlich miteinander überein. Was die Beurteilung zusätzlich erschwert, ist, daß man keine wandelnden Skelette vor sich sieht wie bei den Hungersnöten in Äthiopien oder Somalia. Das Elend der Flüchtlinge aus Darfur ist nicht monoton, sondern pittoresk: Die Frauen sind buntgekleidet, und die Männer strahlen eine Würde aus, die durch Hunger und Armut noch nicht gebrochen ist. Nur in den Nasenlöchern der Kinder herumkriechende Fliegen deuten darauf hin, daß sich eine Katastrophe anbahnt – und mit Plastikfetzen und Stoffresten behängte Dornbüsche, unter denen sich zehnköpfige Familien auf der Fläche eines Zweimannzelts zusammendrängen. Die meisten Flüchtlinge sind unterernährt, viele haben Husten und Durchfall: Es gibt keine Latrinen, und nachts wird es kühl, bis zu 5 Grad nach Einsetzen der Regenzeit, die Bronchitis und Tuberkulose nach sich ziehen wird.
Guéréda, im Grenzgebiet zum Sudan. Früh um sieben machen wir dem Sultan der Zaghawas unsere Aufwartung. Er residiert in einem Lehmpalast, in Sichtweite eines Lebensmitteldepots von WFP, ein riesiges Zelt, bis unters Dach mit aufeinandergestapelten Säcken gefüllt. Der Sultanspalast ähnelt einem Bauerngut, im Innenhof scheppert eine Maschine, die Hirse drischt, und nur der mit Teppichen ausgelegte Empfangsraum, vor dessen Betreten ich die Schuhe ausziehen muß, weist auf den hohen Rang seines Bewohners hin. Mahamat Bakhil Hagar ist das traditionelle Oberhaupt des Zaghawa-Volks, aber er hat keine politische Macht, lediglich eine symbolische und religiöse Funktion. Der Sultan sitzt unter gekreuzten Lanzen und Schwertern auf einem erhöhten Thron; an der Wand hängt ein Lederharnisch, über und über beschrieben mit Suren aus dem Koran, die den Träger vor Dolchen und Gewehrkugeln schützen sollen, und als ich seinen Namen notiere, runzelt er mißbilligend die Stirn. Der Dialog ist mehr als einseitig – selbst die Führer der Roten Khmer sind gesprächiger als der Fürst des Zaghawa-Volks, der auf keine ihm gestellte Frage antwortet und erst nach mehrfachem Insistieren die einsilbige Auskunft gibt, wenn wir etwas über Darfur wissen wollten, müßten wir selbst dorthin fahren. Erst später erfahre ich den Grund seiner Zurückhaltung: Der Sultan habe Angst, etwas Falsches zu sagen, meint Emmanuel, der örtliche Mitarbeiter der SECADEV: »Es ist unhöflich, ihm direkte Fragen zu stellen, denn er hat keine Erfahrung im Umgang mit Reportern, die in seinen Augen Spione sind.« Als traditioneller Herrscher sitze er zwischen allen Stühlen und werde von der Regierung des Tschad ebenso mißtrauisch beäugt wie von lokalen Behörden und rivalisierenden Clans – nicht zu vergessen die Machthaber im Sudan. »Der Sultan verläßt niemals seinen Palast«, mit diesem Satz bringt Emmanuel die Sache auf den Punkt: »Er weiß alles, aber er sagt nichts.«
Touloum, Tiné, Bahai: Der Besuch der Flüchtlingslager entlang der sudanesischen Grenze gleicht einem quälend langsamen Abstieg durch verschiedene Kreise der Hölle, wobei es jedesmal, wenn ich glaube, der Tiefpunkt sei erreicht, noch schlimmer kommt. In Touloum sind 6 000 Flüchtlinge in Zelten untergebracht, noch einmal soviele hocken apathisch in der kochendheißen Savanne, die keine Handbreit Schatten wirft, und warten darauf, registriert und ins Lager aufgenommen zu werden. Einer von ihnen ist Mohamed Harun, 48, ein Zaghawa-Bauer, dem eine von einer »Antonow« abgeworfene Bombe den Fuß abriß. Er zeichnet mit der Krücke den Fluchtweg in den Sand, den er auf einem Esel reitend zurückgelegt hat. Sein Freund Abdallah Mahmud, 29, wurde von einer Kugel ins Bein getroffen und zeigt mir die schlecht verheilte Schußwunde. Beim Angriff der Milizen wurden sechs Mitglieder seiner zehnköpfigen Familie getötet, unter ihnen ein Säugling, und der einzige Unterschied war, daß die Janjaweeds nicht zu Pferde, sondern mit Pickup-Trucks in das grenznahe Dorf einfielen.
Aber auch die in Zelten untergebrachten Flüchtlinge sind aus dem Gröbsten nicht heraus. 400 Gramm Sorghum, 50 Gramm getrocknete Bohnen oder angereicherter Mais und 20 Gramm Speiseöl beträgt die Lebensmittelzuteilung pro Tag und Person, aber derzeit fehlt das Speiseöl zum Kochen, und statt der notwendigen fünfzehn Liter werden nur fünf Liter Wasser pro Familie zugeteilt, weil die Wasservorräte erschöpft und Pumpen ausgefallen sind. Trotzdem ist kein Klagelaut zu hören, und junge Mütter mit Kindern auf dem Arm, die stundenlang in der prallen Sonne anstehen, nehmen dankbar die von Hilfsorganisationen verteilten Plastikplanen und Wasserbehälter in Empfang.
An diesem Tag ist James Morris nach Touloum eingeflogen, der Präsident des Welternährungsprogramms, der als Leiter einer hochrangigen UN-Delegation das für Journalisten gesperrte Kriegsgebiet in Darfur besucht hat und, unter einem Kameldornbaum stehend, die Presse informiert. Morris ist ein korpulenter Mann; er trägt ein Polohemd mit dem Logo eines Golfclubs und berichtet mit schleppendem Südstaatenakzent, was er in Darfur gesehen hat: Zerstörte Dörfer und Flüchtlinge, die selbst in Lagern nicht vor Nachstellungen der Janjaweeds sicher seien. »Politik der verbrannten Erde, ethnische Vertreibung bis hin zum Genozid«, murmelt Morris mit stockender Stimme und hält sich an dem mit Dornen gespickten Baumstamm fest, als habe er einen Schwächeanfall – kein Wunder bei der Hitze und dem Elend um ihn herum. Sein Beispiel wirkt ansteckend, denn auf dem Weg zur Latrine, die nur aus einem in die Erde gestanzten Loch besteht, durch Plastikfolie vor Einblick von außen geschützt, spüre ich, wie mir plötzlich weich wird in den Knien. Nicht nur die Vertriebenen sind physisch ausgelaugt.
Eine andere Art von Tragödie spielt sich ab im achtzig Kilometer entfernten Grenzort Tiné. In der Hoffnung auf Wasser und Lebensmittel kampieren Abertausende von Flüchtlingen außerhalb der Stadt, inmitten von Exkrementen und Müll. Der Gestank ist unerträglich, und die wie eine Wok-Pfanne gewölbte Hochebene ist, soweit das Auge reicht, mit Tierkadavern übersät, Esel zumeist, die in der Gluthitze verwesen, während zu Skeletten abgemagerte Rinder und Ziegen an Plastiktüten herumknabbern. Die toten Tiere werden eingesammelt und verbrannt; Schakale und Hyänen lebten nur im Süden des Tschad, sagt Issah, unser Chauffeur, und für Geier sei die Wüste zu heiß. Eine Mutter mit rotznäsigem Kind auf dem Arm – sein rot verfärbtes Haar deutet auf Mangelernährung hin – erzählt, die letzte Essenszuteilung habe Ende März stattgefunden, und zum Wasserholen müsse sie fünf Stunden durch die Savanne laufen, nachts, wenn Schlangen und Skorpione unterwegs sind – tagsüber sei der Fußmarsch zu anstrengend. Das Wasser ist verschmutzt, und um den Hunger der Familie zu stillen, muß sie Wurzeln und Wildfrüchte kochen, die Magenbeschwerden und Durchfall verursachen. Ein paar hundert Meter weiter liegt die neuerbaute Luxusvilla des Staatspräsidenten Idriss Déby, der von hier aus seinen Siegeszug antrat zur »Befreiung« des Tschad; schräg gegenüber eine aufwendig renovierte Moschee, deren Mullah sich nicht um seine Glaubensbrüder kümmert und die Versorgung der Flüchtlinge westlichen Hilfsdiensten überläßt. Dabei ist der Bürgerkrieg in Darfur, dessen Gefechtslärm nachts nach Tiné herüberdringt, kein Religionskonflikt wie im Südsudan, weil alle Beteiligten Moslems sind.
Sechzig Kilometer weiter nördlich, in Bahai, ist ein einziger Arzt für die Versorgung Tausender Flüchtlinge zuständig, von denen viele zu entkräftet sind, um den Weg zur Krankenstation zu schaffen. Camilo Valderrama, 47, kommt aus Kolumbien, hat vorher in Liberia gearbeitet und ist seit zwei Monaten hier: »30 Prozent der Vertriebenen sind unterernährt, 50 Prozent haben Durchfall, und wir beseitigen jeden Tag über hundert Tierkadaver«, sagt der Arzt am Ende der Welt, der nur über einen begrenzten Vorrat an Medikamenten verfügt und den Flüchtlingsfrauen die elementarsten Regeln der Gesundheitsvorsorge vermitteln will: Trennung von Gesunden und Kranken, Händewaschen und elementare Hygiene – ohne sauberes Wasser ein frommer Wunsch. »Warum hat sich die Sterberate im letzten Monat verzehnfacht? Was war die häufigste Todesursache?«, fragt Camilo die im Schatten eines Pavillons wartenden Frauen, während ein sudanesischer Lehrer seine Worte auf arabisch übersetzt. »Wasser ist Gold, und sauberes Wasser ist ein Diamant«, erläutert er und zündet sich eine Zigarette an. Camilo ist Kettenraucher, und nur durch ständige Zufuhr von Nikotin erträgt er das Elend hier. Weiter nördlich, in Cariari, sei es noch schlimmer, weil niemand sich um die Versorgung der Flüchtlinge kümmere. Auf der Fahrt dorthin hat er eine im achten Monat schwangere Noamdenfrau in der Savanne aufgelesen; ohne sein Eingreifen wäre sie jetzt schon tot. Djamila ruht unter einer dünnen Decke im Schatten der Krankenstation, und beim Anblick des Arztes versucht sie vergeblich, sich aufzurichten. »Ein schwerer Fall von Anämie«, sagt Camilo, während sie stöhnend auf ihr Lager zurücksinkt. »Djamila wird ihr Baby verlieren, und ich bin nicht sicher, ob sie überlebt!«
Letztes Bild, bei der Abfahrt aus Tiné: Ein sterbender Esel in der Wüste. Er wendet mühsam den Kopf zu dem Auto, das neben ihm hält; ein Beben durchläuft die zum Gerippe abgemagerte Brust, und er ist tot.
P.S.: »Vor den Menschen sterben die Tiere«, sagt Pater Joël, der uns in seinem Haus in Abéché empfängt – das erste Essen seit Tagen, das nicht nur aus Wasser und Biskuits besteht. Der Jesuitenpater betreut versprengte Christengemeinden an der 1 500 Kilometer langen Ostgrenze Tschads, hat Freunde unter den Mullahs und wird von seiner muslimischen Umgebung respektiert. »Schreiben Sie auf, was Sie gesehen haben, und sagen Sie die Wahrheit über die Flüchtlinge! Kürzlich war eine hochgestellte Persönlichkeit hier, deren Namen ich nicht nennen darf, denn der Mann ist Christ. Er behauptete, es gebe kein Flüchtlingsproblem in Darfur!«
Vielleicht meint Pater Joël den Botschafter eines mit der Bundesrepublik befreundeten Landes, der mich in N’djamena ins Gebet genommen hat. Er hielt einen druckreifen Vortrag über die geopolitische Bedeutung Sudans als größter Flächenstaat Afrikas, am Kreuzungspunkt von Anglophonie und Frankophonie, arabischen Ölstaaten und fundamentalistischem Islam. Da diese angeblich christlich sei, unterstützten die USA seit Jahren John Garangs Rebellenarmee, die Demokratie nur für Nordsudan fordere, im Süden aber diktatorisch regiere. In Wahrheit gehe es um Ölvorkommen und Bodenschätze, die nicht bloß im Südsudan, sondern auch in Darfur vermutet werden: Deshalb die von Washington angestrebte Internationalisierung des Konflikts mit dem Fernziel der Aufteilung des Sudan. Eine perfekte Verschwörungstheorie, die nur einen Schönheitsfehler hat: Die ethnische Vertreibung aus Darfur ist keine Erfindung von CNN, es gibt sie wirklich.
Die vom amerikanischen Delegationschef in Genf gezogenen Parallelen zu Ruanda und Kambodscha waren und sind irreführend und falsch – ich darf dies sagen, denn ich habe die Auswirkungen beider Genozide vor Ort erlebt. Aber das ist kein Trost für die Flüchtlinge aus Darfur, denen das Schlimmste erst noch bevorsteht, wenn die Regenzeit beginnt. Ein anderer historischer Vergleich macht mehr Sinn: Im Herbst 2004 begeht Namibia den hundertsten Jahrestag des Herero-Aufstands, der mit einem Massensterben endete. Nach der Schlacht am Waterberg wurden die Hereros in die Omaheke-Wüste abgedrängt, wo ein Drittel des Nomadenvolks – 30.000 Männer, Frauen und Kinder – an Hunger und Durst zugrunde ging: »Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr, mit und ohne Vieh erschossen!« Der Ausrottungsbefehl des berüchtigten Generals von Trotha paßt zur Politik der verbrannten Erde in Darfur, wo das Baschir-Regime sich wie eine Kolonialmacht gebärdet – die Knechtung der Schwarzafrikaner hat im Sudan eine unselige Tradition. Aber in einer anderen Hinsicht gebe ich dem europäischen Diplomaten recht: Washingtons Frontstellung gegen den französischen Einfluß in Afrika ist kurzsichtig und kontraproduktiv, denn die auf einer kulturellen Symbiose beruhende Frankophonie ist ein festeres Bollwerk gegen islamischen Fanatismus und Terrorismus als der American Way of Life, der, wie derzeit im Irak, nur Öl ins Feuer gießt.
Besser als die schrille Menschenrechtsrhetorik der Gegenwart es vermag, hat der Schriftsteller und spätere Nobelpreisträger André Gide das Problem auf den Punkt gebracht, als er in seinem Reisebericht aus Kongo und Tschad 1927 schrieb: »Die durch mein Buch geweckte Aufmerksamkeit wird bald wieder einschlafen: Bis zu dem Tag, an dem ein anderer Reisender, wie ich von der verrückten Idee angetrieben, sich anzusehen, was dort unten geschieht, neue Machtmißbräuche aufdeckt, ähnliche Abscheulichkeiten anprangert und der Öffentlichkeit zu verstehen gibt, daß sich an diesen Mißbräuchen außer dem Etikett, mit dem man sie bemäntelt, nichts geändert haben wird.«