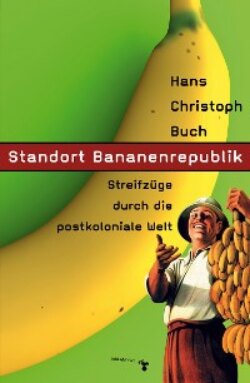Читать книгу Standort Bananenrepublik - Hans Christoph Buch - Страница 8
Der widerlichste Beutezug
der Geschichte
ОглавлениеAuf Spurensuche zu Joseph Conrads
»Herz der Finsternis«
Was für ein Roman! Dabei ist Heart of Darkness gar kein Roman, sondern eine Erzählung, genauer gesagt eine Rahmenerzählung, auf halbem Weg zwischen Novelle und Reisebericht. Die Unbestimmtheit der Gattung hat sie mit einem anderen Meisterwerk der frühen Moderne gemein, dessen Inhalt so übermächtig ist, daß die Frage nach der Form unerheblich wird: Franz Kafkas In der Strafkolonie. Zwei grundlegende, nein grundstürzende Texte der europäischen Literatur, die beide den Imperialismus thematisieren, in dessen Hoch-Zeit – vor dem Ersten Weltkrieg – sie entstanden sind, und die beide in Kolonialgebieten spielen: Conrads Erzählung am Oberlauf des Kongo und die Kafkas in einer nicht näher bezeichneten Strafkolonie, hinter der sich, wie neuere Forschungen gezeigt haben, das Pazifikterritorium Neukaledonien verbirgt, neben Cayenne, wo Hauptmann Dreyfus seine Strafe verbüßte, Frankreichs wichtigster Deportationsort.1
Die Jahre vor 1914 waren auch die Inkubationszeit des Kubismus, bei dessen Entstehung afrikanische Masken und Skulpturen aus Ozeanien Pate standen, die Picasso und Braque im Pariser Musée de l’homme bewunderten. Schon vorher war Paul Gauguin nach Tahiti emigriert; Max Pechstein und Emil Nolde reisten in kaiserlich-deutsche Kolonien im Südpazifik, wo sie sich von der als primitiv gescholtenen Kunst der Inselbewohner zu einem Malstil inspirieren ließen, der Naturmystik mit unverstellter Sexualität verband. Schon früher hatten sich die gegen den bürgerlichen Kunstgeschmack revoltierenden Neuerer Fauves genannt, ein Ausdruck, den die Schule der Neuen Wilden im Berlin der 80er Jahre wiederbelebte.2
Aber nicht die Kolonisierten stehen bei Conrad und Kafka im Mittelpunkt: Die von edlen Wilden zu blutrünstigen Bestien herabgestuften »Anderen« tauchen hier, wenn überhaupt, nur als exotische Staffage auf, deren Klischeehaftigkeit von postkolonialen Kritikern zu Recht angeprangert worden ist. Im Mittelpunkt von Conrads und Kafkas Novellen steht das, was deren anglo-indischer Zeitgenosse Rudyard Kipling als White Man’s Burden bezeichnet hat, bestehend in einer vorgeblich zivilisatorischen Mission, in deren Namen Europa sich das Recht anmaßte, autochthone Kulturen zu unterjochen, um diesen seinen durch Bibel, Dampfmaschine und Glühbirne verkörperten Fortschritt nahezubringen. Im Sinne der Hegelschen Dialektik von Herr und Knecht, die beiden Erzählungen zugrundeliegt, findet ein Rollentausch statt: Der europäische Protagonist – nicht von ungefähr ein Mann – wirft seine Humanität über Bord und wird zu dem, was er im Bild der »Anderen« bekämpft, zum Raubtier, das seine animalischen Instinkte ungehemmt ausleben darf. Das Adjektiv animalisch steht hier nicht von ungefähr, denn die Bestialisierung des Menschen (und die Vermenschlichung des Tiers) findet in noch kruderer Form in den gleichzeitig entstandenen Romanen von Jack London und Rudyard Kipling (Wolfsblut, Dschungelbuch) statt – oder in den Tarzan-Büchern von Edgar Rice Burroughs, wo der Vulgärdarwinismus mit Händen zu greifen ist. Auch das Klischee vom Dschungel der Großstadt, das die NS-Propaganda gegen die sogenannte Asphaltliteratur ins Feld führte, gehört in diesen Zusammenhang.
Was Conrad und Kafka, der selbst Tierfabeln schrieb, von solchen Trivialmythen unterscheidet, ist der antizipatorische Charakter ihrer Werke, der deren Wirkung zu Lebzeiten der Autoren beeinträchtigte, in den Jahrzehnten nach ihrem Tod aber überdeutlich zutage trat. Gemeint ist der utopische Gehalt dieser Erzählungen, in denen der totalitäre Staat literarisch vorweggenommen scheint, obwohl dessen Menschenvernichtungspotenzial sich damals noch in der Latenzphase befand: Sowohl Kafkas Strafkolonie als auch Conrads Herz der Finsternis wurden und werden, mit dem Wissen der Nachgeborenen, als Vorausdeutungen auf Hitlers Konzentrationslager wie auf Stalins GULAG gelesen. »Das Grauen! Das Grauen!« Die letzten Worte des sterbenden Protagonisten Kurtz belegen dies ebenso wie der nachgelieferte Kommentar von Conrads alter ego Marlow: »›Wie der Mann reden konnte! Große Versammlungen hat er förmlich elektrisiert […] Er hätte einen glänzenden Führer für eine extreme Partei abgegeben.‹ ›Welche Partei?‹ fragte ich. ›Jede Partei‹, versetzte der andere.«3
Auch der Offizier in Kafkas Strafkolonie, der die von seinem Vorgänger ersonnene Folter- und Hinrichtungsmaschine in Gang hält, sieht sich, ähnlich wie der Massenmörder Kurtz, als Künstler, dessen einsame Genialität das Publikum nicht versteht. Noch offensichtlicher wird der Brückenschlag zum Nationalsozialismus beim Blick auf die wichtigste Quelle von Kafkas Erzählung, das 1912 erschienene Buch des Strafrechtsexperten Robert Heindl Meine Reise in die Strafkolonien, auszugsweise vorabgedruckt in der Prager Zeitung Bohemia, die Kafka regelmäßig las. Ähnlich wie der Forschungsreisende in Kafkas Text lehnte der durch die Einführung des Fingerabdruckverfahrens bekannt gewordene Heindl die Einrichtung von Strafkolonien für das Deutsche Reich ab, nicht etwa aus menschenrechtlichen, sondern aus staatspolitischen Erwägungen, weil er den ökonomischen Nutzen der Zwangsarbeit beim Aufbau der Kolonien bezweifelte. Trotzdem blieb Heindl überzeugt von der Unheilbarkeit von Verbrechern, die er, analog zur späteren NS-Justiz, in die Nähe von Geisteskranken rückte, was den studierten Juristen Kurt Tucholsky zu dem Stoßseufzer veranlaßte: »Es gibt besserungsfähige Verbrecher, aber es gibt unverbesserliche Geheimräte.« In seiner Kritik an Heindls Buch kommt Tucholsky, der Kafkas Strafkolonie wohlwollend rezensiert hat, zu einem vernichtenden Schluß, der wie ein vorweggenommener Kommentar zum Eichmann-Prozeß klingt und sich direkt auf Conrads Erzählung übertragen läßt: »Fast alle diese Fachleute aber sind in ihrem Apparat befangen, empfinden das Unrecht nicht mehr, sondern achten nur auf seine formalunanfechtbare Durchführung, als ob Verordnungen, Bestimmungen und Reglements ihre Taten deshalb weniger verbrecherisch erscheinen ließen!«4
Anders als Kafkas Strafkolonie hat Herz der Finsternis einen auf persönlichem Erleben beruhenden, autobiographischen Kern. Im April 1890 verdingt sich Joseph Conrad in Brüssel als Seemann bei der Société Anonyme Belge pour le Commerce du Haut-Congo und fährt mit einem französischen Dampfer von Bordeaux nach Westafrika. Schon die Schilderung des ersten Anblicks der afrikanischen Küste nimmt das deprimierende Fazit der Erzählung vorweg – eine Kolonialismuskritik, die nicht abstraktem Vorwissen, sondern dem konkreten Augenschein entspringt: »Die Flagge des Schiffs hing wie ein Lappen schlaff herab, […] die schmierige, schleimige Dünung hob und senkte es träge, so daß sich seine dünnen Maste hin und her wiegten. Da lag es, in der öden Unermeßlichkeit von Erde, Himmel und Wasser, unbegreiflich, und feuerte auf einen Kontinent […] Etwas Irrsinniges lag in diesem Vorgehen, eine erbärmliche Komik in diesem Anblick; und dieser Eindruck wurde auch dadurch nicht zerstreut, daß mir jemand an Bord ernsthaft versicherte, daß dort ein Lager der Eingeborenen – er nannte sie Feinde – versteckt sei, irgendwo außer Sichtweite.«5
Ein Seestück wie von William Turner, aber anders als die Bilder des britischen Marinemalers ist der Text aufgeladen mit politischer Bedeutung, obwohl oder weil mit keinem Wort von Politik die Rede ist – Ethik und Ästhetik sind, wie stets bei Conrad, zwei Seiten derselben Sache. Nach der Landung in Matadi und auf dem beschwerlichen Fußmarsch nach Léopoldville, heute Kinshasa, wird Joseph Conrad Zeuge der sogenannten Kongo-Greuel, von der belgischen Kolonialverwaltung angerichtete Massaker, denen zwischen 1885 und 1910 nach Schätzungen von Historikern bis zu zehn Millionen Menschen zum Opfer fielen. »Traf einen Offizier vom Staat bei der Inspektion; sah ein paar Minuten später an einem Lagerplatz die Leiche eines Backongo. Erschossen? Unerträglicher Gestank«, notiert Conrad am 3. Juli in sein Reisetagebuch. Und am 4. Juli: »Sah noch eine Leiche am Rand des Pfads in der Haltung nachdenklicher Ruhe.« Für den Weg von der nüchternen Feststellung zur literarischen Beschreibung gibt die folgende Passage Regel und Beispiel zugleich, wobei der Autor, anstatt alle Register seiner Erzählkunst zu ziehen, auf wenige, suggestive Bilder vertraut und die moralische Schlußfolgerung dem Leser überläßt: »Das schwarze Gerippe lag in voller Länge ausgestreckt mit einer Schulter gegen den Baum; langsam hoben sich die Lider, und die tiefliegenden Augen sahen zu mir auf, riesengroß und leer, mit einem blinden weißen Flackern in der Tiefe der Augäpfel, das langsam erstarb […] Ich wußte nichts Besseres, als ihm ein Stück Schiffszwieback […], das ich in der Tasche trug, anzubieten.«6
Der Scharfblick des Reisenden, der schon an den ersten Anzeichen das Ausmaß der Tragödie ermißt, ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, daß Joseph Conrad nur die Frühphase der Annexion des Kongo-Gebiets erlebt hatte, das auf der Berliner Konferenz 1885 dem belgischen König Leopold II. als Privatbesitz zugesprochen worden war – ein als philanthropischer Akt getarnter Völkermord, der in der neueren Geschichte seinesgleichen sucht. Conrads Erzählung schildert die Jagd nach Elfenbein, schon vor Henry Morton Stanleys Durchquerung des afrikanischen Kontinents ein begehrter Exportartikel, der zu Schachfiguren, Schmuck oder Klaviertasten verarbeitet wurde. Im Auftrag Leopolds II. schloß Stanley mit im Einzugsgebiet des Flusses ansässigen Stammesfürsten Verträge, für die das Beiwort »ungleich« noch zu schmeichelhaft ist, denn anders als die Ureinwohner Amerikas traten die Häuptlinge nicht nur ihr Land, sondern auch dessen Bewohner an Belgiens König ab, der sie als Lastenträger und Holzfäller zwangsrekrutieren und beim Straßenbau zugrundegehen ließ. Nachdem auf den von Stanley gebahnten Pfaden die Elefantenherden dezimiert worden waren – der Imperialismus war auch das Zeitalter der Großwildjagd – trat ein anderer Rohstoff an die Stelle des Elfenbeins. Der von Brasilien ausgehende Kautschukboom, damals noch auf Wildpflanzen beschränkt, brachte keine Erleichterung für die Bewohner des Kongobeckens, im Gegenteil – die Zwangseinziehung der Männer zum Kautschuksammeln ließ die Sterberate erneut hochschnellen. Wer weniger als die vorgeschriebene Menge ablieferte, wurde durch Auspeitschen, Abhacken der Hände oder mit dem Tode bestraft, und infolge der Monokultur kam es zu einer durch Brachliegen der Felder verursachten Hungersnot. Im gleichen Zeitraum – von 1900 bis 1908 – erwirtschaftete die Société Anonyme Gewinne von 700 Prozent.7
Die schamlose Bereicherung, gekoppelt mit einer selbst für damalige Verhältnisse rücksichtslosen Ausplünderung der Ressourcen, einschließlich menschlicher Arbeitskraft, rief mächtige Widersacher auf den Plan. Belgien galt als Emporkömmling unter den imperialistischen Staaten, deren Monopole gnadenlos miteinander konkurrierten. Britische Abolitionisten, die nicht der anglikanischen Staatskirche, sondern protestantischen Sekten nahestanden, hatten schon im 19. Jahrhundert lautstark und mit Erfolg die Abschaffung des Sklavenhandels propagiert. Anknüpfend an diese humanitäre Tradition, organisierte Edmund D. Morel, der als Liverpooler Schiffahrtsagent von den Kongo-Greueln erfahren hatte, eine internationale Pressekampagne, die in England und den USA prominente Fürsprecher fand. Zu Morels Unterstützern gehörte der mit Conrad befreundete britische Konsul in Matadi, Sir Roger Casement, dessen schockierende Berichte die Öffentlichkeit wachrüttelten, sowie Mark Twain, der den amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt über die Vorgänge im Kongo informierte. 1905 veröffentlichte er ein Pamphlet mit dem Titel King Leopold’s Soliloquy (König Leopolds Selbstgespräch), das mehrfach neu aufgelegt wurde und dessen Erlös der Congo Reform Association zugute kam. In Mark Twains Text ereifert sich der belgische König über die neueste Errungenschaft der modernen Technik, »die unbestechliche Kodakkamera […] Der einzige Augenzeuge in all diesen Jahren, den ich nicht bestechen konnte.«8
Obwohl er Millionen ausgab, um Abgeordnete und Journalisten zu kaufen – auch im deutschen Reich, dessen Kaiser ihm nicht wohlgesonnen war – mußte Leopold II. klein beigeben und das Kongogebiet, bisher Privatbesitz der Krone, 1908 an den belgischen Staat abtreten, der dafür seine Schulden in Höhe von 110 Millionen übernahm: Ein lukratives Geschäft, aber doch ein Prestigeverlust für den Monarchen. Ausschlaggebend für dessen Niederlage im Public-Relations-Streit war nicht etwa Joseph Conrads Erzählung, die damals schon gedruckt vorlag, sondern die bei Mark Twain erwähnten Fotos, auf denen Augenzeugen, zumeist protestantische Missionare, die Kongo-Greuel dokumentierten: Bilder von Auspeitschungen oder Hinrichtungen, Kindern mit abgehackten Händen etc. Ein fernes Echo dieser Grausamkeiten findet sich in Conrads Schilderung des mit abgeschlagenen Köpfen verzierten Zauns, der das Anwesen von Kurtz umgibt: »Ich hätte überhaupt keine Vorstellung von den hiesigen Verhältnissen, sagte er: Dies seien die Köpfe von Rebellen. Er war über alle Maßen erschrocken, als ich laut auflachte. Rebellen! Welche Bezeichnung würde ich als nächstes zu hören bekommen? Man hatte sie Feinde genannt, Verbrecher, Arbeiter – und dies waren nun – Rebellen. Mir kamen diese rebellischen Köpfe auf ihren Stecken ziemlich unterwürfig vor.«9
Joseph Conrads Zeugnis wiegt umso schwerer, da seine Erzählung vor der von Morel intitiierten Pressekampagne entstanden ist. Daß der koloniale Raubbau auch nach Übernahme des Kongogebiets durch den belgischen Staat nicht beendet war, sondern nur in eine neue Phase eintrat, zeigt der Bericht eines anderen Schriftstellers aus Äquatorial-Afrika. Nach der Genesung von seiner Kriegsverletzung, die ihm einen kaputten Arm und einen Orden eintrug, reiste Louis-Ferdinand Céline, der mit bürgerlichem Namen Destouches hieß, im Mai 1916 nach Kamerun. Von Bikobimbo an der Grenze zu Spanisch-Guinea, wo er sich als Handelsagent niederließ, schrieb er seiner Verlobten Simone Saintu nach Paris: »Der Handel, den ich treibe, ist von himmlischer Einfachheit, er besteht darin, Elefantenzähne gegen Tabak zu kaufen – 2 Päckchen Maryland für einen Stoßzahn, […] der einzige Grund, der mich verleitet, noch in diesem charmanten Land zu verweilen, (um) es mit Tabak zu überschütten, bis der letzte Elefant tot ist.« Und in einem Brief an seinen Freund Albert Milon zieht Céline ein Fazit, das an zynischer Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig läßt: »Man geht in die Kolonien, insbesondere nach Äquatorial-Afrika, um Geld zu machen und nicht um sich dort niederzulassen.«10
Célines desillusionierende Erfahrungen in Afrika sind in seinen 1932 erschienenen Roman Reise ans Ende der Nacht eingegangen, dessen Titel eine versteckte Hommage an Joseph Conrad enthält. Ähnlich wie im eine Generation zuvor entstandenen Herz der Finsternis deckt Céline die hinter humanitären Phrasen verborgene Realität des Imperialismus auf, dessen Herrschaft buchstäblich auf Leichenbergen errichtet war. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn beide Autoren blieben befangen in den kolonialen Vorurteilen ihrer Zeit. Céline machte keinen Hehl aus seiner Verachtung für die »primitiven« Afrikaner, denen er alle nur möglichen negativen Eigenschaften zuschrieb, vom Kannibalismus bis zum Körpergeruch – ein Arsenal rassistischer Klischees, das voll ausgebildet schon bei Joseph Conrad in Erscheinung tritt: »ein Gewirbel schwarzer Glieder, gellendes Geschrei, eine Unmenge klatschender Hände, rollender Augen, stampfender Füße, sich wiegender Leiber […] Der prähistorische Mensch verfluchte uns, betete uns an, hieß uns willkommen – wer konnte das sagen? Wir […] glitten vorüber wie ein Phantom, verwundert und insgeheim entsetzt, wie Gesunde angesichts eines Ausbruchs von Raserei in einem Irrenhaus.«11
Die Flußfahrt auf dem Kongo wird zu einer Zeitreise in die Ur- und Frühgeschichte der Menschheit, und der Autor projiziert sein Unbehagen an der europäischen Kultur auf zu Geisteskranken erklärte »Primitive«– eine Gleichsetzung, die nicht erst im NS-Staat ihre mörderischen Konsequenzen offenbart hat. Der nigerianische Romancier Chinua Achebe hat am vehementesten Einspruch erhoben gegen derartige Rassenvorurteile und Klischees, und seine Stimme hat doppeltes Gewicht, weil er dem durch einen grausamen Bürgerkrieg dezimierten Volk der Ibos entstammt: »Der wesentliche Punkt meiner Beobachtungen dürfte nunmehr ziemlich klar sein, nämlich daß Conrad durch und durch Rassist war […] Aber das ist nicht einmal der Punkt. Die eigentliche Frage ist die Entmenschlichung Afrikas und der Afrikaner, die von dieser althergebrachten, weitverbreiteten Haltung nach wie vor begünstigt wird. Und die Frage ist, ob ein Roman, der diese Entmenschlichung feiert und einen Teil der Gattung Mensch depersonalisiert, ein großes Kunstwerk genannt werden kann. Meine Antwort: Nein, kann er nicht.«12
Dieser Frontalangriff gegen Joseph Conrad ist umso bemerkenswerter, als er zu einer Zeit formuliert wurde, da die Political Correctness noch nicht erfunden war. Andererseits war Chinua Achebe literarisch viel zu sensibel und kompetent, um nicht zwei mögliche Gegenargumente anzuführen: Erstens, »daß es nicht die Aufgabe fiktionaler Literatur ist, den Leuten zu gefallen, von denen sie handelt«, und zweitens, daß »Conrad […] 1890 den Kongo hinabgesegelt« ist. Nicht nur Heart of Darkness, auch Achebes Einspruch gegen Conrads Text hat inzwischen historische Patina angesetzt. Er stammt aus der heroischen Phase der Entkolonialisierung, als, im Zeichen der Kulturrevolution von 1968, die bürgerliche Geschichtsschreibung in ihr diametrales Gegenteil verkehrt wurde. So hat Chinua Achebe die dogmatische Behauptung, an allen Fehlentwicklungen der Dritten Welt sei der Kolonialismus schuld, in späteren Schriften revidiert. Trotzdem blieb er bei seinem Verdammungsurteil über ein Buch, »das in höchst vulgärer Weise Vorurteile und Beleidigungen auffährt, unter denen ein Teil der Menschheit […] unsägliche Qualen und Scheußlichkeiten erlitten hat und bis zum heutigen Tag erleidet«.13
Dieses Argument ist durchaus nachzuvollziehen, und doch geht es am literarischen Kern der Sache vorbei, nämlich an der Ambivalenz, die jedes Kunstwerk, das diesen Namen verdient, reicher und vielschichtiger macht als die manifesten Absichten seines Autors. Das gilt für Joseph Conrads Herz der Finsternis ebenso wie für die Romane von Achebe, Kafka oder Céline, deren ästhetischer Mehrwert gerade in ihrer Mehrdeutigkeit liegt, die den Zeithorizont ihrer Entstehung überschreitet und sie auch unter völlig anderen Bedingungen rezipierbar macht. So läßt sich ohne Schwierigkeit nachweisen – und dies ist auch geschehen –, daß es im Werk von Joseph Conrad sowohl antisemitische als auch frauenfeindliche Tendenzen gibt, sowie eine dem Autor unbewußte, latente Homosexualität. Conrads literarischer Bedeutung tut dies keinen Abbruch, genausowenig wie Célines spätere Wendung zum Antisemitismus den Rang der Reise ans Ende der Nacht zu schmälern vermag. Die Größe dieser Autoren liegt darin, daß sie den Imperialismus von innen heraus kritisieren, indem sie, statt Fahnen zu schwenken oder oppositionelle Meinungen zu artikulieren, die Lügen der Herrschenden und die Lebenslügen der Beherrschten beim Wort nehmen. Das tut auch Kafka, dessen Forschungsreisender gegen seinen Willen die Unmenschlichkeit des Strafsystems aufdeckt, das er halbherzig zu reformieren versucht.
Diese Doppelbödigkeit ist ein untrügliches Kennzeichen literarischer Qualität, deren Wahrheit im Aushalten schmerzhafter Widersprüche liegt. So haben neuere Forschungen gezeigt, daß Shakespeares Kaufmann von Venedig mit gleichem Recht als antisemitische Karikatur wie als Anklage gegen den Antisemitismus gelesen werden kann, was ähnlich für die Darstellung des Schwarzen in Othello gilt.14
Joseph Conrad starb auf den Tag genau zwei Monate nach dem 26 Jahre jüngeren Franz Kafka, am 3. August 1924. In einem seiner letzten Briefe verteidigte er die Ambivalenz der Literatur mit dem Hinweis auf »die völlige Bedeutungslosigkeit einer expliziten, eindeutigen Aussage und ihre Eigenschaft, von all dem abzulenken, was wahre Kunst ausmacht«– Worte, die seiner Erzählung als Motto voranstehen könnten.15
Wer will, kann auf jede historisch-geographische Bezugnahme verzichten und Heart of Darkness, ähnlich wie Kafkas Strafkolonie, als metaphysisches Drama lesen oder als theologische Abhandlung, in der es um Schuld und Sühne geht oder um das Ringen zwischen Licht und Finsternis. Solche Lesarten sind legitim, aber sie ignorieren den konkreten Ort, der so wenig austauschbar ist wie Berlin, Dublin oder Danzig im Werk von Döblin, Joyce und Grass. Es gibt einen genius loci der Literatur, und wer die Stromschnellen des Kongo mit eigenen Augen gesehen hat, liest Herz der Finsternis anders als jemand, der das Innere Afrikas nur vom Hörensagen kennt. Ich war zweimal an den Schauplätzen von Joseph Conrads Erzählung: 1986 in Kinshasa, dem früheren Léopoldville, wo Conrad knapp hundert Jahre zuvor am Bau des Bahnhofs beteiligt war, und 1997 bei der »Befreiung« von Kisangani, ehemals Stanleyville, durch Truppen des Rebellenführers Kabila. Damals hieß Kongo noch Zaire und wurde von dem Diktator Mobutu beherrscht, der mit vollem Namen Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga hieß – der Leopard, der überall, wo er hintritt, verbrannte Erde hinterläßt. Zum Zeichen seiner Häuptlingswürde trug Mobutu stets eine Mütze aus Leopardenfell und hielt zahme Geparden im Garten seines Palasts. Nach einem Besuch der VR China hatte er den Abacost eingeführt (von französisch: »à bas le costume«– nieder mit dem europäischen Anzug!), eine für die Tropenhitze völlig ungeeignete Parteiuniform, deren Herstellung Monopol von Mobutus Familienclan war. Nach der Landung nahm mich der Protokollchef des Flughafens in Empfang und führte mich an der Paß- und Zollkontrolle vorbei in die Küche des Flughafenrestaurants, wo er mir geschmuggelte Diamanten zum Kauf anbot. Unter einem Transparent mit der Aufschrift Le Beaujolais nouveau est arrivé erwarteten mich in Abacosts gekleidete Funktionäre des Schriftstellerverbands. Sie überreichten mir Giftpfeile und Speere als Willkommensgruß und machten mich mit ihrem Vorgesetzten bekannt, einem Oberst mit Stammesnarben im Gesicht, der im November 1965 die Meldung von Mobutus Machtergreifung im Radio verlesen hatte und seitdem als Medienexperte galt, dem auch die Literatur unterstand. »Das nächste Mal will ich ein Gedicht von Dir hören«, herrschte er bei einem Bankett mir zu Ehren einen zairischen Schriftsteller an, der verschämt eingestand, nur Prosa zu schreiben: »Ist das klar?« Und er drohte ihm scherzhaft mit dem Zeigefinger.
Elf Jahre später, in Kisangani, hatte sich das politische Blatt gewendet, und doch schien alles, wie in Conrads Erzählung, beim Alten geblieben zu sein. Außer Ölsardinen und Zahnpasta gab es auf dem Markt nichts zu kaufen; die Wälder waren leergeschossen, der Fluß, der zu Conrads Zeiten noch von Nilpferden und Krokodilen wimmelte, war ausgefischt, und das einzige, was es zu essen gab, war ein Fisch namens Kapitän, für den der Fischer Schadensersatz von mir verlangte, weil ein Dieb ihm den Kopf gestohlen habe – der Kopf des Kapitäns galt als bestes Stück. Die Plünderungen und Massaker beim Abzug der Regierungstruppen und beim Einrücken der Rebellenarmee, deren Chef Kabila im ehemals belgischen Offizierskasino die Vertreter der Presse empfing, beschreibe ich lieber nicht. Ich hatte das Gefühl, an einem von Gott verlassenen, von Geschichte und Geographie verfluchten Ort zu sein, an dem sich nicht viel geändert hatte, seit Joseph Conrad im September 1890 in Stanley Falls an Land gewatet war: »Auf einer kleinen Insel in der Strommitte schimmerte schwach ein kleines, einsames Licht […] Aber in der Nacht dieser ungeheuren Wildnis stand mir kein schattenhafter Freund zur Seite, kein großartiges, ergreifendes Vermächtnis, sondern nur die nichtswürdige Erinnerung an eine prosaische Zeitungssensation (Stanleys Expedition) und das ekelhafte Wissen um die widerlichste Jagd nach Beute, die je die Geschichte des menschlichen Geistes entstellt hat.«16