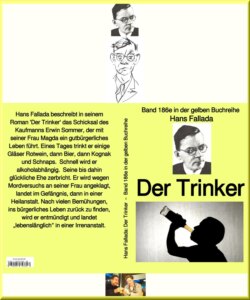Читать книгу Hans Fallada: Der Trinker – Band 186e in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski - Ханс Фаллада - Страница 10
Kapitel sechs
ОглавлениеKapitel sechs
Vorsichtig ging ich den Weg zu meinem Geschäft, vorsichtig, denn ich wollte es um jeden Preis vermeiden, Magda auf der Straße zu treffen. Dann stand ich auf der anderen Straßenseite im Schatten einer Einfahrt und sah zu den fünf Parterrefenstern meiner Firma hinüber. Zwei, mein Chefbüro, waren erleuchtet, und manchmal sah ich auf den Milchglasscheiben die Schattenrisse zweier Gestalten: Magdas und die meines Buchhalters Hinzpeter. ‚Sie machen Bilanz!’ sagte ich mir mit einem tiefen Erschrecken, und doch war diesem Erschrecken ein Gefühl der Erleichterung beigemischt, weil ich nun die Führung des Geschäftes in den tatkräftigen Händen Magdas wusste. Das sah ihr so recht ähnlich, sofort nach Erfahren der schlimmen Nachrichten sich volle Klarheit zu verschaffen, die Bilanz zu ziehen! Mit einem tiefen Seufzer wandte ich mich ab und ging durch die Stadt hindurch, aus ihr hinaus, aber nicht meinem Heim zu. Was sollte ich auf dem Büro, was in meinem Heim? Die Vorwürfe noch aufsuchen, die mir notwendig gemacht werden mussten, eine Rechtfertigung versuchen, dort, wo nichts zu rechtfertigen war? Nichts von alledem – und, indem ich wieder in das langsam immer dunkler werdende Land hinauswanderte, wurde mir mit schmerzhafter Gewissheit klar, dass ich ausgespielt hatte. Ich hatte, endgültig, meine Stellung und meinen Sinn im Leben verloren, und ich fühlte nicht die Kraft in mir, eine neue zu suchen oder gar um die verlorene zu kämpfen. Was sollte ich noch? Wozu lebte ich noch? Da ging ich dahin, wanderte fort von Kontor, Frau, Vaterstadt, ließ das alles hinter mir – aber ich musste doch einmal wieder heimkehren, nicht wahr? Ich musste mich Magda gegenüberstellen, ihre Vorwürfe anhören, mich mit Recht Lügner und Betrüger schelten lassen, musste zugeben, dass ich versagt hatte, auf eine schmähliche und feige Art versagt! Unerträglich war dieser Gedanke, und ich fing an, mit dem Gedanken zu spielen, gar nicht wieder heimzukehren, in die weite Welt hinauszugehen, irgendwo im Dunkel unterzutauchen, in einem Dunkel, in dem man auch untergehen konnte – ohne Nachricht, ohne letzten Ruf. Und während ich mir das alles – in leichter Rührung über mich selbst – ausmalte, wusste ich doch, dass ich mir etwas vorlog, nie würde ich den Mut haben, ohne Zureden, ohne die Geborgenheit des heimischen Herdes zu leben. Nie würde ich auf das gewohnte weiche Bett verzichten können, die Ordnung des Heims, die pünktlichen nahrhaften Mahlzeiten! Ich würde heimkehren zu Magda, all meinen Ängsten zum Trotz, diese Nacht noch würde ich heimkehren, in mein gewohntes Bett – nichts da von einem Leben draußen im Dunkel, von einem Leben und einem Sterben in der Gosse! – ‚Aber’, sagte ich mir dann wieder und beschleunigte meine eiligen Schritte noch, ‚aber was ist denn eigentlich los mit mir? Ich bin doch früher ein leidlich tatkräftiger und unternehmungslustiger Mensch gewesen. Ein wenig schwach war ich stets, aber das habe ich so gut zu verbergen gewusst, dass es bis heute wohl nicht einmal Magda gemerkt hat; woher kommt die Schlaffheit, die mich seit einem Jahr immer stärker befällt, die mir Glieder und Hirn lähmt, die aus mir, einem immer leidlich anständigen Menschen, einen Betrüger an seiner Frau macht, der den Busen seines Hausmädchens mit befriedigter Lüsternheit betrachtet! Der Alkohol kann es nicht sein, ich trinke ja erst seit heute Schnaps, und die Schlaffheit liegt schon so lange über mir. Was ist es nur?’ – Ich riet hin und her. Ich dachte daran, dass ich soeben die Vierzig überschritten hatte; ich hatte einmal etwas von den ‚Wechseljahren des Mannes’ reden hören – aber ich wusste von keinem Mann meiner Bekanntschaft, der beim Überschreiten der Vierzig sich so verändert hatte wie ich mich. Dann fiel mir mein liebloses Dasein ein. Ich hatte immer nach Anerkennung und Liebe gedürstet, in aller gebotenen Heimlichkeit natürlich, und ich hatte sie in einem reichen Maße gefunden, sowohl bei Magda wie bei meinen Mitbürgern. Und nun hatte ich sie allmählich verloren. Ich wusste selbst nicht, wie das alles gekommen war. Hatte ich diese Liebe und diese Anerkennung verloren, weil ich schlecht geworden war, oder war ich schlecht geworden, weil mir diese Aufmunterungen gefehlt hatten? Ich fand auf alle diese Fragen keine Antwort: ich war es nicht gewöhnt, über mich nachzudenken. Ich ging immer schneller, ich wollte endlich dorthin kommen, wo es Frieden vor diesen quälenden Fragen gab. Endlich stand ich wieder vor meinem Ziel, vor demselben Dorfgasthaus, das ich an diesem verhängnisvollen Vormittag aufgesucht hatte; ich sah durch die Fenster der Wirtsstube nach jenem Mädchen mit den blassen Augen aus, das mein Mannestum nach einem schamlosen Blick so gering eingeschätzt hatte. Ich sah es sitzen unter dem trüben Schein einer einzigen kleinen Glühbirne, mit irgendeiner Näherei beschäftigt, ich sah es lange an, ich zögerte, und ich fragte mich, warum ich gerade es aufgesucht hatte, in einem Gefühl schmerzender, mit Wollust erfüllter Selbsterniedrigung. Und auch auf diese Frage fand ich keine Antwort.
Aber ich war all dieses Fragens müde, ich lief fast den Plattenweg zum Gasthof hinauf, tastete im dunklen Flur nach der Klinke, trat rasch ein, rief mit verstellter Munterkeit:
„Da bin ich, mein schönes Kind!“ und warf mich in einen Korbsessel neben sie. All das, was ich eben getan hatte, glich so wenig dem, was ich sonst zu tun pflegte, wich so sehr von meiner früheren Gesetztheit, meinem gemessenen Benehmen ab, dass ich mir selbst mit einem unverhohlenen Staunen zuschaute, ja, mit einer fast ängstlichen Betretenheit, wie man vielleicht einem Schauspieler zuschaut, der eine sehr gewagte Rolle übernommen hat, von der ganz und gar nicht sicher ist, dass er sie auch überzeugend zu Ende spielen kann.
Das Mädchen sah von seiner Näherei auf, einen Augenblick waren die hellen Augen auf mich gerichtet, die Spitze ihrer Zunge erschien rasch im Mundwinkel. „Ach, Sie sind es!“ sagte es dann bloß, und in diesen vier Wörtchen lag wiederum ihr Urteil über meine Person.
„Ja, ich bin es, meine Holde!“ sagte ich eilig mit jener mir so fremden Zungengeläufigkeit und Anmaßung. „Und ich möchte gerne wieder eins oder zwei oder auch fünf Ihrer so vorzüglichen Stängchen trinken, und wenn Sie es mögen, trinken Sie mit mir.“
„Ich trinke nie Schnaps“, sagte das Mädchen mit kühler Abwehr, stand aber auf, ging an die Theke, holte ein kleines Glas und eine Flasche und schenkte mir am Tisch ein. Sie setzte sich und stellte die Flasche auf den Boden neben sich.
„Übrigens“, sagte sie dann, ihre Näherei wieder aufnehmend, „schließen wir in einer Viertelstunde.“
„Umso schneller werde ich trinken“, sagte ich, setzte das Glas an und trank es aus. „Wenn Sie aber keinen Schnaps trinken“, fuhr ich fort, „so will ich auch gerne eine Flasche Wein oder auch Sekt, wenn es so etwas hier gibt, für Sie bezahlen. Es soll mir nicht darauf ankommen.“
Sie hatte unterdes mein Glas wieder gefüllt, und wieder leerte ich es auf einen Zug. Schon hatte ich alles Vergangene und vor mir Liegende vergessen, ich lebte nur dieser Minute, diesem spröden und doch wissenden Mädchen, das mich mit so offenkundiger Verachtung behandelte. „Sekt haben wir schon“, sagte sie, „und ich trinke ihn auch gerne. Ich mache Sie aber darauf aufmerksam, dass ich mich weder betrinken werde, noch wegen einer Flasche Sekt ins Bett bringen lasse.“
Jetzt sah sie mich wieder an, mit einem vollen schamlosen Blick begleitete sie ihre schamlosen Worte. Ich musste meine Rolle weiterspielen: „Wer denkt an so etwas, meine Hübsche?“ rief ich unbekümmert. „Holen Sie sich Ihren Sekt. Sie sollen ihn unbelästigt in meiner Gegenwart austrinken dürfen. Sie sind“, sagte ich stärker, nachdem ich wieder getrunken hatte, „für mich wie ein Engel von einem anderen Stern, ein böser Engel, den mir mein Schicksal in den Weg gesandt hat. Es genügt mir, Sie anzusehen.“
„Anschauen kostet nichts“, sagte sie mit einem kurzen Auflachen, das böse klang, „Sie sind mir ein seltsamer Heiliger, aber ich denke, ich erfahre noch heute Abend, warum Sie so – aufgeregt sind.“
Damit schenkte sie mir wieder ein und stand auf, den Sekt zu holen. Diesmal blieb sie länger fort. Sie zog die Vorhänge vor die Fenster, dann ging sie aus dem Hause, und ich hörte sie die Läden, dann die Haustür schließen. Während sie wieder durch die Gaststube ging, sagte sie im Vorübergehen zu mir: „Ich habe schon geschlossen, es kommt doch keiner mehr. Und die Wirtsleute liegen auch schon im Bett.“ Dies sagte sie im Vorübergehen, blieb dann stehen und sagte mit spöttischer Betonung: „Aber deswegen brauchen Sie sich keine Hoffnungen zu machen!“ Ehe ich noch antworten konnte, war sie wieder gegangen. Ich benützte die Zeit ihrer Abwesenheit, mir ganz schnell zwei, drei Gläser hintereinander aus der Flasche einzuschenken. Dann kam sie zurück, mit einer goldgeköpften Flasche in der Hand.
Sie stellte ein Spitzglas vor sich auf den Tisch, löste den Draht geschickt mit einigen Biegungen und drehte den Korken aus der Flasche, ohne es knallen zu lassen. Der weiße Schaum troff über den Rand, sie goss rasch ein, wartete einen Augenblick und goss wieder ein. Dann hob sie das Glas zum Mund.
„Ich trinke nicht auf Ihr Wohl“, sagte sie, „denn dann möchten Sie mit mir anstoßen, und für den Augenblick haben Sie genug getrunken.“
Ich widersprach ihr nicht. Mein ganzer Körper war tatsächlich so von Trunkenheit erfüllt, dass sie wie ein schwärmendes Bienenvolk in ihm zu summen schien: keine Stelle war frei von ihr. Sie setzte das Glas ab, sah mich mit eingekniffenen Augen an und fragte spöttisch: „Nun, wie viele Schnäpse haben Sie sich in meiner Abwesenheit eingeschenkt? Fünf? Sechs?“
„Nur drei!“ antwortete ich und lachte. Ich kam überhaupt nicht auf die Idee, mich zu schämen, vor diesem Mädchen vergingen einem solche Gefühle vollständig.
„Wie heißt du übrigens?“
„Willst du öfter kommen?“ fragte sie dagegen.
„Vielleicht“, antwortete ich etwas verwirrt. „Wieso –?“
„Wozu willst du sonst meinen Namen wissen? Für die halbe Stunde, die wir hier noch sitzen, reicht ‚kleine Hübsche’ oder wie du sonst sagst, vollkommen ...“
„Also sag deinen Namen nicht“, rief ich, plötzlich gereizt.
„Wie egal mir das ist!“
Ich griff zur Flasche und schenkte mir wieder ein. Schon jetzt war mir klar, dass ich völlig betrunken war und dass ich nicht mehr weitertrinken durfte. Dennoch blieb der Hang weiterzutrinken stärker. Das farbige Gespinst in meinem Hirn verlockte mich, die nie betretenen dunklen Dickichte in meinem Innern reizten meinen Fuß; ferne rief leise nach mir eine Stimme, ich wusste nicht was, jedenfalls Lockung ...
„Ich weiß nicht, ob ich öfter hierherkommen werde“, sagte ich hastig. „Ich kann dich nicht ausstehen, ich hasse dich, und trotzdem bin ich heute Abend zu dir zurückgekehrt. Heute früh habe ich den ersten Schnaps meines Lebens getrunken, du hast ihn mir eingeschenkt, du hast dich mit ihm eingeschlichen in mein Blut, vergiftet hast du mich! Du bist wie der Geist des Schnapses: schwebend, trunken machend, feil ...“
Ich sah sie an, atemlos, selbst am meisten überrascht von diesen Worten, die aus mir sich hinausschleuderten, ich wusste nicht woher ... Sie saß mir gegenüber. Ihre Näherei hatte sie nicht wieder aufgenommen. Die Beine ohne Strümpfe in roten Schuhen hatte sie übergeschlagen, und den Rock ein wenig von den Knien zurückgeschoben. Die Beine waren etwas derb, aber lang und schön gefesselt. An der rechten Wade sah ich ein fast pfenniggroßes, braunes Muttermal – das schien mir schön. In der Hand hielt sie eine Zigarette, sie blies den Rauch breit durch die fast geschlossenen Lippen, ohne Zwinkern sah sie mich an.
„Nur weiter, Väterchen“, sagte sie, „du entwickelst dich ... nur weiter ...“
Ich versuchte nachzudenken. Wovon hatte ich eben noch geredet? Das Verlangen, sie zu umarmen, sie zu betasten, wurde fast übermächtig in mir. Aber ich lehnte mich fest in meinen Korbsessel zurück, ich klammerte mich mit meinen Händen an die Lehne. Plötzlich hörte ich mich dann wieder sprechen. Ich sprach ganz langsam und sehr deutlich, und doch war ich atemlos vor Erregung. „Ich bin ein Kaufmann“, hörte ich mich sagen. „Ich hatte ein recht gutes Geschäft, aber jetzt stehe ich vor dem Bankrott. Sie werden mich auslachen, alle, alle, meine Frau zuerst ... Ich habe viele Fehler gemacht, Magda wird sie mir alle vorhalten. Du weißt doch, Magda ist meine Frau ...?“
Sie sah mich unverwandt an, mit ihrem sehr weißen, wie gepuderten Gesicht, das etwas Gedunsenes hatte; hoch und gewölbt standen in ihm über den fast farblosen Augen die dunklen Brauen.
„Aber ich kann noch Geld herausziehen, aus dem Geschäft, ein paar tausend Mark. Ich täte es schon, um Magda zu ärgern. Magda will das Geschäft retten. Ist sie mehr als ich? Ich könnte das Geschäft verkaufen, ich weiß auch schon an wen, es ist eine ganz junge Firma. Er würde mir zehn-, vielleicht auch zwölftausend Mark dafür geben, wir würden auf Reisen gehen ... Warst du schon einmal in Paris?“
Sie sah mich an, keine Zustimmung oder Verneinung war auf ihrem Gesicht zu lesen. Ich redete weiter, schneller, atemloser. „Ich war auch noch nicht dort“, fuhr ich fort, „aber ich habe davon gelesen. Es ist die Stadt der baumbestandenen Boulevards, der weiten Plätze, der laubigen Parks ... Als Junge habe ich ein bisschen Französisch gelernt, aber ich kam zu früh von der Schule, die Eltern hatten nicht Geld genug. Weißt du, was das heißt: ‚Donnez-moi un baiser, mademoiselle’?“
Kein Zeichen von ihr, nicht ja, nicht nein.
„Es heißt: ‚Geben Sie mir einen Kuss, mein Fräulein.’ Aber zu dir müsste man sagen: Donnez-moi un baiser, ma reine! Reine, das heißt Königin, und du bist die Königin meines Herzens, du bist die Königin des Giftes, das in Flaschen verkorkt wird, gib mir deine Hand, Elsabe – ich werde dich Elsabe nennen, Königin – ich will deine Hand küssen ...“
Sie goss mir das Glas voll.
„Da, trink das noch, und dann gehst du nach Hause. Genug – du hast genug getrunken, und ich habe genug von dir. Du kannst die Flasche Korn mitnehmen, du musst die ganze Flasche bezahlen, zum Gaststubenpreis. Das ist kein Nepp, komm mir morgen nicht, dass ich dich geneppt habe; du hast dir selber eingeschenkt, ich weiß nicht, wie viel ...“
„Rede nicht, Elsabe“, sagte ich prahlerisch-weinerlich. „Nie würde ich so etwas tun! Was ist Geld –!“
„Lehre du mich die Männer kennen! Wenn ihr voll und geil seid, schreit ihr: ‚Was ist Geld?’ Und am nächsten Morgen kommt ihr mit dem Gendarmen und schreit von Nepp. Der Korn und der Sekt und meine Zigaretten – das macht zusammen ...“
Sie nannte eine Summe.
„Wenn es nicht mehr ist!“ rief ich wieder prahlerisch und meine Brieftasche hervor. „Hier hast du –!“
Ich legte ihr das Geld hin.
„Und hier ...“, ich nahm einen Hundertmarkschein und legte ihn daneben, „der ist für dich, weil ich dich hasse und weil du mich vernichtest. Nimm ihn, nimm ihn schon. Ich will nichts von dir, gar nichts! Geh. Ich habe dich schon so im Blut, ich kann dich nie mehr besitzen, als ich dich in mir habe. Wahrscheinlich bist du öde und langweilig, du bist nicht von hier, natürlich aus irgendeiner Großstadt, wo du alles gelassen hast – das sind ja nur Reste!“
Wir standen uns gegenüber, das Geld lag auf dem Tisch, das Licht war düster. Ich schwankte leise über meinen Füßen, die fast halb geleerte Kornflasche hielt ich am Halse in meiner Hand. Sie sah mich an.
„Steck dein Geld ein!“ sagte sie flüsternd. „Nimm dein Geld vom Tisch ... Ich will dein Geld nicht ... Geh ...“
„Du kannst mich nicht zwingen, das Geld wieder zu nehmen, ich lasse es liegen ... Ich beschenke dich, Königin des klaren Korns, Elsabe genannt, ich gehe ...“
Ich ging mühsam auf die Tür zu, der Schlüssel steckte von innen, ich mühte mich, ihn im Schloss zu drehen...
„Du“, sprach sie dicht hinter mir, „du ...“
Ich drehte mich um. Ihre Stimme war leise gewesen, aber voll und sanft, alles Spröde war aus ihr gewichen.
„Du ...“, wiederholte sie, und in ihren Augen war jetzt Farbe und Licht, „du – willst du?“
Jetzt war ich es, der sie nur schweigend ansah.
„Zieh deine Schuhe aus, sei leise auf der Treppe, die Wirtsleute dürfen dich nicht hören. Komm, mach schnell ...“
Schweigend tat ich, wie sie mir geheißen. Ich wusste nicht, warum ich es tat. Ich begehrte sie jetzt nicht, so begehrte ich sie nicht.
„Gib mir die Hand!“
Sie knipste das Licht aus und führte mich an der einen Hand, in der anderen Hand hielt ich noch immer die Kornflasche. In der Schankstube war es völlig dunkel, ich schlich ihr nach. Durch ein kleines staubiges Fenster fiel auf die verwinkelte enge Stiege Licht vom Mond. Ich schwankte, ich war sehr müde. Ich dachte an mein Bett daheim, an Elsabe, voller Wünsche an den weiten Weg nach Haus.
Es war alles zu viel. Der einzige Trost war die Flasche Korn in meiner Hand, sie würde mir Kraft spenden. Am liebsten wäre ich stehen geblieben und hätte schon jetzt einen Schluck aus der Flasche genommen, so müde war ich. Die Stufen knarrten, die Tür zur Kammer ächzte leise, als sie geöffnet wurde. Auch in der Kammer war Mondschein. Ein Bett, das zerwühlt war, ein eiserner Waschständer, ein Stuhl, ein Kleiderrechen an der Wand ...
„Zieh dich aus“, sagte ich leise, „ich komme dann gleich.“ Und mehr zu mir: „Gibt es hier Sterne?“
Ich trat ans Fenster, das den Blick in einen Obstgarten freigab. Ich öffnete einen Flügel; lau wie eine zarte Liebkosung kam die Frühlingsluft herein, voll von Düften und sanftem Wind. Unter dem Fenster lag das schräge Teerdach eines Schuppens.
„Das ist gut“, sagte ich wieder leise, „dieses schräge Dach ist sehr gut ...“
Ich konnte den Mond nicht sehen, er stand hinter dem Hausdach mir zu Häupten. Aber sein Licht erfüllte mit einem weißlichen Schein den Himmel, nur die stärksten Sterne waren zu sehen und auch sie nur matt. Ich war unzufrieden und gereizt.
„Komm schon“, rief sie ärgerlich vom Bett her. „Mach ein bisschen schnell! Denkst du, ich brauch keinen Schlaf?!“ Ich drehte mich um, ich neigte mich über das Bett. Sie lag auf dem Rücken, bis zum Halse zugedeckt. Ich streifte die Decke zurück und legte einen Augenblick mein Gesicht gegen ihre nackte Brust. Kühl und fest. Sachte atmend, kühl und fest. Es roch gut – nach Haar und Fleisch.
„Mach doch zu!“ flüsterte sie ungeduldig. „Zieh dich aus – lass den Unsinn! Du bist doch kein Schüler mehr!“
Mit einem tiefen Seufzer richtete ich mich auf. Ich ging an das Fenster, nahm die Flasche und schwang mich hinaus auf das Schuppendach. Ich hörte einen ärgerlichen zornigen Ruf hinter mir. Aber ich ließ mich schon hinab in den Garten.
„Besoffener alter Trottel!“ rief sie oben, dann schlug das Fenster zu.
Ich stand zwischen Büschen, ich roch den Duft des Flieders. Die Frühlingsnacht war ganz rein. Ich setzte die Flasche an den Mund und trank lange –.
* * *