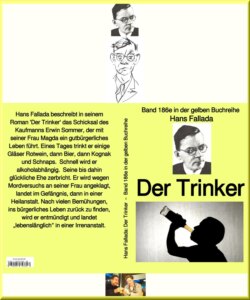Читать книгу Hans Fallada: Der Trinker – Band 186e in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski - Ханс Фаллада - Страница 15
Kapitel elf
ОглавлениеKapitel elf
Ich war auch fest entschlossen, so bald nicht wieder dorthin zurückzukehren. Mochte sie ruhig eine Weile dort allein weiterwursteln, ich machte ihnen ja doch nichts zu Dank. Der ganze Kram langweilte mich schon lange, jetzt hatte ich eine bessere und interessantere Aufgabe gefunden, die meiner augenblicklichen Stimmung viel mehr entsprach: mein Kampf gegen Magda! Sie sollte sich nur an mir versuchen, es würde mir direkt Spaß machen, ihr zu beweisen, wie viel klüger und gesetzeskundiger ich war als sie!
Ich war wieder auf der Wanderung, meine Aktentasche unterm Arm, durch einen schönen, aber schon recht heißen Tag am Ausgang des Frühlings. Die Königin des Alkohols – ich hatte sie viel zu lange vergessen. Langweilig war die jedenfalls nicht. Außerdem musste ich mir endlich meine Schuhe wiederholen, niemand sollte mir nachsagen können, dass ich in der Trunkenheit meine Kleidung durch halb Europa verstreute. Niemand, nicht einmal Magda. Es war ja so ziemlich klar, was diese tüchtige Dame, mit der ich bisher verheiratet gewesen war, beabsichtigte. Scheidung, nun schön, aber Scheidung ging nicht so schnell; vor einer Scheidung mussten auch erst einige Vorbereitungen getroffen werden, z. B. eine Untersuchung durch den Arzt. Magda stand sich sehr gut mit Doktor Mansfeld, schon seit vielen Jahren. Er hatte sie immer behandelt, wenn sie krank gewesen war, ich kannte ihn weniger, mir hatte eigentlich noch nie etwas gefehlt. Sie würde ihn schon zu ihrer Auffassung überreden, und dann sollte vermutlich so etwas kommen wie Entmündigung und Unterbringung in einer Trinkerheilstätte. Das würde ihr so passen, der guten Magda: der Mann sitzt in einer Anstalt, natürlich möglichst dritter Klasse, und sie wirtschaftet in und mit seinem Eigentum, leitet die Firma. Aber es gab andere Ärzte, berühmtere und tüchtigere als der gute alte Doktor Mansfeld, der schließlich und endlich nur ein einfacher praktischer Arzt war; gleich in den nächsten Tagen schon würde ich zu einem oder mehreren von ihnen gehen und mir Atteste über meine völlige Gesundheit geben lassen. Mit einem solchen Ziel vor Augen würde es leicht sein, ein oder zwei Tage vor dem Arztbesuch überhaupt nichts zu trinken. Sie würde schon sehen, mit wem sie da angefangen hatte, die gute Magda; trotz fünfzehn Jahre Ehe kannte sie ihren Mann noch lange nicht! Jedenfalls: Ehe ich ihr mein Eigentum überließ, steckte ich ihr lieber die Villa über dem Kopf an, das war klar.
So etwa gingen meine Meditationen während meines Weges in jenen Dorfgasthof, und das Ausmalen bis in alle Details hinein kürzte mir die Zeit auf das Angenehmste. Ich konnte z. B. lange dabei verweilen, wie ich in irgendeiner Zelle der Trinkerheilanstalt mit eiskaltem Wasser geängstigt und mit schlechtem Essen gefüttert wurde, während Magda in unserem hübschen Speisezimmer ein Kalbskotelett mit Stangenspargel aß. Dann kamen mir fast die Tränen der Rührung über mein schlimmes Los und Magdas Ungerechtigkeit in die Augen. Zwischendurch verfütterte ich, da ich wie meist in der letzten Zeit nicht den geringsten Hunger verspürte, mein Frühstücksbrot an dörfliche Enten und Gänse, tauchte auch von Zeit zu Zeit hinter einer Hecke vor aller Sicht unter und nahm einen Schluck.
Ich verlor nie ganz ein leises Gefühl der Beschämung darüber, dass ich, Erwin Sommer, mich hinter einer Hecke versteckte, einen Flaschenhals an den Mund setzte und Schnaps in mich hineinlaufen ließ wie der letzte Walzenbruder.
Es wurde mir nicht selbstverständlich, dagegen stumpfte ich nicht völlig ab. Doch es musste nun einmal sein, es ging eben nicht anders.
Kurz vor meinem Ziel war ich mit meiner Flasche alle, ich warf sie in den Straßengraben und machte mich an die letzten fünf Minuten Weg. Vom Kirchturm des Dorfes läutete es gerade zur Mittagsstunde; vor mir, an mir vorbei, mir nach zogen die Dörfler, die vom Felde kamen, Hacken und Spaten auf der Schulter. Manche grüßten mich, andere sahen mich nur musternd von der Seite an, wieder andere schließlich stießen sich an, verzogen die Gesichter und lachten, während sie an mir vorbeigingen. Es mochte ja nur die übliche dörfliche kritische Einstellung dem stadtfein angezogenen Fremden gegenüber sein, ich hatte aber doch den Argwohn, dass mir vielleicht etwas von meinem Alkoholgenuss anzumerken oder etwas an meiner Kleidung nicht in Ordnung sei. Ich hatte es schon erfahren, dass eine der schlimmsten Gaben, die der Alkohol mit sich bringt, dieses Unsicherheitsgefühl ist, ob irgendetwas an einem nicht ganz stimmt. Man kann sich noch so oft im Spiegel mustern, die Kleidung ablesen, jeden Knopf nachprüfen – nie, wenn man etwas getrunken hat, ist man ganz sicher, dass man nicht doch etwas übersehen hat, etwas ganz offen zutage Liegendes, das man aber doch trotz gespanntester Aufmerksamkeit immer wieder übersieht. Im Traum hat man ganz ähnliche Gefühle, bewegt sich heiter in der gewähltesten Gesellschaft und entdeckt plötzlich, dass man vergessen hat, seine Hosen anzuziehen. Also: Dieses Angestarrtwerden wurde mir lästig, zudem fiel mir ein, dass gerade die lebhafte Mittagsstunde nicht die richtige Zeit sein würde, meine Hübsche aufzusuchen; ich schlug einen seitab führenden Feldweg ein und warf mich unter einem schattenden Gebüsch ins Gras. Sofort verfiel ich in Schlaf, in jenen tiefschwarzen Schlaf, den der Alkohol bringt, wobei man gewissermaßen ausgelöscht ist, einen befristeten Tod stirbt. Keine Träume gibt es da mehr, keine Ahnung von Licht und Leben – fort ins Nichts! Das ist es. –
Als ich wieder erwachte, stand die Sonne schon tief, ich musste vier, vielleicht sogar fünf Stunden geschlafen haben. Wie immer in dieser Zeit hatte mich der Schlaf gar nicht erfrischt, ich erwachte alt und müde, ein zittriges Gefühl in den Gliedern. Meine Knochen waren steif, als ich mich aufrichtete; und mit dem Gehen kam ich nur schwer zurecht. Ich wusste aber jetzt schon, dass das alles mit den ersten Schnäpsen, die ich zu mir nahm, sich rasch geben würde, und beeilte mich darum, in den Gasthof zu kommen.
Ich hatte die Stunde gut gewählt: wieder einmal war die Schankstube leer, auch hinter der Theke stand niemand. Steif ließ ich mich in einen Korbsessel fallen und hallote durstig nach der Bedienung. Erst steckte sich ein Mädchenkopf durch die Türspalte, es war aber nicht meine blasse Hübsche, sondern ein zottliges, rotnasiges Wesen älterer Machart, dann sah eine dicke Frau zu mir hin, rief: „Gleich! Gleich!“ und öffnete die Treppentür, die ich in jener Nacht, blind an der Hand geführt, hinaufgestiegen war.
„Elinor! Elinor! Komm runter!“ rief die Wirtin, versicherte mir noch einmal, dass ich gleich bedient werden würde, und verschwand wieder in der Küche. Also Elinor hieß sie, da hatte ich mit Elsabe nicht ganz schlecht geraten. Aber Elinor war auch sehr gut, war eigentlich noch besser. Elinor passte zu ihr, Elinor, la reine d'alcool, wirklich sehr hübsch!
Und da hörte ich sie auch schon die Treppe herunterkommen; gar nicht rehfüßig übrigens; die Tür klappte, und sie trat ein. Sie hatte sichtlich geschlafen, das Haar war nicht so glatt und ordentlich aufgesteckt wie sonst, und ihr helles Kleid hatte etwas Zerdrücktes, Unordentliches. Sie stand da einen Augenblick und sah zu mir herüber. Sie erkannte mich nicht gleich, sie musste gegen die Sonne blicken. Dann rief sie ganz vergnügt: „Ach, das ist ja nur das Väterchen, das so gerne Schnaps trinkt!“ rief's und lief schon wieder die Treppe hinauf. Ich nahm ihr die neuerlichen, für meinen Durst eigentlich schmerzlichen Worte gar nicht übel. War ich doch nur froh über diesen unbefangenen Empfang. Ein bisschen hatte ich mich doch gefragt, wie sie mich nach meinem Abgang über das Schuppendach in jener Nacht aufnehmen würde. Nun aber war alles gut, und ich wartete mit Geduld die fünf Minuten, bis sie, nunmehr geschniegelt und glatt, wieder auftauchte. Sie kam gleich an meinen Tisch, bot mir wie einem alten Freund die Hand und sagte freundlich: „Ich dachte schon, Sie wollten gar nicht mehr wiederkommen! Was haben Sie denn so lange gemacht? Sind Sie nun schon ganz bankrott?“
„Noch nicht, ma reine“, sagte ich, auch lächelnd. „Vorläufig habe ich erst einmal das Geschäft meiner Frau übertragen, mit der ich übrigens in Scheidung liege. Was meinst du dazu, meine Hübsche? In acht Wochen bin ich vielleicht schon zu haben! Noch ganz gut erhalten, wie?“
Sie sah mich einen Augenblick an, dann verschwand das Lächeln von ihrem Gesicht, und sie sagte ganz kühl und geschäftsmäßig: „Einen Korn, nicht wahr? Oder gleich wieder eine ganze Flasche, wie?“
„Richtig, meine Goldene!“ rief ich. „Gleich wieder eine ganze Flasche! Und für dich wiederum eine Flasche Sekt!“
„Nicht am Tage“, antwortete sie kurz und ging. Einen Augenblick später hatte ich zu trinken, ausgiebig, von diesem wasserhellen Stoff, den ich schon mehr liebte als den Kognak. Aber sonst kam ich an diesem Nachmittag nicht auf meine Kosten. Elinor war ständig beschäftigt, in und außer der Gaststube, und wir konnten nur dann und wann ein paar Worte wechseln. Darüber verdrossen trank ich mehr als gewohnt, schon nach anderthalb Stunden musste mir Elinor eine zweite Flasche bringen, und ich spürte selbst, dass ich schwer berauscht war. Dann kamen ein paar junge Burschen, darunter auch jener junge Maurer, mit dem Elinor so vertraut gesprochen hatte; und bloß um das Mädchen an meinen Tisch zu ziehen (was aber auch nur für fünf Minuten gelang), ließ ich sie alle bei mir Platz nehmen und bestellte für jeden, was er sich wünschte. Schon nach kurzer Zeit bot mein Tisch einen wilden Anblick. Bier- und Schnapsgläser, Wein- und Sektflaschen standen in einem wilden Durcheinander auf ihm, und um ihn gruppierte sich eine Rotte wild durcheinander redender, schreiender, lachender, fuchtelnder Gestalten, und ich war eine der wildesten und betrunkensten von allen. Ich fühlte mich ganz losgelassen, ich war wirklich wie ein Stein, der in den Abgrund stürzt – ich dachte an nichts mehr.
Bei unserem Lärmen hatten wir es ganz überhört, dass ein Auto vorgefahren war, und auch als zwei Herren eintraten, achteten wir kaum auf sie. Ich schrie einem Gegenüber, der gar nicht auf mich hörte, wieder irgendwelche Beteuerungen zu – und verstummte plötzlich, wie auf den Mund geschlagen, denn einer der beiden Herren, die jetzt an einem Nebentisch Platz nahmen, hatte mich mit einem freundlichen ‚Guten Abend!’ begrüßt, und dieser Herr war Doktor Mansfeld. Den anderen Herrn kannte ich nicht. Auch meine Zechkumpane verstummten; und auch, als sie sahen, dass nichts weiter erfolgte, sondern dass die Herren am Nebentisch, in ein Gespräch vertieft, ruhig ihr Bier tranken, kam die alte Lustigkeit nicht wieder auf. Einer nach dem anderen verdrückte sich, schließlich saß ich allein in diesem wüsten Tohuwabohu von Gläsern und Flaschen, und auch nach Elinor sah ich vergeblich aus: sie kam nicht, das Chaos zu ordnen. Wahrscheinlich scharmutzierte sie mit dem jungen Maurer, der wohl ihr Galan war, vor der Tür. Nach der wilden Ausgelassenheit eben hatte mich finstere Verdrossenheit überfallen, ich kaute auf meiner Lippe und schoss ab und zu einen argwöhnischen Blick nach dem Seitentisch, an dem man so gar keine Notiz von mir nahm. Mein Argwohn war erwacht; ich fragte mich, ob Doktor Mansfeld durch einen reinen Zufall, bei der Ausübung seiner Landpraxis, hierher geraten sein könnte oder ob ihn Magda hierher beordert hatte. Ich zergrübelte meinen Kopf, ob ich etwa Magda damals in meiner Betrunkenheit den Namen des Ausflugsortes genannt, oder doch so auf ihn hingedeutet hatte, dass er unschwer zu erraten war – ich wusste es nicht mehr. Der zweite Herr kam mir bekannt vor, aber ich wusste nicht, wohin ich ihn tun sollte...
Wieder hätte ich gerne etwas getrunken, die Kornflasche stand nahe genug vor mir, und doch wagte ich es nicht, vor den beiden Gästen am Nebentisch mir das Glas auch nur einmal vollzuschenken. Ich sagte mir wohl, dass angesichts dieses Tisches und meines wilden Benehmens vorhin nicht mehr das Geringste zu verderben war, und doch wagte ich es nicht –.
Schließlich betrat Elinor wieder den Schankraum. Ich rief sie zu mir und bat sie leise, die Zeche zu machen. Während sie auf einem Block viele Zahlen aufschrieb, gebückt vor mir stehend und mich dadurch gegen die Sicht vom Nebentisch deckend, schenkte ich mir erst zwei, drei Schnäpse ein. Dann verkorkte ich die Flasche sorgfältig und schob sie in meine Aktentasche. Elinor warf einen raschen Blick auf mein Tun und flüsterte mit hochgezogenen Augenbrauen, zum Nebentisch deutend: „Freunde?“ Ich zuckte nur die Achseln. Die Rechnung war so hoch, dass ich mein Geld wirklich bis auf die letzte Mark hergeben musste und dass auch dann noch das Trinkgeld für Elinor höchst ungenügend ausgefallen war. Wieder sah sie mich mit hochgezogenen Augenbrauen an und flüsterte: „Abgebrannt?“
Ich antwortete ebenso leise: „Ich weiß, wo es mehr gibt. Das nächste Mal, ma reine!“ Wozu sie leicht nickte.
Ich musste jetzt aufstehen und gehen, unter den beobachtenden Blicken des Nebentisches. Ich fasste meine Aktentasche und vergewisserte mich durch einen musternden Blick, auf welchem Haken mein Hut hing, damit ich ihn beim Hinausgehen nicht unnötig suchen musste, und stand auf. Ich fühlte, es würde gehen. Ich musste mich langsam und sehr vorsichtig bewegen, dann würde es schon gehen. Schließlich brauchte ich nur vors Dorf und ins erste bergende Gebüsch zu kommen, ja, schließlich – genialer Einfall: – Ich brauchte mich nur hier auf der Toilette einzuriegeln, und ich konnte schlafen, solange ich wollte. Frischen Proviant habe ich ja bei mir.
Ich hatte zum Nebentisch, schon im Aufstehen, höflich ‚Guten Abend’ gesagt, und nun war ich schon unter der Tür, einen Schritt entfernt von der Rettung, als hinter mir eine Stimme sagte: „Ach, einen Augenblick, Herr Sommer!“
Ich schrak so zusammen, dass ich fast gefallen wäre. „Wie bitte?“ rief ich unnötig laut. Der Arzt hatte nach meinem Arm gegriffen und mich gehalten.
„Habe ich Sie erschreckt? Das wollte ich nicht. Es tut mir leid.“
„Ach, nichts, nichts“, sagte ich verlegen. „Es war wohl nur der elende Läufer, ich bin über ihn gestolpert ...“ Und ich sah böse auf den glatt daliegenden Teppich.
„Ich wollte Sie nur fragen, Herr Sommer“, fing Doktor Mansfeld wieder an, „ob ich Ihnen vielleicht anbieten darf, in meinem Auto mit uns heimzufahren?“
Er machte eine Pause, dann sagte er lachend: „Wir haben ein bisschen gefeiert, nicht wahr? Nun, das macht nichts, das tut jeder von uns einmal gerne. Aber der Rückweg würde Ihnen vielleicht ein bisschen schwerfallen, was? Also, Sie fahren mit uns.“
Er fasste mich freundlich, aber fest unter den Arm. Der andere Herr hatte unterdes bezahlt und trat nun zu uns. „Darf ich Sie bekannt machen?“ fuhr der Arzt fort. „Herr Sommer – Herr Medizinalrat Doktor Stiebing, unser Kreisarzt.“
Damit führte er mich aus dem Lokal und auf das Auto zu. Ich aber folgte ihm wie ein Schaf seinem Schlächter. Der Kreisarzt!
Das war kein Zufall mehr, das war eine mir listig gestellte Falle! Verdammte Magda! Sie wollte mich reinlegen, sie handelte schnell, das musste ich zugeben. Aber auch ich war klug, ich musste mich verstellen, listig sein, Scharfsinn mit Scharfsinn übertrumpfen.
„Nun“, lachte ich plötzlich heiter, „zwei Ärzte, die werden ja wohl mit einem armen Berauschten fertig werden, was? Machen Sie es gnädig mit mir, meine Herren!“ Damit setzte ich mich hinten in den Wagen, während die beiden anderen Herren, ebenfalls lachend, vorn Platz nahmen. Wir wollten schon losfahren, als Elinor aus dem Hause gelaufen kam. Sie trug in den Händen ein hässliches, in Zeitungspapier gewickeltes Paket, sie reichte es mir in den offenen Wagen. Laut sagte sie: „Das sind Ihre Schuhe, die Sie neulich nachts hier vergessen haben!“ Höhnisch lachend sah sie mich mit ihrem weißen, großen Gesicht und den farblosen Augen an. Ihr Mund war sehr rot.
Nach einem betretenen Schweigen fragte der Arzt: „Können wir jetzt fahren?“
Ich antwortete: „Ja“, und der Wagen fuhr los.
* * *