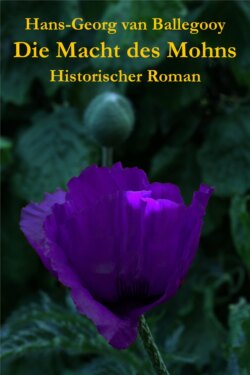Читать книгу Die Macht des Mohns - Hans-Georg van Ballegooy - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erster Teil: 1789 – 1795. Stürmische Zeiten
ОглавлениеEins
06. Januar 1789 – der Glocke Grabgesang
Wie im gesamten Hochstift Paderborn so erlebte man auch in der Residenzstadt Neuhaus mit Beginn des Jahres 1789 einen harten Winter. Stürmischer Wind hatte eisige Polarluft herangeführt. Schwer begehbar waren die wenigen schmalen Pfade durch hohe Schneewehen. Vor allem am Rande der Feldflur türmten sich die Schneeberge. Das Flüsschen Alme war bis zum Zusammenfluss mit der Lippe zugefroren.
Während im benachbarten Teil der alten Stadt die besser Betuchten in ihren repräsentativen Fachwerkbauten gewiss behaglicher wohnten, saß Johanna im Dämmerlicht ihrer Unterkunft, die eher einer Baracke glich als einer wohnlichen Kammer. Johanna zählte zu den heiratsfähigen jungen Frauen, die ihr Leben ohne Fürsorge durch ihre Eltern meistern mussten. Nicht nur das äußere Erscheinungsbild ihres Liebreizes, dem ihr Bewunderer bis zum letzten Herbst noch verfallen war, hatte sich gewandelt. Aus der fröhlichen und gutgläubigen jungen Frau, der man erneut in widerwärtiger Art ihre Zukunftsperspektive genommen hatte, war eine verbitterte, ängstliche Person geworden, die fast jegliche Anziehungskraft verloren hatte. Blass und fröstelnd hockte sie auf einem Schemel in der Nähe eines Sprossenfensters. Der spröde, rissige und verwitterte Holzrahmen war ein Abbild ihres seelischen Zustandes. Mürbe, geschunden und zerbrochen waren auch einige der Fensterscheiben, die notdürftig mit splitternden Brettern versehen worden waren. Die wenigen unversehrten Stellen des Fensterglases waren von trübem und kalt abweisendem Charakter. Hier sammelten sich Eiskristalle. Sie verhinderten, dass das Tageslicht klar und heiter in den Raum dringen konnte. Wenn die Kälte nicht gar so einschneidend und auch die jüngsten Erlebnisse nicht so enttäuschend gewesen wären, hätte sich Johanna gewiss an dem Bild der stetig wachsenden Eisblumen erfreuen können. Doch diesen Zauber zu genießen, dafür fehlte ihr in diesen Wochen der Sinn.
Auf dem Tischchen vor ihr lag ein Tagebuch. Schon eine gefühlte Ewigkeit lag es so da, aufgeschlagen, die Schreibfeder daneben. Der letzte mit Akribie gestaltete Eintrag war verunstaltet. Johannas Tränen hatten die Tinte verwässert; sie war an einigen Stellen auseinandergelaufen. Johanna hätte ihrem Tagebuch noch einiges anvertrauen wollen. Vorerst musste sie darauf verzichten.
In der Nähe der Schreibutensilien türmten sich schadhafte Kleidungsstücke. Sie warteten auf ihre Ausbesserung.
Die junge Frau hatte sich in eine Decke gehüllt. Sie wagte den neuerlichen Versuch, einen Faden durch ein Nadelöhr zu treiben. Doch die Kälte und das spärliche Licht ließen auch diesen Versuch scheitern. Die Decke rutschte von ihren Schultern. Sie rieb sich die Fingerspitzen und hauchte in ihre Hände, um sie aus ihrer Taubheit aufzuwecken. Dann klemmte sie sich die Hände unter ihre warmen Armbeugen. Wenig später erhob sie sich und schlug die Decke erneut um ihren Körper. Die Wolldecke kratzte auf ihrer Haut. Mit ihrem warmen Atem erzeugte sie ein Sichtloch in der vereisten Scheibe. Die Eisblumen veränderten ihre Gestalt; sie verloren ihren Reiz. Den angetauten Belag wischte Johanna weg, bevor die Feuchtigkeit erneut gefror. Sie warf einen kurzen Blick aus dem Fenster, aber sie schreckte zurück. Stirn und Nase hatten das eiskalte Fensterglas berührt.
Ein Seufzer der Verwunderung entglitt ihr, als sie die ungewöhnliche Schneemenge wahrnahm. Es musste in den letzten Stunden weiterhin intensiv geschneit haben. Eine Schneewehe langte inzwischen bis an den Fenstersims. Fast schien es, als wollte sie die Wand der Behausung eindrücken. Bibbernd wankte Johanna zur Tür, die sich nur einen Spalt weit öffnen ließ. Dort bot sich ein ähnliches Bild. Erst am Morgen hatte die geschwächte Frau den Eingang ein wenig freiräumen können. Mittlerweile war nicht nur das Verlassen des Hauses nahezu unmöglich. Vor allem war der Weg zu den Nachbarhäusern unbegehbar. Dort, so erkannte Johanna aus der Ferne, hatte jemand einen Zugang geschaffen. Natürlich. Nur zu gut war ihr bekannt, wer da wohnte. Auch wenn sich die Herrschaften noch keine Bediensteten halten konnten, so war es ihnen ein leichtes, für ein Almosen jemanden zu bestellen, der ihnen zur Hand ging oder die niederen Tätigkeiten erledigte. Aber bis hierher ... bis zu ihr ... bis zu ihrem Verschlag hielt es offensichtlich niemand für nötig, den Weg von den Schneemassen zu befreien. Mit Groll dachte sie an den Amtmann, der vermutlich froh war, dass sie nun von der Außenwelt abgeschnitten war. Und Wehmut überkam sie, als der Glasbläser vor ihrem inneren Auge erschien. Auch von ihm war sie etwas enttäuscht und fühlte sich gerade jetzt im Stich gelassen, da sie seiner Unterstützung so dringend bedurfte. Andererseits musste sie ihm dankbar sein, hatte er ihr doch erst zu dieser Bleibe verholfen.
Noch einmal blickte sie zum Nachbarhaus. Ein Anflug von Melancholie überkam sie, als sie dort zwei kleine Gestalten in ihrer dunklen Bekleidung zu erkennen glaubte.
»Elsbeth, weißt du, wo deine Schwester jetzt ist?«, fragte der knapp Siebenjährige, dessen abgetragene weite braune Hose unter seinem kurzen Mantel einmal mehr zu rutschen drohte.
Nase und Wangen seiner kleinen Spielgefährtin hatten in der eisigen Luft eine rötliche Färbung angenommen.
»In der Stube«, antwortete sie.
»Bist du sicher? Ich meine ... Es wäre nicht gar so gut, wenn ...«
»Die spielt mit der Katze – wie immer.«
»Und unsere Mütter?«
»Sind auch in der Stube – wie immer.«
Elsbeths kleine kecke Stupsnase und das Strahlen der blauen Augen verrieten ihre Vorfreude auf das, was sich Ernst zusammen mit ihr ausgeheckt hatte. Ein gleichermaßen freches Grinsen huschte auch über das magere Gesicht des Jungen mit seinen hohlen Wangen.
»Pass auf, wenn der Nächste kommt, machen wir’s so, wie besprochen. Aber du bleibst in deinem Versteck, verstanden?«
»Klar. Ob’s wohl lange dauert? Mir wird kalt!«
»Ach, nun zier dich nicht. Sollten wir jetzt etwa auf den Spaß verzichten, wo alles vorbereitet ist?«
Ernst bekam keine Antwort, indes – sie froren beide. Elsbeth trug einen pflaumenblauen wollenen Umhang. Doch die Kapuze, die das Haupt mit dem langen, vollen, hellblonden Haar zuvor umhüllt hatte, war während des Spiels zurückgeschlagen. Am Nacken entlang fühlte das Mädchen den Schnee in seine Kleidung dringen und verflüssigt am Rücken herunterrinnen. Auch in die halbhohen Stiefelchen war Schnee gelangt. Getaut hinterließ er feuchte Sohlen.
Die Schuhe von Ernst waren ebenfalls aus dünnem Material gefertigt. Die Kälte war für ihn nichts Ungewöhnliches. »Gleich der Hände mögen auch die Füße rechtzeitig abgehärtet werden, damit dem Hange zum Schnupfen oder zu rheumatischen Beschwerden im Erwachsenenalter rechtzeitig vorgebeugt werde«, hatte die Mutter ihm wiederholt zu verstehen gegeben. Er hustete. Der Atem stand in dampfenden Wolken vor seinem Gesicht und stieß sich an dem breitkrempigen Hut, der das dunkle glatte Haar bedeckte. Er hustete noch einmal. Schleim hatte sich gelöst. Nun räusperte er sich – mit vorgehaltener Hand, um die Lautstärke zu dämpfen. Dann wisperte er:
»Ich höre jemanden. Da naht einer. Los, versteck dich!«
Torkelnd wankte Franz Altemeier durch das Gartentor. Einige Atemzüge verharrte er und stützte sich an den aufgeschichteten Steinen einer Trockenmauer. Dabei stieß er eine Verwünschung aus, denn er hatte mit seinen bloßen Händen in den kalten Schnee gegriffen und erkannt, dass ihm seine Handschuhe abhandengekommen waren. Wenig Sorgfalt hatte er beim Ankleiden seines Mantels verwendet. Es schien ihn im Moment nicht zu interessieren, dass er den Eindruck eines heruntergekommenen Trunkenboldes hinterließ. Schimpfend führte er Selbstgespräche. Einmal mehr verübelte er es seiner Frau, die ihm nur zwei Mädchen geboren hatte. Gerade heute litt er besonders unter dieser Peinlichkeit. Und dann hatten es auch noch Zwillinge sein müssen. Aber immerhin macht mir Elsbeth etwas Freude, versuchte er sich in seinem wirren Geist einzureden. Ihr war etwas Burschenhaftes eigen. Sie trieb mit ihren viereinhalb Jahren schon einigen Schabernack. Erst vor Weihnachten hatte sie der Katze ihre Beute weggenommen und die Maus in die Wäschetruhe ihrer Mutter gesteckt. Ja, mutig war sie, die Kleine, wenn auch etwas einfältig. Schnell war man ihr auf die Schliche gekommen. Mädchen ... Eben doch nur ein Mädchen, dachte Altemeier. »Einen gesunden kräftig schreienden Jungen hätte sie mir inzwischen wohl schon schenken können«, raisonnierte er murmelnd. Im Amt, da überboten sich die Kollegen mit ihren Erzählungen. Da tauschten sie einander die Berichte aus über die Vorkommnisse, mit denen die Söhne ihre Väter beglückten. Der eine war wissbegierig und würde es gewiss zu etwas bringen. Der andere zeigte schon in jungen Jahren, dass er es verstand, sich seine Vorteile zu verschaffen. Nur er, Franz Altemeier, konnte da nicht mitreden. Diese Freude war ihm nicht vergönnt. Bis auf Elsbeth, dachte er in dem Moment, als er unversehens hinschlug. Er kippte zur Seite, gottlob, und fand sich in einem Schneehügel wieder. Sein Mantel war nun vollends ruiniert. Die Perücke war verrutscht. Als er sich aufrappelte, fluchte er. Er sah sich um seine Wichtigkeit gebracht, seiner Autorität beraubt. Dass die Kinder ihn mit einem Seil zu Fall gebracht hatten, das sie zuvor sorgfältig mit Schnee bedeckt und im entscheidenden Augenblick gespannt hatten, war ihm in seinem bedenklichen Zustand verborgen geblieben.
»Das war dein Vater«, feixte Ernst später.
»Oh, oh«, machte Elsbeth lediglich, schlug die kleine Hand vor ihren Mund und hatte ihren Spaß.
Polternd betrat Altemeier das Haus und klopfte seinen Mantel ab. Wie ein begossener Pudel stand er in der Tür zur Stube und maulte:
»Hatte ich nicht eindeutig Anweisung gegeben, dass mein Anwesen sorgfältig von Schnee und Eis zu befreien sei? Ausgerutscht bin ich! Sollte mir wohl die Knochen brechen, was? – Wo ist Elsbeth?«
»Elsbeth und Ernst spielen draußen«, erklärte Lea, seine Frau, die zähneknirschend ihre andere Tochter anwies: »Agnes, steh auf, und begrüße deinen Vater!«
Widerwillig befolgte Agnes die Aufforderung. Sie mochte es nicht, wenn ihren Vater dieser unangenehme Geruch umgab. Schnell setzte sie sich wieder auf den Teppich, mit dem man im Hause Altemeier die zerkratzten Bohlen des Fußbodens zu verdecken suchte, und warf der Katze erneut das Wollknäuel zu.
»Ach, Franz, wir haben Besuch! Es ist Dienstag! Madame Grave ist da!«
»Ja, ja«, erwiderte Altemeier immer noch ungehalten, wandte sich ab und begab sich in die Schlafkammer. Aus einem Versteck unter seinen Kleidern holte er eine Flasche Cognac hervor. Es ist schließlich Dienstag, kopierte er leise den Tonfall seiner Frau. Dabei rollte er abweisend mit den Augen. Dienstags kam Irmtraud Grave fast regelmäßig zu Besuch. Warum sollte es am heutigen Dreikönigstag anders sein?
Johanna wandte sich vom Fenster ab und betrat den Nebenraum, wo ein schmales Bett und ein paar Decken ihre Schlafstatt bildeten. Immerhin war die Matratze mit Rosshaar gefüllt. In der Nähe befand sich ein Ofen, neben dem zwei Körbe mit gespaltenem Holz standen. Zusätzlich war an der Mauer eine überschaubare Anzahl von Holzscheiten gestapelt. Mit Sorge blickte Johanna auf die Reserven, die sich zusehends verminderten, obwohl sie damit gewissenhaft umgegangen war und eher zu wenig als zu viel geheizt hatte. Sie schalt mit sich. Es war zu dumm. Sie hätte sich noch rechtzeitig mit dem Geäst eindecken sollen, das auf dem Handkarren im angrenzenden Lagerschuppen vorhanden war – dort, wo auch noch einige Säcke mit diesem besonderen Sand existierten, der für die Glasherstellung benötigt wurde. Unglücklicherweise befand sich in diesem Anbau auch der Abtritt.
Johanna rückte einen leeren Schrank beiseite, der das Fenster in der Schlafkammer verdeckte und den eisigen Wind abhielt. Kurz öffnete sie das Fenster, leerte ihren Nachttopf aus und schob das klapprige Holzmöbel wieder in seine vorherige Position zurück. Allzu häufig würde diese Prozedur nicht mehr möglich sein. Die Rückwand des Schrankes hatte sich bereits zu einem Großteil vom Korpus gelöst. Wenigstens diese Wand und die Schranktüren sollten ihr erhalten bleiben, dachte Johanna, den Rest würde sie notfalls als Feuerholz verwerten können.
Sie nahm zwei Ziegel vom Herd, die noch etwas Restwärme gespeichert hatten, wickelte sie in ein Tuch und packte sie unter die beiden Decken ihres Bettes. Ein angewärmtes Plätteisen hielt sie an ihren Bauch, umgab sich mit einer zusätzlichen Decke und legte sich nieder. Ihre Augen tränten, die Glieder schmerzten. Hunger verspürte sie eigentlich nicht. Selbst wenn sie über genügend Nahrhaftes hätte verfügen können, hätte sie die Speisen weitestgehend gemieden. Schon der Gedanke an Haferbrei oder dergleichen ließ Übelkeit aufkommen. Sie fühlte sich angeschlagen – vermutlich wie so mancher in dieser Jahreszeit, in der die Vorräte viel zu früh zur Neige gingen. Selbst die wenigen noch vorhandenen Kartoffeln lagen angefroren in der Ecke und schauten sie mit trüben Augen an. Die Erdäpfel schienen Johannas Los zu teilen. Auch sie waren kaum mehr zu etwas zu gebrauchen. Auch sie befanden sich in einer trostlosen Lage. Ebenso wie für sie waren Johannas Zukunft und die ihres Erstgeborenen bedroht, wenn das Kind in etwa drei Monaten das Licht der Welt erblicken würde.
Wie sollte es dann weitergehen, wenn sich der Vater ihr und dem Kind gegenüber nicht verantwortlich und verpflichtet fühlte? Wie sollten sie über die Runden kommen ohne verwandtschaftlichen Rückhalt? Wovon sollten beide leben? Ob sie betteln gehen müsste? Würde man ihr das Kind wegnehmen? Würde man sie aus Neuhaus fortjagen? Oder ließe man ihr wenigstens das Dach über dem Kopf?
Sie war sich längst nicht mehr sicher, ob sie vor einem Jahr den richtigen Schritt gegangen war, als sie sich dazu entschieden hatte, in Neuhaus zu bleiben. Pilger hatten ihr die Stadt empfohlen; eine Stadt, in der man gewiss Arbeit fände. Immerhin war es die Residenz des Fürstbischofs. Während sie so grübelte, erklang dumpf eine Glocke von der Schlosskapelle.
Vor dem prunkvollen Portal eines Treppenturmes verabschiedete sich Josephus Simon Serdünner noch einmal von dem Mann in der schwarzen Soutane. Er lupfte seinen grauen Wollfilzzylinder und schlug den Kragen seines Lodenmantels hoch, der ihm das Aussehen eines Postkutschers verlieh. Wann immer er in dieser Aufmachung Passanten begegnete, wurde er wegen seiner abgetragenen und altmodischen Tracht belächelt. Doch das war ihm gleichgültig. Er hatte seine Kleidung bewusst ausgewählt, denn sie hielt warm. Über zwanzig Jahre war es her, dass er sich den Mantel kurz vor seiner Auswanderung aus Österreich zugelegt hatte. Noch immer passte sie dem Sechzigjährigen wie angegossen. Die Kälte schien ihm also nichts auszumachen. Zudem musste er heute keine abschätzigen Blicke ertragen, denn das Wetter lockte kaum einen Menschen hinter dem Ofen hervor. Neuhaus wirkte wie ausgestorben. Lediglich die Rauchfahnen, die aus den Kaminen der Häuser stiegen und vom Wind in südwestliche Richtung gedrückt wurden, ließen darauf schließen, dass hier Menschen lebten.
Trotz seines fortgeschrittenen Alters legte Serdünner ein strammes Tempo vor. Der ehemalige Heeres-Verwaltungsbeamte, der in Neuhaus zum fürstbischöflichen Ingenieur und Landbauinspektor aufgestiegen war, hinterließ einen rüstigen Eindruck. Die Schneeglätte auf den Wegen durch den barocken Schlossgarten und vorbei am Marstall bis zu seinem Heim war für ihn kein Hindernis – im Gegenteil: Seine innere Erregtheit trieb ihn zusätzlich an, seiner Frau schnellst möglich die traurige Nachricht zu übermitteln.
In unheilvoller Vorahnung blickte Maria Theresia wenig später ihren Gatten ängstlich und fragend an. Als sie sein stummes Kopfschütteln sah, ließ sie niedergeschlagen ihre Hände in den Schoß sinken. Schon eine Weile hatten sie um den bedrohlichen gesundheitlichen Zustand des Fürstbischofs gewusst; die Ärzte hatten die Hoffnung bereits aufgegeben. Nun war es also zur Gewissheit geworden: Fürstbischof Friedrich Wilhelm von Westphalen war tot.
Die älteste der drei Töchter, die sechzehnjährige Maria Catherina Theresia, legte ihre Handarbeit beiseite. Sie war im Begriff gewesen, ihre Initialen in ein Tuch zu sticken. Sie erhob sich, um ihrem Vater den Mantel und Zylinder abzunehmen und eine Tasse Tee aufzugießen.
»Haben wir auch einen Mocca?«, fragte er in seiner bedrückten Stimmung an seine Frau gewandt.
»Und wenn ... Und wenn dir dann wieder der Magen zwickt?«, mahnte sie besorgt, während ihre Stimme brach und sie sich mit einem Ärmel über ihr tränennasses Gesicht wischte.
Energisch schüttelte er den Kopf: »Ach was, ich brauche jetzt einen starken Kaffee!«
Etliche Sekunden herrschte betretenes Schweigen. Serdünner ließ seinen Blick durch den mit Tannengrün geschmückten Wohnraum und über die Schar seiner anderen Kinder schweifen. Auf das Aufstellen eines mit Kerzen, Äpfeln und Zuckerwerk dekorierten Weihnachtsbaums, wie es andernorts gelegentlich inzwischen Mode war, hatte man verzichtet und war damit einer der letzten Empfehlungen des Bischofs gefolgt. Zu wertvoll war das Holz, als dass man es dem Forst nur aus einer Laune heraus entnehmen wollte.
Nah beim Kamin, der eine wohlige Wärme verbreitete, spielten der fast sechsjährige Friedrich Wilhelm und die beiden nächst älteren Schwestern. Eine Puppenstube hatten die Mädchen zum letzten Weihnachtsfest geschenkt bekommen, während Friedrich Wilhelm mit einem Holzmodell der fürstbischöflichen Residenz spielte. Das Modell stellte ein Bauwerk des Wasserschlosses aus vergangenen Zeiten dar, als der Zugang noch über eine Zugbrücke führte. Interessiert studierte der Junge die Funktionsweisen der Zugbrücke und Brunnen, der Mühlen und Wasserspiele. Sein Taufpate, der Fürstbischof selbst, hatte ihm das Modell geschenkt. Wie die ganze Familie, so mochte auch Friedrich Wilhelm den alten Mann sehr, dem er natürlich eine besondere Ehre erwies, wie es ihm sein Vater gelehrt hatte. Schließlich war der Bischof nicht nur sein Pate, sondern er durfte auch dessen Vornamen tragen. Und die Familie hatte sogar ein Haus geschenkt bekommen – wenn auch ein sehr bescheidenes.
Die Kinder sahen, wie der Vater der weinenden Mutter eine Hand auf die Schulter legte. »Er hat sich zuletzt in Hildesheim aufgehalten, wo man ihn bald im Dom bestatten wird«, sprach er und reichte seiner Frau ein Schnäuztuch. Dann straffte er sich und begab sich zu seinen Töchtern. Er lockerte seine Kragenbinde und legte seine Brille ab. Mit beiden Händen strich er durch sein hageres Gesicht, schloss die Augen, während er die Haut über seinen Schläfen und der hohen Stirn massierte. Einige Momente genoss er die entspannende Wirkung. Vergeblich versuchte er, eine widerspenstige Strähne seines lichten ergrauten Haares zu zähmen. Als er bemerkte, dass er von seinen Töchtern bei diesem Unterfangen angestarrt wurde, rang er sich ein Lächeln ab. Sein strenges Aussehen wich, und liebevoll wuschelte er seinen Töchtern durchs Haar. Über die Puppenstube gebeugt ließ er sich von den Mädchen eine Szene ihres Spiels beschreiben. Seinem Sohn übergab er anschließend ein kleines Paket.
»Hat mir Kaplan Crux für dich mitgegeben. – Nachdem unser lieber Fürstbischof ...« Er brach seinen Satz ab und räusperte sich, bevor er weitersprach:
»Kaplan Adam Crux ist dein zweiter Pate, der für dich immer da sein wird, wenn du ihn brauchst.«
Serdünner war sich nicht sicher, ob sein Sohn die Bedeutung seiner Worte verstanden hatte. »Na, willst du das Geschenk nicht auspacken?«
»Ein Geschenk?«, fragte Friedrich Wilhelm, während seine Schwestern neugierig herüberblickten. Behutsam löste er die Schnüre und entwickelte das Verpackte. Als erstes enthüllte er die Miniatur einer kleinen Schlosskapelle, die er in den Innenhof seines Modells platzierte. Mit fragenden Blicken betrachtete er dann die weiteren Einzelteile.
»Ein hölzernes Himmelbett, Kommoden, Schreibtisch mit Sessel, ein Sekretär und ein Stehpult, eine Betbank, eine Bücherwand und eine lange Tafel für den Spiegelsaal«, zählte Serdünner auf. »Das sind alles Möbel für die Gemächer des Bischofs. Sie gehören in den Teil der Residenz, den ich dir gestern gezeigt habe.«
Sein Vater wies auf einen rückseitigen Bereich des Modells, den keine Außenwand abdeckte, sodass der Blick in das Innere der Räume freigegeben war, die Einrichtungsgegenstände platziert und Szenen des alltäglichen Lebens nachgestellt werden konnten.
Mit erwartungs- und etwas neidvollen Augen verfolgten die Schwestern das Spiel ihres Bruders.
»Die Dinge passen auch in eure Stube«, sprach Friedrich Wilhelm an seine Schwestern gewandt und übergab ihnen selbstlos das Spielzeug. Dann widmete er sein Augenmerk den Gebäuden des Marstalls und der Schlosswache, die sein Vater zusammen mit ihm an den Tagen nach Weihnachten in der Werkstatt hergestellt und damit das Schlossgebäude erweitert hatte.
Serdünner seufzte, als er die Kinder scheinbar zufrieden spielen sah. Sie linderten seinen Schmerz über den Verlust des Freundes und Gönners der Familie. Er mochte das Spiel der Kinder nur ungern unterbrechen, dennoch deutete er an, dass man alsbald aufbrechen und in der Schlosskapelle andächtig beten wolle.
Lea Altemeier legte ihre rechte Hand aufs Herz. Sie fühlte sich peinlich berührt ob des Verhaltens ihres Mannes. »Mir scheint, er hat keinen guten Tag gehabt«, murmelte sie halblaut in die Richtung, in die er verschwunden war.
»Soll vorkommen«, reagierte Irmtraud beiläufig und schob sich rasch noch ein Stückchen Gebäck in den Mund, da sie sich unbeobachtet fühlte. Dabei überkam sie ein Hustenanfall. Und auch die Krümel, die in ihren Schoß gefallen waren, hinterließen eine verräterische Spur.
Mit einem kurzen Zucken der Augenbraue und einem unmerklichen Schütteln des Kopfes nahm Lea Anstoß an dem Fauxpas der Besucherin. Einen verächtlichen Blick ließ sie über die verkrampft dasitzende spröde Besucherin in ihrem schlichten enganliegenden dunkelbraunen Straßenkleid wandern, von dem Irmtraud unbeholfen die Reste des Backwerks mit einer Hand herunterwischte. Farben des Herbstes, kam es Lea in den Sinn, als sie das rostfarbene Fransentuch betrachtete, das so groß war, dass es im Kreuz verknotet werden musste. Welk und trostlos, wie ihre Besucherin. Nein, das war ihre Welt nicht. Kummer und Eintönigkeit gab es draußen mehr als genug. Lea gierte nach Luxus und Lebensfreude.
Die prekäre Situation versuchte sie zu retten, indem sie sich über den Tisch beugte und Irmtraud wiederholt Tee in eine Tasse goss.
Die Katze hatte genug von dem Spiel mit dem Wollknäuel. Sie ließ sich durch die auf den Teppich gefallenen Krumen ablenken und schnüffelte daran. Schließlich putzte sie sich, nachdem Irmtraud sich bemüßigt gesehen hatte, das Köpfchen zu kraulen. Als sich Agnes wieder näherte, nahm sie Reißaus, und beide verschwanden in der neueingerichteten Kinderstube der Zwillinge, wo sich das Mädchen mit Murmelspiel beschäftigte.
Derweil hatte sich Lea selbst eine Tasse mit gezuckertem Tee von dem neuen Mahagonitisch gegriffen und näherte sich damit dem Fenster, das vom heißen Wasserdampf ein wenig beschlug.
»Sehen Sie nur, Irmtraud, wie fromm sie wieder tun! Da pilgern sie zur Andacht, die hochwohlgeborenen Serdünners und werden sich im Gebet erhoffen, dass sie auch weiterhin durch die Kirche gepudert werden«, spottete sie.
Missbilligend führte Irmtraud die Tasse vom Mund: »Ja, ja, ganz schön überheblich! Ich habe gehört, dass sie sogar ihren Namen ändern lassen wollen; Sertürner oder so ähnlich wollen sie sich zukünftig rufen lassen.«
»In Österreich hätte er bleiben sollen, der große Herr. Schlimm genug, dass wir uns noch vor wenigen Jahrzehnten mit ihren Verbündeten, den Franzosen, hier rumschlagen mussten. Für die hegte ja schon der damalige Fürstbischof Clemens August Sympathien«, ereiferte sich Lea, »was wiederum die Preußen veranlasste, uns zu drangsalieren. Was haben wir Hunger gelitten, damals im Krieg. Das Getreide haben sie uns genommen. Die Ofensteine haben sie eingezogen, um ihre Feldbäckereien aufzubauen. Wir mussten ihre Pferde versorgen. Holz mussten unsere Bauern schlagen. Und zu Schanzarbeiten wurden wir herangezogen. Wir mussten uns der Einquartierung der Soldaten beugen und so manche Erniedrigung und Plünderung über uns ergehen lassen.«
»Aber Lea, das haben Sie doch nicht mehr miterlebt. Sie sind doch fünf Jahre jünger als ich!«
»Und wenn schon. Meine Schwester Wilhelmine hat mir davon erzählt. Es soll nicht immer ein Glück gewesen sein, die Kämpfe überhaupt überlebt zu haben.«
»Ja, ja, schlimm waren die Zeiten«, erwiderte Irmtraud. »Aber des Bischofs Nachfolger von der Asseburg haben wir es immerhin zu verdanken, dass wir evangelischen Glasbläser uns hier ansiedeln durften«, ergänzte sie.
»Viel erreicht haben er und sein jetzt verstorbener Neffe jedoch nicht für unser verarmtes Land. Und nun müssen sich ja nicht auch noch die Österreicher hier niederlassen.« Lea beugte sich vor und flüsterte in verschwörerischem Ton: »Ich sage Ihnen was, der Josephus Simon soll sogar eine besondere Neigung zur alchimistischen Kunst haben, wie ich gehört habe. Man erzählt sich, dass ganze Stapel silberner Teller aus dem fürstbischöflichen Haus zum Schmelzofen in sein Laboratorium wandern.«
»Vielleicht hoffte der Fürstbischof darauf, dereinst Gold herstellen zu können«, kicherte Irmtraud.
»Und ich habe gehört, dass seine Frau, die Maria Theresia, in der Residenz ein und aus geht. Das ist doch eindeutig, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Sodom und Gomorra soll es im Umfeld des Fürstbischofs geben«, führte Lea die bissigen Bemerkungen weiter aus.
»Auch die Johanna soll angeblich einen Bastard erwarten, der dort gezeugt worden sein soll«, seufzte Irmtraud.
»Johanna? – Ja, die Arme. Jetzt sitzt sie da drüben fest, in diesem kalten Loch. Kann sich nicht mal selbst einen Weg durch den Schnee schaufeln. Soll wohl etwas träge geworden sein. – Aber sagen Sie nur, Irmtraud, ist das nicht das Quartier, das Ihr Mann Hermann seinen Handlangern üblicherweise zur Verfügung stellt?«
»Ja, als wir in der Glasbläserei noch Gehilfen beschäftigen konnten, da hat Hermann sie dort einquartiert. Aber das ist schon eine Weile her.«
»Und jetzt bewerkstelligt der Hermann das alles alleine?«
»Wie er das schafft, weiß ich auch nicht. Er lässt den Ernst und mich niemals in sein kleines Reich. Das sei viel zu gefährlich. Wegen der hohen Temperaturen der Öfen, sagt er immer.«
»Und die Unterkunft der Helfer hat Hermann der Johanna ...?«
»Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie scheint er einen Narren an ihr gefressen zu haben. Nur weil sie ihm behilflich war, wegen der Genehmigung für die Erweiterung der Glashütte ...«
»Aber die Genehmigung wurde doch durch Franz erteilt.«
»Das stimmt. Er war uns sehr gefällig. Und das ohne allen bürokratischen Aufwand. Sie müssen sehr glücklich sein, einen so tüchtigen Mann zu haben.«
»Da haben Sie recht. Schauen Sie nur, den neuen kristallenen Kronleuchter und diesen Teetisch, den man sogar aufklappen kann, hat er mir kurz vor Weihnachten geschenkt; ebenso wie den Mahagoni-Schreibtisch und die zwei Spiegel-Kommoden von nämlichem Holz.«
»Als Sie Ihren fünfundzwanzigsten Geburtstag ...?«
»Franz wollte mir doch eine Freude machen. Und dann hat er das alles meistbietend erwerben können.«
»Da gönne ich Ihnen aber von Herzen, dass er den Zuschlag erhalten hat. Ich bin ja auch ganz fasziniert von diesem Kanapee mit den zugehörigen Stühlen – sogar mit Federpolsterung«, war Irmtraud entzückt.
»Oh, er würde sich gewiss sehr darüber freuen, wenn er von Ihrer Begeisterung erführe. Ja, er ist sehr rührig. Ich muss ihn nur noch dafür gewinnen können, alsbald die vollständige Deckung des Daches mit Schindeln in Auftrag zu geben. Das hätte eigentlich schon vor dem Winter geschehen sollen. Außerdem wünschte ich mir, dass mir hier bald jemand zur Hand ginge«, klagte Lea, als sie zwei Holzscheite in die Glut des Ofens legte. »Aber jetzt ... Jetzt entschuldigen Sie mich, ich müsste mal kurz nach ihm schauen. Vermutlich wird er sich um seine Töchter kümmern. Er ist ja so vernarrt in die Beiden.«
Bevor er einschlief, hatte Franz die letzten Sätze noch vernommen, denn die Tür zur Schlafkammer stand angelweit offen. »Halts Maul, eingebildetes Weib!«, grummelte er. »Ich hab’s so satt, dir den Schnörkelkram beizuschaffen, dir nach dem Munde zu reden und zu schmeicheln! – Oh, Johanna, ich habe dir so Unrecht getan!«
Lea hatte die Tür leise geschlossen, nachdem sie ihren Gemahl bäuchlings auf seinem Lager liegend vorgefunden hatte, die linke Hand ausgestreckt und seinen Rausch ausschlafend. Dann kehrte sie in die Stube zurück.
»Schade, Irmtraud, ihm ist etwas unpässlich. Aber das soll unserer guten Stimmung keinen Abbruch tun. Sie müssen unbedingt noch von dem Konfekt probieren. Und ein, zwei Likörchen hätte ich auch noch anzubieten«, nahm Lea die Konversation wieder auf.
»Sehr gerne, werte Freundin.«
Irmtraud wies auf die Bonbonniere. »Stammt die auch vom Franz?«
»Ist es nicht ein wunderschönes Porzellan? Feinste Fürstenberger Präzision ... Hier, das blaue F, das Markenzeichen.«
Leas bisheriges launisches Ansinnen hatte sich gewandelt. Die starren, abweisenden Gesichtszüge schienen auf einmal ein zufriedenes Dasein zu verheißen.
»Sehen Sie nur, mit wie viel Hingabe diese Landschaften und Vögel dargestellt sind, die Szenen, wie ein Ausschnitt aus dem Leben, und mit natürlichen Farben gemalt.«
»Und mit vergoldetem Rande ...«
»Das Service ist vollständig, nebst den dazu passenden Schokoladentassen. Franz hat mir noch weitere Errungenschaften in Aussicht gestellt: Ein Service mit einem Dekor von blauen Blumen ... Oh«, seufzte sie, »ich wollte, ich könnte Ihnen diese Schmuckstücke schon heute enthüllen, bezaubernd, sage ich Ihnen, bezaubernd.«
»Diese schönen Dinge passen wirklich gut zueinander«, schwärmte auch Irmtraud.
»Das ist eine kleine Entschädigung dafür, dass Franz doch des Öfteren erst so spät nach Hause kommt, hat er mir gestanden. Ja, er hat eben sehr viel zu tun im Amt, und dann diese ständigen Verpflichtungen in der Residenz!«
Gedankenverloren strich Lea mit einer Hand über das polierte Holz einer Wanduhr. In graziöser Weise schritt sie zu einem Spiegel. Die Dielen knarrten. Ihre bodenlange Nachmittagsrobe, der Oberrock aus schwarzem Satin, der vorne auseinanderfiel und den Blick auf den unteren Rock aus weinrotem und schwarzem Seidenbrokat freigab, raschelte über das Holz. Beim Blick in den Spiegel meinte sie, ihre Frisur richten zu müssen. Aber an ihrem kurzgehaltenen kastanienbraunen Haar war kaum etwas zu ordnen. Sie nestelte an den Rüschen ihres Brustausschnitts. Sie strahlte. Und dann versank sie selbstzufrieden in ihr Ebenbild. Sie war nahe dran, sich einem Tagtraum hinzugeben, als sie im Spiegelbild hinter sich Irmtrauds Antlitz sah, sicher einen Kopf größer als sie. Wie konnte sie es nur wagen, mit ihrer fleckigen unreinen Haut und den ersten Fältchen die Harmonie zu stören. Ein wenig mehr Eitelkeit könnte nicht schaden, dachte die Gastgeberin.
Trotz dieser Erscheinung konnte Lea nicht verbergen, dass sie die bewundernden Worte ihrer Besucherin gerne hörte. Sie hielt zwar wenig von ihrem Gast, von den oft plumpen Gesten und dem wenig repräsentativen und langweiligen Umfeld, mit dem sich Irmtraud umgab. Und doch wurden Lea die regelmäßigen Begegnungen nicht überdrüssig. Zudem brachte Irmtraud stets ein Kunstwerk mit, das ihr Mann, der Glasbläser Hermann, gefertigt hatte. Lea besaß inzwischen eine kleine Sammlung von diesen Artefakten. Auch die Glasmurmeln der Kinder stammten von Hermann Grave.
Die Mechanik eines Uhrwerks setzte sich in Bewegung. Von der Wanduhr erklangen fünf Glockenschläge, als sich die Blicke der beiden Mütter im Spiegel trafen.
Irmtraud hatte längst das ständige Beifallheischen ihrer Gastgeberin durchschaut, das ihr fast unerträglich enervierend wurde. Dennoch schmunzelte sie. Sie wägte ab, ob sie die Bemerkung sagen sollte, die ihr in den Sinn gekommen war. Die Liköre schienen ihre Zunge gelöst zu haben. Obwohl es früher nie ihre Art war, riskierte sie die Anspielung:
»Ach, meine Liebe, wir sind so glücklich und dankbar, Ihre Wertschätzung zu erfahren! Aber sagen Sie mal, wenn sich Ihr Mann so häufig in der Residenz aufhält, dann wird er dem Dünkel der hochwohlgeborenen Serdünners kaum aus dem Wege gehen können, oder? – Hoffentlich geht dabei alles mit rechten Dingen zu!«
Lea erschrak ob dieser Worte. Sie stand da, als sei ihr der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Doch bevor sie ins Taumeln geriet und während sie noch nach einer schlagfertigen Entgegnung suchte, trat Ernst in die Stube und beschmutzte mit seinen schneeverdreckten Schuhen den neuen Teppich: »Mama, mir ist langweilig!«
»Ja, mein Junge, dann sollten wir die Gastfreundschaft unserer Freunde nicht über Gebühr strapazieren. Wir wollen hier schließlich keine Wurzeln schlagen. Vermutlich wird auch der Vater bald nach Hause kommen.«
»Aber Mama«, erwiderte der Junge, »Vater kommt heute wohl nicht nach Hause, oder? Dienstags kommt er doch nie nach Hause!«
Zwei
Zwischen Leben und Tod
So plötzlich, wie sich die weiße Pracht mit ihren Schneemassen zu Jahresbeginn über das Fürstentum Paderborn gelegt hatte, so schnell war sie nach einer Schönwetterperiode im März auch wieder verschwunden. Zurückgelassen hatte sie meistenteils einen tiefen morastigen Boden. Lediglich in den Hochlagen und an Stellen, die von den Sonnenstrahlen des nahenden Frühlings weniger erfasst wurden, waren tiefere Schichten des Erdreichs nach wie vor gefroren. Daran würde sich am heutigen ersten Mittwoch im April nichts ändern. Durch den grauen Dunst würde die Sonne kaum dringen können.
Wie ein breites Band hatte sich dichter Nebel über die Flussaue der Alme gelegt. Dabei verhüllte die Nebelbank die nur schemenhaft sichtbare und mit hektischer Betriebsamkeit handelnde Gestalt nahezu. Vermummt in einem dunklen Umhang mit Kapuze, einem Mönchsgewand ähnlich, hantierte jemand unbeholfen an einem Handkarren. Ein Rad des Wagens war im aufgeweichten Erdreich steckengeblieben. Der verhüllten Person gelang es trotz aller Mühen nicht, den Karren wieder in Bewegung zu bringen. Sie entschied sich, ihn von seiner Last zu befreien. Der Umhang bauschte sich, als ein zusammengeschnürtes Bündel von dem Gefährt heruntergezerrt wurde. In der Sorge beobachtet zu werden, schaute sich der Sonderling immer wieder um. Er schien unschlüssig, wie er mit dem Bündel verfahren sollte. Der in Sackleinwand verpackte Ballast wurde über den Boden gezogen. Zum Schleppen war er offensichtlich zu schwer. Ob Mannsbild oder Frauenzimmer ... Da machte sich jemand sehr verdächtig, der immer wieder anhielt, verschnaufte, weiterging und sich mitsamt dem unhandlichen Packen Schritt für Schritt einer Baumgruppe näherte. Hier wurde die sperrige Fracht abgelegt. Wiederholt ging der Heimlichtuer den Weg zum Karren zurück, besorgte sich eine Schaufel und mühte sich umständlich mit einem Sandsack ab. Keuchend begann die gesichtslose Gestalt zu graben, nachdem alle notwendigen Utensilien zu dem kleinen Wäldchen geschafft worden waren. Schweißüberströmt und ungelenk wurde die Erde ausgehoben, aber nur oberflächlich, denn schon bald waren die tieferen noch gefrorenen Erdschichten erreicht. Ein letztes Mal wurde der schwere Ballen einige Schritte geschleift, schließlich mit einem Ächzen in die flache Mulde gerollt.
Ein heftiger Windstoß erzeugte ein Rauschen in den unbelaubten Zweigen der Bäume, die sich zu verneigen schienen, als das niedrige Grab wieder mit Erdreich aufgefüllt wurde. Zusätzlich wurde der Inhalt des Sandsackes ausgeschüttet. Über den kleinen Hügel wurde totes Laub und Geäst geschichtet. Schließlich wurden die Spuren der merkwürdigen Begebenheit sorgfältig verwischt. Von seiner Last befreit konnte der Handkarren wieder bewegt und bei der Glasbläser-Baracke abgestellt werden. Die Plackerei hatte ein Ende. Das seltsame Treiben war unbemerkt geblieben.
Der Kirchturm der Pfarrkirche St. Heinrich und Kunigunde schlug zur elften Stunde. Elisabeth Buchbinder hatte auf dem Markt zwei Laibe Brot, ein Dutzend Eier, Sellerie, etwas Lauch und ein Huhn erstanden. Heute war es ihr zu ungemütlich, um zwischen den Ständen der Fisch- und Fleischverkäufer, zwischen den frei herumlaufenden Schweinen und dem Federvieh, zwischen den Gewürzkrämern und dem Wagen eines Quacksalbers zu trödeln und die Angebote der Höker zu studieren. Außerdem hatte der fahrende Buchhändler sie geärgert, der sie geringschätzig behandelt hatte, als er meinte, sie könne ohnehin die Buchstaben nicht auseinander halten. Sie war versucht, seinen vorlauten Sprüchen in ihrer bayrischen Mundart zu begegnen, doch verzichtete sie darauf. Heutzutage musste man vorsichtig sein. Sie wollte schließlich ihren Auftrag nicht gefährden. Außerdem hatte sie es eilig.
Sie erreichte in der Residenzstraße an der Almebrücke die Kaplanei, die als Unterkunft für Kaplan Adam Crux diente.
Noch immer lag der beißende Geruch von dem gestrigen Brand in der Luft. Gar nicht weit entfernt, auf der anderen Flussseite, hatte der runde Ziegelbau auf einmal lichterloh in Flammen gestanden. Nur der Schlot des kleinen Fabrikgebäudes stand noch. Alles Übrige war bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Da hatte es auch nicht genutzt, dass man bei der Bekämpfung des Feuers das Löschwasser nah bei der Hand hatte. Zu schnell hatte sich das Feuer ausgebreitet. Eine zu große Hitze und giftige Gase hatten sich am Unglücksort entwickelt. Tatenlos mussten die Helfer aus der Ferne zusehen, wie die Flammen das Gebäude verzehrten. Es blieb ihnen lediglich vorbehalten, einige Vorkehrungen zu treffen, damit die ungewöhnlich hohen Temperaturen nicht auch noch die Dächer der nächst stehenden Wohnhäuser, Ställe und Heuschober entzündeten. Natürlich war der Brand auch Gesprächsthema unter den Marktbeschickern und Kunden. Man erregte sich darüber, dass es dem Glasbläser erlaubt worden war, sein Gewerbe so nah der Wohnviertel zu betreiben. Noch immer verspüre man im Rachen die Ätzungen der Schwefeldämpfe, lamentierten einige. Auch über sie ärgerte sich Elisabeth. Denn denen schien es gleichgültig zu sein, dass es vermutlich einen Toten oder vielleicht sogar mehrere Opfer gegeben hatte.
»Um Gotts Wuin! Herrschoftszeitn!«, sprach sie verblüfft. Jetzt waren ihr doch einige Bemerkungen herausgerutscht, die ihre Herkunft verrieten. So viele überraschende Ereignisse innerhalb weniger Stunden hatte man ja auch nicht alle Tage zu verkraften.
Elisabeth traute ihren Augen nicht, als sie dort vor der Eingangstür zur Kaplanei ein Körbchen entdeckte, aus dem das herzergreifende Wimmern eines Säuglings zu vernehmen war. »Luada, Wuidsau! Da Deifi soi di hoin!«, sandte sie in Gedanken einige bissige Schimpfworte an die unbekannte Mutter und ihr ungebührliches Verhalten, ein kleines Kind derart lieblos seinem Schicksal überlassen zu haben. »Des glaub i jetzt ned. A ausgesetzts gloans Kind. So wos hod’s in derer Gegend ja scho lang nimmer gebn!«
Sie öffnete die Tür der Kaplanei, in der sie für die Sauberkeit zuständig war. Eine warme Mahlzeit täglich bereitete sie hier für den Geistlichen zu. Meistens begab sie sich danach schnell nach Hause, um auch für sich selbst und ihrem Mann das Essen zuzubereiten. Das hatte pünktlich auf dem Tisch zu stehen, wenn Clemens seine Lehrertätigkeit in der Elementarschule beendet hatte. Zunächst aber galt es nun, den Herrn Kaplan in dem geräumigen alten Ackerbürgerhaus zu finden.
Damit sie nicht wieder zufiel, stellte Elisabeth ihren Einkaufskorb vor die geöffnete Tür. Als sie sich erneut über den kleinen Erdenbürger in seinem beengten Behältnis beugte, verspürte sie einen Juckreiz auf dem Rücken ihrer linken Hand. Mit den Fingernägeln ihrer Rechten kratzte sie sich. Dann strich sie mit einem Zeigefinger sachte über eine der geröteten Wangen des Kleinen. »Was für ein zartes kleines Kind du bist«, flüsterte sie. Sein Greinen hörte mit einem Male auf. Zwei große dunkle Augen blickten ihr entgegen. Kurze schmatzende Laute gab er von sich. Dann schlummerte der Säugling ein. Auch vom nachfolgenden Poltern ließ er sich nicht beeindrucken.
Mit dem Körbchen in der Hand durchschritt Elisabeth aufgeregt die Längsdeele und hoffte, nicht alle zwölf Zimmer des Hauses nach Kaplan Adam Crux absuchen zu müssen.
»Himmeherrgodnoamoi, Kruzefixhalleluja!« – Die zweite Türe wurde zugeschlagen. »Himmisakra, Allmächd!« – Wieder knallte es laut. Elisabeth war eine sehr entschlossene Frau, couragiert, resolut in ihrem Auftreten. Sie hatte als Tochter eines Bauern schon früh kräftig zuzulangen gelernt. Ihr kleiner bis mittelgroßer Wuchs, die eher kurzen Gliedmaßen, der kaum vorhandene Hals und die rundliche Kopfform mit den zum Kranz aufgesteckten geflochtenen braunen Haaren gaben ihr eine gedrungene Gestalt. Dabei wirkte sie keineswegs behäbig oder schwerfällig. Trotz der über dreißig Lebensjahre verliehen ihre Bewegungen und ihre Haltung den Ausdruck von Anmut und Leichtigkeit und zeugten von jugendlicher Kraft. Dennoch klopfte ihr Herz, nachdem sie die steinerne Stiege ins zweite Obergeschoss hinauf gehastet war und fast atemlos wiederholt nach dem Herrn Kaplan rief.
»Nur zu, Elisabeth, nur zu! Ich habe Sie noch nie fluchen hören!«
»Oha. Do geht ma's G'impfte auf!«
»Wie bitte?«
»Entschuldigung, Herr Kaplan. Ich zerplatze gleich vor Wut!«, übersetzte sie schnaufend. »Herr Kaplan, wir kennen uns so gut. Da werden Sie schon richtig zu deuten wissen, dass meine unbedeutenden Ausrufe nicht mit Flüchen gleichzusetzen sind. – Ist das Ihr Kind?«
Der Kaplan war kein Mensch, der für alle Lebenslagen nur einen frommen Spruch auf den Lippen führte. Er war ein Seelsorger, der für die Sorgen der Leute stets ein offenes Ohr hatte und häufig genug auch sinnvolle Ratschläge erteilen konnte. Meist ließ er seinen Worten aber auch Taten folgen, denn Adam Crux konnte anpacken und war sich selbst für Tagelöhner-Tätigkeiten nicht zu schade. Es gab nur wenige Situationen, mit denen er überfordert war. Wie man zum Beispiel mit einem nur wenige Stunden alten Säugling umzugehen hatte – mit so etwas kannte sich der Kaplan nicht aus.
»Mein Kind?« Dem Kaplan schoss die Röte ins Gesicht. Dann wurde er blass. Er fühlte sich arg überrumpelt. Eine solche Frage war wohl noch nie an ihn gerichtet worden.
»Ich habe den Säugling auf Ihrer Türschwelle gefunden!«, erklärte Elisabeth. »Soeben schrie er noch aus Leibeskräften. Jetzt, da Sie ihn anlächeln, ist er auf einmal so friedlich.«
»Ja. Aber davon wird er wohl nicht satt, wie mir scheint.«
»Das ist wohl wahr. Wir müssten ihm eine Amme besorgen. Außerdem sollte sich auch eine Hebamme seiner annehmen. Ich muss jetzt allerdings zuerst das Huhn in den Kochtopf ... Vielleicht möchten Sie die Hebamme ...«
»Ich?«, fragte der Kaplan entgeistert zurück. »Ach, Elisabeth, Sie sind doch eine patente Frau. Und wegen des Essens machen Sie sich mal keine Gedanken. Es ist gestern noch reichlich Mus übrig geblieben. Vielleicht wollen Sie lieber ... Übrigens: Wieso legt jemand das Kleine auf meine Türschwelle?«
»Sie wissen doch, Herr Kaplan, den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf«, lächelte Elisabeth, als sie sich wieder über das Körbchen beugte. Offensichtlich hatte sie Gefallen an dem Würmchen gefunden.
Das Gesicht von Clemens Buchbinder verdüsterte sich für einen Moment, als ihm seine Frau ihr Ansinnen vorgetragen hatte. Nach dem Besuch bei der Hebamme und der Amme war Elisabeth schnurstracks zum Lehrerhaus gelaufen, wo sie ihren Mann in seiner Studierstube vorfand. Der Unterricht war bereits beendet.
»Wir hatten uns doch entschieden, in Anbetracht der Situation keine Kinder ...«
»Ich weiß, ich weiß ja«, unterbrach sie ihn. »Aber wer kann schon was dagegen haben, wenn wir den Kleinen adoptieren?«
»Du weißt, dass wir eventuell eines Tages in die Lage geraten könnten ...«
»Vielleicht. Dann müssten wir damit leben«, sagte sie bestimmt.
»Es könnte hart werden, ganz besonders für dich.«
»Ohne eigene Kinder ist es ohnehin hart genug für mich, das weißt du doch. Wir könnten dem armen Würmchen eine Zukunft bieten. Und vielleicht geht ja auch alles gut aus, und unsere Bedenken sind gegenstandslos.«
»Es wäre zu schön.« Clemens Buchbinders Gesicht hellte sich auf. Sorge und Zweifel schienen zu verfliegen. »Es gäbe unserem Leben sicher einen neuen Sinn.«
Elisabeth drückte sich an die Schulter ihres Mannes. Dann legte sie ihm den Säugling in den Arm. »Ludwig. Wollen wir ihn Ludwig nennen? So wie mein Großvater hieß. Bitte, das wird meine Erinnerungen an ihn lebendig halten!«
»Und ich? Ich halte die Erinnerungen an ihn etwa nicht lebendig?«, fragte Clemens mit gespielter Entrüstung.
»Doch. Natürlich. Das weißt du doch. Wenn Großvater damals nicht gewesen wäre, hätte Vater nie in unsere Heirat eingewilligt.«
»Ja, dein Großvater war ein weitsichtiger Mann«, frotzelte Clemens. »Obwohl, wenn er die Entwicklungen tatsächlich vorausgesehen hätte – es wäre dir mit meinem nicht ungefährlichen Ansinnen manches erspart geblieben.«
»Ich habe es doch nicht anders gewollt; wir beide haben es nicht anders gewollt.«
Clemens Buchbinder lächelte sie mit einem zärtlichen Blick an und nickte. Er war zufrieden damit, wie es war. Er war glücklich darüber, dass sich sein Eheleben so anders gestaltete, als dies bei den meisten üblich war. Elisabeth und er – sie verstanden sich blind. Da bedurfte es keiner Hierarchien zwischen Mann und Frau. Bewusst lehnte er diese seiner Ansicht nach unangemessene traditionelle Geschlechterrolle mit dem Herrschaftsanspruch des Mannes ab, die er auch aus seinem Elternhaus kannte. Wie war sein Vater doch stets darauf bedacht gewesen, jedes eigenständige Denken von Frau und Kindern zu unterdrücken. Gegen seine von Gott gegebene Weisheit durfte man nicht aufbegehren. Aber das Gegenteil von dem, was der Vater bezweckt hatte, war eingetreten. In seiner Jugend war Clemens zum Rebell gegen alle althergebrachten Konventionen geworden und verstand es nun bei seinem Wirken als Lehrer, seine Freiräume im Sinne seiner Überzeugungen zu nutzen. Dies geschah derart, dass er kaum in Konfrontation mit der Obrigkeit geriet, die sein Handeln und seine Beweggründe nicht zu durchschauen vermochte.
Er streichelte Elisabeth über ihre linke Hand – dort, wo sie sich soeben wieder gekratzt hatte. Ja, sie hatten aus einem Gefühl der Herzenswärme zueinander gefunden – nicht, weil es von den Eltern aus einem Standesdünkel heraus so gewollt oder aus wirtschaftlichen Erwägungen arrangiert worden war.
»Also gut. Ludwig soll er heißen.«
»Du bist mein Bester. Und du bleibst mein Bester!«, strahlte Elisabeth und drückte ihren Mann. »Übrigens, Kaplan Crux hat sich angeboten, ihn zu taufen.«
»Taufen?«, fragte Clemens missbilligend. »Muss das sein? Und was ist mit unseren Überzeugungen?«
»Naja, in einem katholischen Land. Wir sollten Ludwig schon die Gelegenheit verschaffen, mit möglichst guten Voraussetzungen ins Leben zu starten. Der Kaplan übernimmt auch die Patenschaft.«
»So? Der ist doch schon Pate von dem kleinen Serdünner. Da hat er wohl ein neues Hobby, wie? Dann könnte er doch für die Erstausstattung sorgen – Windeln, Kleidung, Bettchen ... Was man alles so braucht für einen neuen Erdenbürger.«
»Windeln und Kleidung hat mir schon die Hebamme Hilde mitgegeben.«
»Und?« Clemens deutete mit dem Reiben zweier Fingerkuppen die Frage nach der Bezahlung an.
»Ihr Sohn ist doch in deiner Klasse. Vielleicht könntest du auf das Schulgeld verzichten?«
»Das sag mal unserer Schulbehörde. Und dann kannst du auch gleich den Vorschlag unterbreiten, dass ich generell wieder mit Naturalien entlohnt werde«, grummelte Clemens. »Eine Unterrichtsstunde für ein Huhn; eine weitere Stunde, damit ich ein ordentliches Essen auf den Tisch bekomme.«
»Das Huhn! Oh je, Clemens! Das habe ich ganz vergessen.« Elisabeth wirkte ungewöhnlich fahrig. »Wo habe ich denn nur ... Das wird aber dauern, bis es fertig gegart auf den Tisch ...«
»Ach, lass dir nur Zeit, Mütterchen. Das Huhn läuft ja nicht mehr weg«, ulkte er. »Außerdem kann ich mich auf diese Weise langsam daran gewöhnen, dass ich in unserem Haushalt in Zukunft nur mehr höchstens die zweite Geige spielen werde!«
Rund vier Wochen später nahm der kleine Ludwig von Amts wegen den Familienamen Buchbinder, den Namen seiner Adoptiveltern, an.
Und noch zwei weitere Verwaltungsakte wurden im Amt vorgenommen: Der Familienname des Josephus Simon wurde in Sertürner abgeändert. Des Weiteren schloss Amtmann Franz Altemeier den Fall des Glasbläsers Hermann Grave ab. Dieser war beim Ausbruch eines Feuers in seiner Werkstatt zu Tode gekommen. Ob es sich dabei um einen Unfall oder um ein gewolltes Feuer gehandelt hatte, konnte nicht ermittelt werden. Bei einer Befragung hatte die Ehefrau sehr verstört gewirkt und ausgesagt, ihr Mann habe ihr Heim – wie stets am Dienstag in der Frühe – gegen sechs Uhr verlassen, und sie habe ihn zu diesem Zeitpunkt letztmalig gesehen. Der kleine Ernst hatte geweint und bestätigt, der Vater sei schon aus dem Haus gewesen, als er an diesem Morgen aufgewacht sei. Weitere Anhaltspunkte gab es keine und ließen sich wohl auch kaum finden, denn die Glasbläserei war durch das Feuer völlig zerstört worden. Franz Altemeier erinnerte sich, dass des Glasbläsers Frau Irmtraud am Tage nach dem Unglück gemeldet hatte, dass sie die der Johanna Grünberg zur Verfügung gestellte Unterkunft leer vorgefunden habe. Offensichtlich habe sich das Frauenzimmer heimlich davongemacht. Auch heute wieder musste Altemeier schmunzeln. Er sah Johanna vor sich, wie sie sich vor einem Jahr bei ihm angemeldet hatte, die Hüften verführerisch wiegend, kichernd und ihn immer wieder mit einem kecken Seitenblick bedenkend. Nun hatte sich das Flittchen wohl nicht mehr getraut, sich persönlich im Amt abzumelden.
Altemeier packte die vorliegenden Protokolle aus den Polizeiermittlungen und der Feuerwehr zusammen, bündelte sie und versah die Verknotung der Kordel mit einem Siegel. Er begab sich in die obere Etage und reichte die Akten seinem Vorgesetzten weiter, der sie zuständigkeitshalber an das Samtamt Oldenburg-Stoppelburg übergeben würde. Auch die vor etwa zwanzig Jahren gegründete Brand-Assecuration würde über den bescheidenen Stand der Ermittlungen informiert. Für den bereits feststehenden Wert der Arbeitsstätte würde die in Not geratene Familie sicher einige Reichstaler erhalten.
An seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt sortierte Altemeier die noch nicht bearbeiteten Vorgänge der letzten Wochen. Dabei fiel ihm ein unbeschrifteter Umschlag in die Hände. Er entfaltete den Briefbogen, der mit einer merkwürdigen Zusammenstellung ausgeschnittener Zeitungsbuchstaben beklebt war. Trotz dieser ungewöhnlichen Montage war der anonyme Hinweis problemlos lesbar. Bei Altemeier rief er ein hohes Maß an Bestürzung hervor. Demnach sollte, kurz bevor an jenem Dienstag das Feuer entdeckt worden war, die erbost wirkende Ehefrau Irmtraud Grave am Unglücksort gesehen worden sein. Angeblich hatte auch eine Johanna Grünberg den Glasbläser besucht.
Altemeier ließ das Schriftstück sinken. Diese Notiz ließ das vermeintliche Unglück in einem ganz neuen Licht erscheinen. Bisher hatte man von der Unwissenheit der Witwe Grave ausgehen müssen. Für den Versuch eines Versicherungsbetrugs hatte es keine Indizien gegeben. Denn die Familie Grave war finanziell deutlich besser gestellt gewesen, bevor sie ihr Familienoberhaupt und ihren Besitz verloren hatte. Und von einer Beziehungstat konnte auch nicht ausgegangen werden. Dafür hatte die Ehe der Graves zu intakt geschienen. Oder hatte es doch Ungereimtheiten zwischen den Eheleuten gegeben? Sollte gar ... Nein, das schien doch zu unglaublich, geradezu unerhört. Aber auszuschließen war es wiederum auch nicht. Schließlich hatte man von dem vermeintlichen Opfer Hermann Grave keine Spuren mehr gefunden. Wie sollte man auch? Das Feuer hatte doch alles vernichtet. Und doch: War es tatsächlich vollkommen auszuschließen, dass der Glasbläser bei dem Unglück nicht ums Leben gekommen war? Unglück? Altemeier hatte von Anfang an Zweifel an dieser Sichtweise gehegt. Möglicherweise war der alte Grave mit der Grünberg durchgebrannt. Undenkbar war das nicht. Schließlich wird er ihr sein Quartier kaum uneigennützig zur Verfügung gestellt haben, der alte Bock. Doppelt so alt wie seine Liebschaft war er. Warum sollte er mit seinen knapp vierzig Jahren nicht noch einmal einen neuen Anfang ... Und seine einfältige Ehefrau trug nun Trauer. Oder war Irmtraud Grave gar nicht so ahnungslos gewesen? Seit etlichen Wochen war sie nicht mehr bei Lea erschienen. Nach dem Dreikönigstag hatten die Dienstagstreffen zuerst noch sporadisch stattgefunden. Man war sich zunehmend distanziert begegnet und bedachte viel penibler als zuvor, was man von sich preisgab. Und seit dem Unglückstag hatte Irmtraud Grave die Begegnung mit Lea vollends gemieden. Im Grunde ... Ja tatsächlich ... Seit dem Tag, an dem die Grave das Verschwinden der Grünberg gemeldet hatte, hatte auch er die üble Tratschbase seiner Frau nicht mehr gesehen. Also: Hatte Irmtraud Grave etwas zu verheimlichen?
Altemeier riss die Tür seiner Stube auf. Schnell wollte er noch einmal die Unterlagen bei seinem Amtskollegen ... Er zögerte. Unverrichteter Dinge kehrte er an seinen Schreibtisch zurück. Da lag sie, die anonyme Zuschrift. Er hielt sie gegen das Licht. Sie gab keine weiteren Informationen preis. Warum nur hatte man ihm diese Mitteilung zukommen lassen? Warum machte man gerade ihn darauf aufmerksam, dass auch die Grünberg bei dem Glasbläser gesehen worden sei? Johanna Grünberg. Der Schweiß brach ihm aus. Er riss sich seine Perücke vom Haupt und legte die Dienstrobe ab. Erneut las er die Botschaft und blickte auf. Er trat ans Fenster und schaute gedankenverloren in die Ferne. Johanna Grünberg. Warum hatte er sich nur mit dieser Schlampe einlassen müssen? Er dachte an die letzten Monate des vergangenen Jahres zurück und an die Probleme, die entstanden waren, weil das Luder bei ihren heimlichen Treffen und Liebeleien nicht gut genug aufgepasst hatte. Es war noch gar nicht so lange her, als sie ihm eine Szene gemacht hatte. Sie wisse nicht, wie es weitergehen solle, wenn es denn eines Tages Nachwuchs gäbe, hatte sie gejammert. Glücklicherweise hatte sie sich nach dem Eklat im Herbst nicht mehr blicken lassen.
Altemeier zuckte mit den Schultern. Eigentlich schade um das Mädchen, dachte er. Sie war alles andere als eine Straßendirne, auch wenn sie es perfekt verstanden hatte, ihn mit ihrem gurrenden Lachen und ihren schmachtenden Blicken für sich einzunehmen.
Bei der ersten Begegnung am Tag ihrer Anmeldung hatte er sogleich gemerkt, dass sie etwas Besonderes war. Blutjung war sie ihm erschienen und sich ihrer aufreizenden Erscheinung gar nicht bewusst gewesen. Ihr ganzes Auftreten hatte ihn in Wallung gebracht, und scheinbar hatte auch sie sich seit dem ersten Moment zu ihm hingezogen gefühlt. Schon nach dem dritten Treffen hatten sie sich einander das besondere Kribbeln anvertraut. Sie trafen sich immer häufiger, während seine Frau ihn bei der Arbeit wähnte. Vor allem an den Dienstagen konnten sie sich viel Zeit füreinander nehmen.
Das dumme Ding hatte nie darüber berichten wollen, woher es stamme und warum es alleine nach Neuhaus gekommen sei. Und das war auch nie wichtig gewesen. Dass sie zusammen schöne Begegnungen genießen konnten, das war alles, was zählte. Dass er ihr immer mal wieder einige Münzen zugesteckt hatte, das hatte ihnen beiden keine schlaflosen Nächte bereitet. Zumindest hatte sich Johanna nie so gefühlt, als würde sie sich als Hure ihr Leben verdingen. Sie hatte einmal für Hermann Grave vorgesprochen, als er eine Genehmigung für den Anbau an seiner Glasbläserei benötigte. Dafür hatte dieser sich erkenntlich gezeigt und ihr eine Unterkunft vermittelt.
Oder war es zwischen diesen Beiden doch zu ernsthafteren Annäherungen gekommen, mutmaßte Franz erneut. Er schüttelte den Kopf. Für einen Moment war er sich nicht sicher, ob das alles nun ein Traum oder Wirklichkeit war. Der anonyme Hinweis in seiner Hand brachte ihn zur Besinnung. Was bezweckte der Informant? Sollte er etwa über die Liebelei des Amtmannes mit Johanna Grünberg im Bilde sein. Mein Gott, das war doch nur eine Episode. Eine Romanze. Für ihn hatte sich eine Mesalliance angebahnt, die aber doch keine Zukunft ..., ein flüchtiges Erlebnis ..., das sich aber zu einer folgenschweren Affäre würde ausweiten können, erkannte er nun. »Und wenn man ..., wenn man mich womöglich beschuldigt, mit dem Feuer einen Konkurrenten aus dem Weg geschafft zu haben«, murmelte Altemeier. Seine Gedanken zogen immer größere Kreise. Ihm wurde unheimlich. Es war nicht auszudenken, wenn man den Fall Grave neu aufwickelte und wenn noch sehr viele unangenehmere Fragen als bisher gestellt werden würden. Viel Staub könnte aufgewirbelt werden. Die Leute würden sich das Maul zerreißen. Verderbtheit, Sünde, Schande – waren Attribute, die ihm in jeder Hinsicht unwillkommen sein mussten. Er musste auf seinen untadeligen Ruf bedacht sein. Ein Skandal könnte auf jeden Fall seine Aufstiegsmöglichkeiten beeinträchtigen. Und welche Zukunft seine Ehe haben würde. »Ehe«, brummelte er abfällig.
Da hilft nur eins, dachte sich Altemeier, die anonyme Anzeige muss verschwinden! Ich darf ihr nicht nachgehen, wenn ich mich nicht selbst ans Messer liefern will. Er zerriss das verräterische Schriftstück, trat an ein Kohlebecken und sah erleichtert zu, wie die Papierfetzen verbrannten. Nun musste er darauf hoffen, dass Johanna ihm nicht mehr in die Quere kam. Dann würde er im Falle eines Falles alles Weitere abstreiten können, wenn man ihm Verdächtigungen unterstellte.
Es klopfte an seiner Tür, die sogleich geöffnet wurde.
»Madame!« Franz Altemeier war einige Atemzüge lang sprachlos.
»Was ist, Franz? Geht es Ihnen nicht gut? Mein Gott, Sie sehen aus, als hätten Sie ein Gespenst gesehen. Ist meine Erscheinung derart abschreckend?«
»Nicht doch, Madame. Wie können Sie nur ...« Altemeier hüstelte. »Ich dachte ... Nein, ich fürchtete, mein Vorgesetzter ...«
»Ihr Vorgesetzter? Der löst bei Ihnen einen derartigen Schock aus?«
»Ach nein. Wo denken Sie hin, Madame. Es ist nur ... Ich hatte soeben meine letzte Amtshandlung im Fall ... Nun, es ist doch wegen der Feuerversicherung. Ich war einen Moment lang verunsichert und befürchtete, der Oberamtmann hätte noch einen Einwand ... Ich kann Ihnen die freudige Nachricht ... Sie werden schon bald das Geld erhalten. Wenn Sie sich noch zwei, drei Wochen gedulden ...«
»Natürlich, Franz.«
»Nun, es ist für Sie sicher nicht leicht ... Ich hörte davon, dass Sie inzwischen aus Ihrer Wohnung ...«
»Deswegen bin ich hier, Franz. Sie wissen, dass solch ein Haus von einer alleinstehenden Frau mit Kind nicht zu unterhalten ist. Ich musste den Pachtvertrag kündigen. Und auch die Lagerräume an der Alme ...«
»Das Quartier, in dem Madame Grünberg zuletzt ...?«
»Es ist alles wieder in den Besitz des Hochstifts übergegangen.«
»Ja. Und wo haben Sie nun Ihre Unterkunft?«
»Da bin ich dem Josephus Serdünner ...«
»Sertürner. Die Familie heißt jetzt Sertürner«, unterbrach Altemeier sie.
»Ach. Naja, ich muss ihm wirklich sehr dankbar sein. Aufgrund seiner guten Kontakte ... Nun, er hat mir eine Wohnung vermitteln können. Sie wissen doch, im Marstall-Gebäude stehen etliche Räumlichkeiten für das Personal der fürstbischöflichen Residenz zur Verfügung.«
»Ja. Da bin ich aber froh, dass Sie und der kleine Ernst dort untergekommen sind. Da mache ich doch gleich die Ummeldung für Sie fertig.«
»Das ist gut, Franz.«
»Nicht der Rede wert, Madame.«
Aufmerksam schaute Irmtraud ihm bei seinen Einträgen in das Meldebuch zu. »Warum sind Sie eigentlich auf einmal so förmlich zu mir, Franz? Das ist mir schon bei unserer letzten Begegnung aufgefallen.«
»Förmlich?« Er betrachtete sein Werk und gab Löschsand darüber. Nach der Vollendung seiner Amtshandlung legte er die Schreibfeder beiseite. Dann wandte er sich der Bürgerin zu. »Nun, Madame Grave, wir sollten privates und dienstliches schon voneinander trennen, denke ich. Wie schnell kann da Gerede aufkommen, wenn Sie wissen, was ich meine?«
»Gerede?« Irmtraud Grave lächelte süffisant. »Meinen Sie so ein Gerede, wie man es in diesen Wochen über Johanna Grünberg ...«
»Über Madame Grünberg redet man?«
»Nicht nur über Johanna.«
»Über wen denn noch?«
»Natürlich spekuliert man auch darüber, wer ihr diesen kleinen Bankert gezeugt hat.«
»Ach. Davon habe ich noch nichts gehört. Sie hat also ein Kind auf die Welt gebracht? Ist es ein Junge?«
Irmtraud Grave hob scheinbar unwissend die Schultern. »Sie wissen doch, dass die Grünbergsche fort ist. Und das Kind hat wohl noch niemand zu Gesicht bekommen. Aber Franz ...«, nun schüttelte sie den Kopf, »machen wir uns doch nichts vor. Wie viele Taler haben Sie Ihr denn gezahlt, damit sie schweigt?«
»Madame, ich muss doch sehr bitten!«
»Wir kennen uns schon so lange, Franz. Wir wissen doch beide, was dienstags in den diversen Kämmerchen und Stübchen der Residenz geschieht.«
»Madame ...« Ich weiß nicht, was Ihr Mann so getrieben hat, wollte er zuerst erwidern, besann sich jedoch eines Besseren. »Madame, Sie deuten ungeheuerliche Unterstellungen an, die ich mir nicht bieten lassen kann. Ich werde Sie durch die Wache ...«
»Das würde ich mir gut überlegen, Franz«, unterbrach sie ihn. »Handeln Sie nicht unüberlegt und vorschnell. Ich habe kein Interesse daran, Ihren Ruf und das Leben Ihrer Frau und Ihrer Töchter zu ruinieren. Also seien Sie mal ein Mann. Und denken Sie dabei nicht nur an das Eine. Nein, Sie sollten sich besser Ihrer Situation bewusst werden und die notwendigen Konsequenzen ziehen.«
»Und die wären?«
»Sie wissen, dass die Zukunft für meinen Sohn und mich kein Zuckerschlecken wird, da Hermann tot ist. Auch wenn ich nach Kräften bemüht sein werde, für unser Auskommen zu sorgen, wird es doch an vielem mangeln. Ich denke, das Geld, das Sie nun nicht mehr der Johanna ...«
»Sie wollen mich erpressen?«
»Franz, überlegen Sie es sich in Ruhe. Ich will Sie nicht wie einen Hühnervogel rupfen. Der Betrag wird sich in Grenzen halten. Doch so viel, wie Sie für Johanna erübrigen konnten, so viel sollte es schon sein.«
»Verlassen Sie das Amt! Sofort!«
»Wenn meine Beweise nicht hieb- und stichfest wären, würde ich es nie gewagt haben ...«
»Sie bluffen!«
»Ja, so nennt man das in Ihren Kreisen, nicht wahr? Wie viele Ihrer Kontrahenten haben Sie beim Kartenspiel schon ausgenommen? Es scheinen einflussreiche Personen zu sein, die sich Kronleuchter, Teppiche, wertvolle Spiegel und Mobiliar abluchsen lassen. Oder sollten Ihre Errungenschaften gar aus den Beständen des Fürstbischofs stammen? So wie das Fürstenberger Porzellan, das in der Residenz vermisst wird, wie ich vom alten ... vom Josephus Sertürner erfuhr?«
»Raus! Ich will Sie nicht mehr sehen!«, schrie Altemeier und riss die Tür auf. »Hinaus mit Ihnen! Scheren Sie sich zum Teufel!«
»Altemeier, dass Sie kein Mann sind, der für seine Untaten gerade stehen kann, haben Sie schon hinlänglich demonstriert!«
Mit einem rauen Griff stieß er Irmtraud Grave aus der Amtsstube, während er sie herablassend und distanzlos ansprach: »Verschwinde, bevor ich mich vergesse!«
»Sie enttäuschen mich auch noch in anderer Hinsicht, Franz Altemeier: Gehört es nicht zu den grundlegendsten Voraussetzungen für die Position eines fürstbischöflichen Amtmannes, wenigsten ein Mindestmaß an Contenance zu wahren? – Der Tag ist nicht fern, da werden Sie winselnd erscheinen und mich anbetteln!«
Den lauen Maientag hatte Ernst bei seinem neuen Freund Friedrich Wilhelm zugebracht. Ernst blätterte in den Seiten des Intelligenzblattes, dem amtlichen Mitteilungsblatt, das nun schon seit einigen Jahren regelmäßig erschien.
»Bald bin ich sieben, dann darf ich die Schule besuchen, hat Mutter gesagt. Dann lerne ich all das lesen, was hier geschrieben steht.«
Er schlug die Vorderseite des Amtsblattes auf und folgte mit seinem Zeigefinger den filigranen Linien und Rundungen des fürstbischöflichen Wappens, das die Titelseite zierte. »Irgendwann möchte ich auch schreiben können. Geschichten schreiben. Und Bilder sollen dazu kommen.«
»Bilder? – Schau nur! – Gefallen dir solche Abbildungen?«
Der kleine Sertürner reichte ihm ein Buch seines Vaters.
»Was soll das sein?«
»Als Architekt benötigt man diese Zeichnungen. Dann kann man Brücken bauen oder Häuser, Kirchen oder Mühlen, Straßen, Flüsse oder Wälder vermessen.«
»Und dein Vater stellt diese Bilder her?«
»Er rechnet viel. Dann erstellt er Pläne. Die Baumeister und Maurer können die Pläne lesen und danach bauen. Das würde ich ebenfalls gerne können.«
»Kommst du auch im Sommer in die Schule?«
»Vielleicht. Ich bin dann aber erst sechs.«
»Die Mutter hat gesagt, bei Lehrer Buchbinder sind viele Kinder in der Klasse: sechs-, sieben- und sogar achtjährige.«
Ernst zählte an seinen Fingern ab.
»Oh, sogar achtjährige? Dann könnten meine Schwestern ja auch dorthin?«
»Da sind nur Jungen!«
»Hm.«
Friedrich Wilhelm überlegte. Dann kam ihm etwas anderes in den Sinn.
»Wann holt dich deine Mutter ab?«
»Wenn’s dunkel wird, hat sie gesagt. Sie muss noch Geld verdienen.«
»Wir könnten zur Residenz gehen. Dann zeige ich dir das Mühlrad. Du wirst sehen, es sieht genauso aus wie auf diesem Bild hier.«
Ernst wirkte unentschlossen.
»Ich kann dir auch das Wappen zeigen, das du gerne zeichnen können möchtest. Es befindet sich an einem Tor des Schlosses.«
»Dieses Wappen?«
»Es ist das Wappen des neuen Fürstbischofs!«
»Hast du den Bischof schon mal gesehen?«
»Noch nicht. Vater sagt, er ist ganz in Ordnung. Er ist ohne prunkvolles Fest nach Neuhaus gekommen.«
»Schade. Ich würde mich über ein schönes Fest freuen. Dann müsste Mutter einen Tag weniger arbeiten.«
»Kommst du nun mit? Meine Mutter lässt uns die wenigen Schritte gewiss alleine gehen.« –
Mutter Sertürner ließ sie gewähren. Auf dem Weg zum Schlosspark kamen sie am Haus der Altemeiers vorbei.
»Wir werden beobachtet«, flüsterte Ernst und wies mit dem Kopf zu einem Fenster, in dem sich ein Gesicht zeigte.
»Das ist Agnes. Früher habe ich mit ihr und mit ihrer Schwester Elsbeth gespielt.«
»Früher?«
»Früher waren Mutter und ich dort dienstags häufiger zu Gast. Aber jetzt hat Mutter keine Zeit mehr dazu. Seit Vater tot ist, muss sie immerzu arbeiten«, sprach Ernst betrübt.
Friedrich Wilhelm fasste Ernst an die Hand und zog ihn mit sich; tänzelnd, hopsend, hüpfend.
»Ich bin froh, dass du jetzt mit mir spielst! Vielleicht sind wir ja im Sommer bei Lehrer Buchbinder zusammen in einer Klasse.«
»Hm.« – Ernst blickte noch einmal zurück: »Ich glaube, Agnes weint.«
Lea Altemeier war überrascht: »Nanu Franz, da bist du ja schon. Heute ist doch Dienstag, ich dachte ...« Sie brach den Satz ab, als sie die Stimmung ihres Mannes gewahrte.
Übel gelaunt warf Altemeier seinen Rock über einen Stuhl. Er war überrumpelt und in die Schranken gewiesen worden. Unglaublich. Von einer Frau. Er konnte seine Wut kaum zügeln. Wieso hatte er nur die anonyme Anzeige verschwinden lassen, schalt er sich selbst einen Idioten. Damit hätte er dieses Weibsbild Irmtraud Grave in der Hand gehabt. Und jetzt? Jetzt war er dieser Erpresserin ausgeliefert. Er ranzte seine Frau an: »Es ist Dienstag. Na und? Hast du ein Problem damit?«
»Nein, natürlich nicht. Was ist los mit dir?«
»Wo sind die Kinder?«
»Ich nehme mal an, sie spielen in der Stube.«
»Folge mir in die Schlafkammer, und schließ die Tür!«
»Aber Franz, was ist denn nur? So kenne ich dich ja gar nicht!«
»Dann wird es Zeit, dass du mich richtig kennenlernst. – Runter mit dem Fummel!«
»Aber Franz ...«
»Ich sagte, zieh dich aus! Sonst reiße ich dir die Kleider vom Leib! Es wäre überdies nicht schade drum«, fügte er halblaut hinzu.
»Franz, so ungestüm? Früher warst du immer so zärtlich ...«
»Ich will nicht zärtlich sein! Ich will einen Sohn von dir! Hörst du? Einen Sohn!«
»Aber Franz, ich ...«
»Ich will kein Gezetere mehr hören, keine Ausflüchte, kein Getue. Oder glaubst du, ich könnte meinen Mann nicht mehr stehen?«
Franz warf Lea brutal auf das Bett. »Muss ich dich an deine ehelichen Pflichten erinnern?«
»Franz, die Kinder ...«
»Keine Widerworte! Keine Ausreden! Kein Hinhalten! Du bist mein Weib, und ich nehme mir mein Weib, wann immer es mir passt!«, schrie er und hörte in seinem Wahn nicht, dass Agnes die Tür der Schlafkammer öffnete.
Das Mädchen konnte nicht verstehen, was sich da abspielte. Geschockt sah es zu, wie sich die Finger der Mutter in die Matratze krallten, wie sie sich auf die Unterlippe biss, wie Tränen über ihr Gesicht flossen. »Gehst du mit deinen Flittchen auch so um?«, schluchzte Lea.
Verängstigt sah Agnes in die Fratze ihres Vaters, der sie mit Zornesröte anschaute. Scheu schlug sie die Augen nieder. Betroffen schloss sie wieder die Tür. Warum tat ihr Vater das? Warum fügte er der Mutter so viele Schmerzen zu? Weinend rannte Agnes an die Haustür, die sie verriegelt vorfand. Ihre Lippen bebten vor Angst. Sie stürzte ans nächste Fenster. Hier verharrte sie reglos. Auch das Fenster war nicht zu öffnen. »Vater ist böse und gemein. Er soll das nicht tun!«, klagte sie.
Da. Da stand Ernst und blickte zu ihr rüber. Jetzt ging er weiter. Ob er etwas bemerkt hatte? –
In den folgenden Wochen wurde Agnes von unzähligen Alpträumen gepeinigt. Sie verabscheute ihren Vater.
Drei
Harmonien und Missklänge
Die Kinderfreundschaft zwischen Ernst und Friedrich Wilhelm hatte auch drei Jahre später noch Bestand. Ernst fühlte sich zu dem wissbegierigen und klugen kleinen Sertürner und seiner Familie hingezogen. Friedrich Wilhelm hingegen mochte die ruhige und besonnene Art des Freundes. Dabei gab es sehr wohl auch Zeiten, an denen beide gerne herumtobten – im Garten, an der Alme oder im Park der Residenz. Dort beobachteten sie das Verhalten der Schwäne auf dem Wassergraben, der die Residenz umgab. Sie lauerten den Reihern auf, um sie fortzujagen, bevor die Fische ihnen zum Opfer fielen. Und sie studierten das Verhalten der Störche.
Schon im letzten Jahr hatten sie den Störchen nachzuspüren versucht, wenn das Paar seine Kreise zog und einander half, den Nachwuchs aufzuziehen. Jetzt wurde wieder gebrütet, und die Freunde waren neugierig, wie viele Junge wohl in diesem Jahr schlüpfen würden. Im Nordwesten des Schlossparks, dort wo die Lippe in die Alme mündet, hatten sie sich in den Schatten eines Wasserturms niedergelassen, als ein Parkgärtner zu ihnen trat. Er folgte ihren Blicken.
»So bünd se, de Adebaars«, schnaubte er abfällig. »Se mutt bröden. Un he hett de Arbeid. Is wegflogen. Mutt dat Freten halen. Un he da ...«, er zeigte zum Nistplatz, »he da is en frömd Stoork.« Sie folgten seinem Fingerzeig. »Dat lett de Oll behagen, dat he freeit.«
Entgeistert schauten die Jungen den Gärtner an, der seine Arbeitsschürze beiseite zog und sich ungeniert zwischen den Beinen kratzte. »En broken Ehe«, bemerkte er knapp. Er verzog seine Mundwinkel und schüttelte den Kopf. »Un de Oll markt nix«, ergänzte er voller Verachtung.
Was redete der Bedienstete da? Während die Störchin brütete und ihr Partner das Fressen besorgte, ließ sie sich auf einen fremden Storch ein? Von Ehebruch redete der Gärtner gar? Und ihr Partner würde nichts merken? »Sind sich die Störche denn nicht treu?«, fragte Friedrich Wilhelm irritiert.
Der Arbeiter zuckte mit den Schultern: »Dat is doch bi de Lüü ok nix anners.« Der Gärtner ging wieder seiner Arbeit nach.
Mit seinen Bemerkungen hatte er für ein großes Durcheinander in der Vorstellungswelt der Jungen gesorgt. Das sei doch bei den Menschen auch nicht anders, hatte er gesagt? Dem sollten sie wohl mal nachgehen, beschlossen die Jungen. Als sie in Gedanken versunken über die knirschenden Kieselsteine der Parkwege stapften, scheuchten sie eine Schar Sperlinge auf. Dafür hatten sie nun keinen Blick mehr übrig. Sie wandten sich dem Marstall zu. Sie verfolgten das Treiben des Schmieds, wie er ein Pferd beschlug. Teuflisch war der Gestank, als das noch fast glühende Eisen zischend auf den Huf traf. Von den Stallburschen ließen sie sich zeigen, wie die Pferde gepflegt, wie Zaumzeug, Wagen und Kutschen gewartet wurden. Gelegentlich hatten sie die Pferde schon mal ausführen und manchmal sogar auf ihnen reiten dürfen. Das war spannend. Doch heute hatten sie keinen Spaß daran; sie waren nicht bei der Sache. Ernst war enttäuscht vom Verhalten der Störchin. Und sowas sollte es auch unter den Menschen geben?
»Niemals«, meinte Friedrich Wilhelm dazu. »In unserer Familie niemals«, war er überzeugt.
Die Eltern Sertürners kümmerten sich nicht nur liebevoll um ihren Sohn und seine Geschwister, sondern ließen ebenso seinem Freund jedwede Fürsorge zuteilwerden. Gemeinsam machte es den Kindern Spaß, sich kritisch mit dem Verhalten auseinanderzusetzen, das das gesellschaftliche Leben erwartete. Nie wurden sie dazu gezwungen, sich blindlings diesen Normen anzupassen. Aber meistens nahmen die Kinder die Ratschläge von Friedrich Wilhelms Eltern gerne an.
»Wahrheit und Schein liegen oft sehr weit auseinander«, hatte Friedrich Wilhelms Vater einmal gesagt. »Und darum ist es uns weniger wichtig, euch die stumpfsinnige Pflege steifer Manieren beizubringen. Loyalität bedeutet für Viele blinder Gehorsam. Für uns bedeutet es Handeln aus Verantwortung. Dazu ist die Ausbildung eines guten Charakters notwendig, das Erlernen von Sanftmut und Herzensgüte und das adäquate Handeln danach. Das erfordert ein stetes Üben.«
»Und wie ist das mit der Treue?«, fragte Friedrich Wilhelm nachdenklich.
»Egal, ob zwischen Mann und Frau oder unter Freunden«, erklärte Vater Sertürner, »auch die Treue fällt nicht vom Himmel. Sie erfordert ein ständiges Bemühen und ein Gespür für die Bedürfnisse des anderen. Das ist oftmals leider sehr unterschiedlich ausgeprägt. Dann bedarf es viel Kraftaufwand und eines zähen Ringens; vor allem, eines eisernen Willens.«
»Das sagt Lehrer Buchbinder auch«, bestätigte Ernst. »Wenn alle so dächten und handelten, gäbe es weniger Streit, Hass und Krieg, hat er gemeint.« – Der alte Sertürner nickte. Man verstand sich.
Wenn es das Wetter erlaubte, verbrachte man viel Zeit im Garten der Sertürners. Er war klein und gepflegt – das Ergebnis unzähliger Stunden Betätigung durch Friedrich Wilhelms Mutter und seiner ältesten Schwester. Mit Begeisterung wurde gesät, gepflanzt und geerntet. Häufig schaute Ernst den Frauen über die Schulter. Die gezuckerten Mirabellen hatten es ihm besonders angetan. Er durfte naschen, wann immer er wollte. Meist half er aber auch, wenn die reifen Früchte von den Bäumen zu pflücken waren. Er hatte mitwirken dürfen, als eine Gartenlaube errichtet wurde. Er hatte sie geschmückt. Mit Girlanden aus Papierornamenten und altem getrockneten Eichenlaub.
Friedrich Wilhelm brachte die Geduld auf, stundenlang mit seinem Vater in der Werkstatt zu hantieren. Dann saß Ernst an einem kleinen Tischchen nah dabei und schmiedete Verse. Er konnte mit den Geheimnissen der Physik, mit den Wirkungsweisen der Mechanik, mit den Gesetzen der Statik und der Handhabung von Werkzeug wenig anfangen. Sein Metier war die Sprache. Er übte sich darin, über das Wort zu gebieten und strebte an, zu einem Meister der Formulierungen zu reifen. Irgendwann wollte er für alle lesbar niederschreiben, was ihn bewegte. In Gedichten oder in Romanen. Oder er würde andere wichtige Botschaften übermitteln wollen: Nachrichten, Ratschläge, Wissen – so, wie es im Intelligenzblatt niedergeschrieben stand. Doch dazu bedurfte es Sicherheit im Umgang mit der Orthographie und der Grammatik und im trefflichen Ausdruck. Hier habe er Talent, hatte ihm Lehrer Buchbinder bescheinigt. Und weil er im Lesen schon eine gute Fertigkeit erlangt hatte, hatte der Lehrer ihm die Geschichte über den Jungen Robinson an die Hand gegeben. Ernst war begeistert von dem Jungen, den es auf eine einsame Insel verschlagen hatte und der sich zu eigen machte, seinen Verstand und seine Hände zum Überleben zu gebrauchen; mehr noch, der den Wert von Geselligkeit und Freundschaft zu schätzen lernte. ROBINSON, DER JÜNGERE, hatte der Lehrer gesagt, geschrieben von einem Mann namens Campe. Wenn Ernst es in einigen Jahren einmal besser verstünde, gäbe er ihm den Abenteuerroman mit dem Titel ROBINSON CRUSOE von dem Schriftsteller Defoe zu lesen, hatte der Lehrer versprochen.
So unterschiedlich die Interessensgebiete waren, so entwickelte sich bei beiden Freunden ein Empfinden für Harmonie und Formvollendung. Gemeinsam war ihnen ihr Sinn für die Schönheiten, vor allem für die Pracht der Tier- und Pflanzenwelt.
Ernst war gerne bei den Sertürners. Das war häufig der Fall, wenn nicht gerade die Anforderungen des Schulunterrichts ihren Tribut forderten.
»So, Kinder, jetzt habe ich euch mein Herbarium gezeigt. Ihr seht, dass die Pflanzen auch nach langer Zeit noch ansehnlich sind. Man kann sie genau untersuchen, wann immer man möchte, wenn sie sorgfältig gepresst und auf einen Bogen Papier aufgeklebt wurden. Natürlich dürfen die Blüten, Früchte, Blätter, der Spross oder die Wurzel nicht beschädigt werden, weder beim Sammeln noch beim weiteren Hantieren.«
Lehrer Buchbinder gab einen einzelnen Dokumentationsbogen aus seinem Herbarium an einen Schüler und forderte ihn auf zu beschreiben, was dort zu sehen sei.
»Hier ist eine ganze Pflanze, eine Blume zu sehen«, stellte Friedrich Wilhelm fest. Daneben ist ein Name geschrieben: Leucojum vernum. Dann sehe ich eine einzelne Blüte, weißgefärbt und glockenförmig. An den Spitzen der Blütenblätter – es sind fünf, nein sechs – ist ein gelbgrüner Tupfen. Und ...«
»Sehr gut, Sertürner«, sagte der Lehrer, und was steht noch auf dem Bogen geschrieben?«
»Dann lese ich noch Ihren Namen, Herr Lehrer. Und ein Datum ... 27. März 1776 ... Aber hier steht noch etwas geschrieben: Eschenbachtal bei Lügde.«
»Das ist richtig. Für eine gute Ordnung in einem Herbarium ist es wichtig, dass man notiert, wann man die Pflanze gefunden hat, wo ihr Standort ist und um welche Pflanze es sich handelt. Es wird der lateinische Name notiert. Dazu kann noch die deutsche Bezeichnung aufgeschrieben werden. Hier handelt es sich um Märzenbecher – eine Blume, die oft schon früh im Monat März blüht; daher ihr Name. Nun, zuletzt sollte noch angegeben werden, wer der Finder der Pflanze ist ... So, in den nächsten Tagen werdet ihr Pflanzen sammeln. Nehmt euch einen Korb mit. Hier habe ich altes Zeitungspapier. Zwischen die Seiten der Zeitung könnt ihr die Pflanzen legen, trocknen und später pressen. Im Unterricht wollen wir in der nächsten Woche besprechen, welche Pflanzen ihr gefunden habt! Die Märzenbecher werdet ihr kaum mehr entdecken. Die sind schon verblüht!«
Clemens Buchbinder runzelte die Stirn. Nachdem er die Kinder aus dem Unterricht entlassen hatte, näherte sich ihm der Vater eines seiner Zöglinge. Der Lehrer wandte sich ab. Ihm stand nicht der Sinn nach einem Gespräch, bei dem er sich wieder sagen lassen musste, er würde die Schüler verweichlichen. Schon mehrmals war ihm vorgehalten worden, das Leben sei hart und erbarmungslos. Darauf müsse man die Kinder vorbereiten. Aber Clemens ließ sich nicht beirren. »Sollen meine Schüler ihren Kindern und Kindeskindern zukünftig dergleichen Willkür, Ungerechtigkeit und Grausamkeit antun, weil sie es selbst zuvor nicht anders erfahren haben? Das werde ich zu verhindern wissen!«, hatte er dem mürrischen Zeitgenossen kürzlich zu verstehen gegeben. – Clemens musste überrascht zur Kenntnis nehmen, dass sein einstiger Herausforderer inzwischen einen neuen Umgangsstil mit seinem Sohn zu pflegen schien. Man muss natürlich selbst Vorbild sein, dachte Buchbinder.
Er bemühte sich stets um viel Geduld bei der Wissensvermittlung. So schafften es auch die weniger begabten, sich zumindest die Grundlagen des Lesens, Schreibens und Rechnens anzueignen. Und die Jungen, deren Ehrgeiz und Interesse nur schwer zu wecken waren, lernten bei Buchbinder immerhin, einen guten Umgang miteinander zu pflegen, Achtung vor der Natur und seinem Nächsten zu entwickeln. Da Buchbinder selbst häufig nicht im Einklang mit dem von der Kirche gelebten Religionsverständnis und ihrer Wertevermittlung stand, hatte er bei seiner Anstellung erfolgreich darauf hinwirken können, dass ihm die religiöse Erziehung der Kinder erspart blieb. Das übernahm Kaplan Crux – und wie es schien derart geschickt, verständlich und überzeugend, dass auch Buchbinder damit leben konnte.
Der Lehrer schmunzelte, als er an seinen Adoptivsohn Ludwig dachte. Auch der geriet jetzt zunehmend häufiger unter die Fittiche des Kaplans. Elisabeth war damit einverstanden, denn Adam Crux teilte im Wesentlichen ihre Auffassungen und die ihres Mannes. Sie alle konnten pietistische Frömmelei bei gleichzeitiger Heuchelei, Verunglimpfung Andersdenkender und deren Denunziation nicht ausstehen.
»Ludwig wird schon früh genug erfahren müssen, dass es irgendwann mit der Verzärtelung vorbei sein wird«, hatte der Kaplan angemerkt, und Clemens hatte ergänzt:
»Bis dahin soll er eine angstfreie Kindheit genießen, an die er sich gerne erinnern wird.«
Tatsächlich schien der kleine Ludwig das Leben im Hause der Buchbinders zu genießen. Aus dem anfänglich dürren Knaben mit dem hellen Flaum auf seinem Kopf war ein »drolliges Kerlchen« geworden, wie manche sagten – mit dichten schwarzen Locken. Einige beschrieben ihn wegen seiner stämmigen Beinchen als »pummelig«. Das nahmen seine Eltern vorerst stillschweigend hin. Für sie war wichtig, dass Ludwig ein unkomplizierter, fröhlicher Junge wurde. Andere, die über seine Herkunft nichts wussten, droschen Phrasen: Die großen dunklen Augen habe er wohl von seiner Mutter Elisabeth. Nein, diese Ähnlichkeit! – Und von wem hat er den Bart? lag Clemens zu fragen auf der Zunge. Aber er hielt sich bedeckt. Er wollte ja niemanden bloßstellen. Die Adoptiveltern amüsierten sich. Man dachte sich seinen Teil.
Häufig erzählte Elisabeth ihrem kleinen Ludwig Geschichten, sang mit ihm alte Kinderlieder, während sie ihn an die Hand nahm und übermütig mit ihm tanzte. Er tanzte gerne und sang mit. Beide hatten ihren Spaß.
Schon früh hatte er immerzu gebrabbelt, als wollte er alles Wahrgenommene kommentieren. Er hatte hierhin und dorthin gezeigt und nachgeplappert, was man ihm vorsagte oder was er zufällig aufschnappte. In seinem Adoptivvater hatte Ludwig einen begeisterten Förderer, denn er teilte die Interessen seines Vaters für all das, was die Natur hergab. Er ließ sich faszinieren vom Plätschern des Wassers an der Mühle, vom Gänsegeschnatter, vom Vogelgesang. Das Jubilieren der Amseln ließ ihn interessiert aufhorchen. Früh lernte er sie von einem Sperling zu unterscheiden, und auch den Ruf des Kuckucks erkannte er schnell wieder. Er kuschelte sich gerne an seinen Vater und kraulte den buschigen leicht rötlichen Vollbart des stattlichen Mannes, wenn der ihm den Mond und die Sterne zeigte. Dabei war es nicht wichtig, dass der Junge die Erläuterungen verstand. Wichtig war, die tiefe, wohlklingende und beruhigende weiche Stimme zu hören. Er mochte es, wenn der Duft der selbst gesammelten Lindenblüten die Stube erfüllte. Wenn er es seinen Eltern gleichtat und raschelnd das Sammelgut wendete, das zum Trocknen auslag. Wenn er das Körbchen halten durfte, das voller und voller wurde, während die Eltern mit Akribie ernteten. Er mochte das betörend süße würzige Aroma, das die blühenden Bäume absonderten, wie ihm Clemens erklärte. Und ihn faszinierte der Regen der goldgelben Blüten, wenn sie auf die ausgebreiteten Tücher fielen. Für das Sammeln von Kamille und Minze war er hingegen nicht so sehr zu begeistern. Hierfür hatte er meist nur eine abweisende Geste übrig. Im Herbst würden sie erstmalig Haselnüsse und Bucheckern sammeln. Darauf freute sich Clemens schon insgeheim. Bisher hatte man davor zurückgeschreckt. Denn Ludwig steckte meist alles in den Mund, um seine Welt zu erkunden. Später, so war sich Buchbinder sicher, würden die Tage im Studierzimmer nie trist werden. Der Lehrer fühlte sich berufen, seinem Sohn stets seine besondere Fürsorge angedeihen zu lassen. Clemens überhäufte ihn mit Zuneigung und übersah das ein oder andere Fehlverhalten geflissentlich. Wie gegenüber seinen Schülern, so behandelte Buchbinder seinen Sohn gutmütig und pflegte einen stets freundlichen Umgangston. Meist waren es honigsüße Schmeicheleien. Mit seinem sonnigen Gemüt dankte es der Kleine seinen glücklichen Eltern.
Friedrich Wilhelm und Ernst begaben sich auf den Weg zur Alme. Doch bevor sie nach irgendwelchen Pflanzen Ausschau hielten, um ihrer Hausaufgabe nachzukommen, ließen sie sich von Vögeln ablenken, die im seichten Wasser zwischen Wasserpflanzen ihre Nester bauten. Die Kinder sammelten Schneckenhäuser, suchten geeignete Stellen, wo sich mit Hilfe von Zweigen, altem Laub, kleinen Steinchen und Erde Staudämme bauen ließen. Sie suchten zu ergründen, wohin die Rindenstückchen entschwanden, wenn sie in den Sog von Wasserstrudeln gerieten. Dann ließen sie flache Steinchen über die Wasseroberfläche hüpfen. An einer Stelle war das Wasser glasklar. Ernst watete hindurch, nachdem er seine Schuhe ausgezogen hatte.
»Huh, ist das kalt!«, juchzte er, griff mit einer Hand ins kühle Nass und bespritzte Friedrich Wilhelm keck. Doch der interessierte sich mehr für die grün bewachsenen Felsblöcke, mit denen an einer anderen Stelle das Flussufer befestigt worden war. Insekten tanzten im Sonnenlicht.
Endlich begaben sie sich auf einen schmalen Pfad. Mäuse verschwanden raschelnd im Unterholz. Die Jungen entdeckten Schlüsselblumen, Buschwindröschen, Günsel und Sumpfdotterblume, Lerchensporn und Lungenkraut. Und am Rande eines kleinen Wäldchens nahmen sie den würzigen Duft des Bärlauchs wahr.
Sie legten eine Pause ein, aßen Brot und Apfel. Ernst scharrte ein wenig den Boden beiseite, um einige schon etwas verwelkte Blumen, Zeitungsschnipsel, Apfelgehäuse und Brotreste zu verbuddeln. Dabei ertastete er etwas, das sich nach einer Wurzel anfühlte, allerdings ... Die Oberfläche schien überraschend glatt. Vielleicht war dies ein Knochen von einem Tier. Die Freunde, die sich bekanntermaßen für alles in der Natur begeistern konnten, wurden neugierig. Mit einem Stück Baumrinde schabten sie den Erdboden weg. Und tatsächlich kam ein längerer Knochen zum Vorschein. An dem einen Ende tauchten in klauenartiger Haltung die skelettierten Finger einer Hand auf. Aber da waren auch Kleidungsreste. Als sie immer mehr von einem vergrabenen Menschen freilegten, wurde es den Beiden unheimlich. Sie entschlossen sich, die Eltern zu informieren. Während Ernst Zweige sammelte, mit denen sie ihren grausigen Fund bedeckten, entdeckte Friedrich Wilhelm einen goldfarbenen Gegenstand – sehr verdreckt, ein Schmuckstück vielleicht. Das steckte er in die Tasche, und dann eilten sie schnell nach Hause.
»Schwager, eigentlich müsste ich dir ja noch böse sein, dass du meine Schwester geheiratet hast.«
»Ach, Lea, ich habe es auch schon so manches Mal bereut. Aber du und ich? Das ständige Unterwegssein mit unserer Schauspielertruppe wäre doch auf Dauer nichts für dich gewesen.«
»Da magst du recht haben, Georg.«
Lea schaute in den Spiegel und lächelte das Gesicht ihres Schwagers an. Seine kräftigen unbedeckten Oberarme, die nackten Schultern, seine spärlich behaarte entblößte Brust und sein hüllenloser Bauch erregte sie. Der Körper, der sich von hinten an sie drängte, machte sie rasend. Seine zarten Küsse, mit denen er ihren Hals bedeckte, erzeugten einen wohligen Schauer. Nur in ein Laken gewickelt lehnte sie sich an ihn und spürte seine aufstrebende Männlichkeit. Sie schloss die Augen. Sie inhalierte den süßlichen Rauch aus dem Opiumpfeifchen, das ihr Schwager mitgebracht hatte. Sie kostete die neue Entdeckung aus, das Laster, das Verruchte, das Schäbige, das Verbotene. Es vermittelte ihr ein besonderes Gefühl des Triumphs; der Macht. Endlich konnte sie es ihrem Ehemann heimzahlen. Es war die Strafe für die Erniedrigungen, die Demütigungen, die Grobheiten. Vergeltung war das, was Lea seit einiger Zeit antrieb. Sie zog Georgs Kopf zu sich und küsste ihn.
»Seit wann, sagst du, seid ihr wieder in der Stadt?«
»Es ist ...«, er liebkoste sie, und sie schnurrte wie ein Kätzchen, »es ist die dritte Woche.«
»Was macht Wilhelmine?«
»Erkundet mit unserer Tochter Sophie die Bretter, die die Welt bedeuten.«
»Und sie ahnen nichts?«
»Ahnt denn dein Mann etwas?«
»Wie sollte er? Dienstags lebt er sein anderes Leben. Das war schon immer so.«
»Nur dienstags?«
Sie zuckte mit den Schultern.
»Und deine Zwillinge?«
»Auch die werden älter und treiben sich meistenteils bei ihren Freundinnen rum.«
»Du lässt sie gewähren? Spannst sie nicht ein, um dir im Haushalt zur Hand zu gehen?«
»Was soll ich tun? – Soll ich sie als Mägde missbrauchen? Oder soll ich sie zu hirnlosen Püppchen erziehen? – Nein, nein. Jenseits dieser Mauern werden sie eher lernen, was fürs Leben wichtig ist. Sie sind doch schon acht, in wenigen Jahren werden sie heiraten. – Aber natürlich bin ich schon auch für sie da. Nicht, dass du denkst ...«
»Und der Vater?«
»Der Vater? – Völlig unfähig. Aber das habe ich leider erst zu spät erkannt«, seufzte Lea.
»Na, so unfähig kann er doch nicht sein. Er ist doch immerhin Amtmann geworden.«
»Weil ich ihm die Position verschafft habe.«
»Du? – Wie hast du das denn geschafft?«
»Mit den Waffen einer Frau?«, antwortete Lea mit einer Gegenfrage und kokettierte mit einem Augenaufschlag, der jeden Mann aus der Fassung brachte.
»Bei dem Einsatz dieser Waffen bist du unschlagbar!«
Lea drehte sich zu ihm um und ließ das Laken fallen. »Sehen wir uns am nächsten Dienstag wieder?«
»Dienstag? – Da muss ich wohl meinen Terminkalender befragen. Ob ich dann allerdings wieder von dem Opium mitbringen kann ...«
»Kannst du mich denn nur im Rausch ertragen?«, wisperte sie ihm ins Ohr.
»Du sagst Sachen. Aber nicht doch, meine Liebe. Du betörst mich weit mehr als der intensivste Opiumrausch. Allerdings: Auf keinem Fall möchte ich dem Franz begegnen. Nicht, dass er mich noch eines Tages zum Duell fordert.«
»Georg Bürger, du bist ein Feigling, ein ganz charmanter liebenswerter Feigling. Komm zu mir, kleiner Feigling, und gönn mir den Nervenkitzel!«
»Der sei dir gegönnt, Lea.«
Prickelndes Verlangen sammelte sich in ihrem Schoß. Sie schlang die Arme um seinen Hals und ihre Beine um seine Taille, während er ihr stützend unter die Hinterbacken griff und sie zum Kanapee trug.
Die älteste Tochter der Sertürners reichte ihrer Mutter und ihrem Vater, der soeben in Begleitung des Kaplan Adam Crux von einer Inspektion der Almebrücke zurückgekehrt war, den Tee, als die Haustüre aufgerissen und kurz danach wieder heftig zugeschlagen wurde. Polternd drängten die Jungen in die Wohnstube und man sah ihrem jeweiligen Gesichtsausdruck an, dass etwas Ungewöhnliches geschehen sein musste.
»Vater, wir haben soeben etwas ganz Merkwürdiges entdeckt«, rief Friedrich Wilhelm erregt aus.
»Friedrich Wilhelm, ein gut erzogener Junge begrüßt doch wohl zuerst seinen Taufpaten«, mahnte die Mutter.
Überrascht schaute Friedrich Wilhelm seine Mutter an. Seine Stirn zog er in Falten. Einen derartigen Satz hatte seine Mutter schon lange nicht mehr gesagt. Wie peinlich! Aber er machte nicht viel Aufhebens davon und zeigte sich gehorsam.
»Guten Tag, Friedrich Wilhelm!«, grüßte Kaplan Adam Crux. »Wie ich höre, wollt ihr in der Schule ein Herbarium gestalten? Ich vermute, ihr habt jede Menge Pflanzen gefunden, stimmt’s?«
Friedrich Wilhelm begrüßte den Kaplan, umarmte Mutter und Vater und wollte seinen Paten antworten, dass sie vor Schreck alle ihre Funde liegengelassen und vergessen hatten. Derweil konnte sich Ernst nicht mehr zurückhalten und berichtete von dem grauenhaften Fund.
»... Dann ragten da die Fingerknochen einer Hand in die Höhe und ...«, hauchte er entsetzt und schlug die Hände vor den Mund.
»Na, Ernst, da habt ihr scheint’s etwas Ungeheuerliches erlebt. Das werden wir uns wohl mal näher anschauen müssen, was?«, antwortete Friedrich Wilhelms Vater. »Aber sag mal, musst du nicht bald nach Hause? Oder wo ist deine Mutter heute beschäftigt?«
»Sie wird wohl erst spät wieder zurückkommen«, schloss Ernst, als er Auskunft gegeben hatte.
Die Sertürners waren informiert, dass sich Irmtraud Grave seit drei Jahren neben ihrer Arbeit im Marstall auch noch in der Junfermannschen Hofbuchdruckerei ein kleines Zubrot verdiente. Dort wurden Volksschulbücher für das Hochstift Paderborn und das Paderbornische Intelligenzblatt gedruckt und verlegt. Mutter Grave sortierte in der Druckerei die Lettern und räumte die Arbeitsplätze auf. Und auch im Erbmeierstättischen Eigenhaus sorgte sie gelegentlich für Ordnung. Dort, an der Ecke zur Neuhäuser Kirchstraße, würde sie gerade zu tun haben, hatte Ernst berichtet.
Die Eltern entschieden, dass die Jungen bei Friedrich Wilhelms Mutter bleiben sollten. Der Vater wollte sich zunächst gemeinsam mit dem Kaplan ein eigenes Bild von der Darstellung der Kinder machen, bevor man die Behörden informierte. Sie ließen sich die genaue Lage der Stelle beschreiben, wo die Kinder den verscharrten Körper gefunden hatten, nahmen sich etwas Werkzeug zum Graben mit und begaben sich auf den Weg.
Eine kleine Weile später – die Kinder hatten sich mit der Mutter in den Garten begeben – griff Friedrich Wilhelm in seine Hosentasche und ertastete das Schmuckstück, das er schon gänzlich vergessen hatte.
»Und schau nur, Mutter, das habe ich auch bei den Knochen gefunden«, sagte Friedrich Wilhelm und erklärte seinem Freund, was er entdeckt hatte.
»So etwas hatte meine Mutter auch mal«, bemerkte Ernst.
»Es sieht aus wie ein Medaillon ..., etwas verrostet ... Mal sehen, ob wir es öffnen können«, sprach die Mutter, während sie an dem Verschluss hantierte und die Jungen ihr neugierig über die Schulter blickten.
Als die Verriegelung mit einem Klicken aufsprang, trat ein großes Staunen auf die Gesichter der drei Betrachter. Sofort erkannten sie die beiden männlichen Köpfe, die das Innere des Schmuckstücks barg: Die filigran gearbeiteten Scherenschnitte zeigten unverkennbar den kleinen Ernst und seinen Vater Hermann im Profil.
Irmtraud Grave spürte, wie das Blut aus ihrem Gesicht wich. Ihr Gleichgewichtssinn setzte aus, ihr wurde schwindelig, und ihre Beine wollten sie nicht mehr tragen. Kurz lehnte sie sich an die Türzarge. Hätte Sertürner sie nicht sofort gestützt – sie wäre zu Boden gesunken.
»Madame, setzen Sie sich«, sagte er und führte sie zu einem Schemel. Sprachlos war sie zunächst, nachdem die Sertürners ihr im Beisein des Herrn Kaplan das Medaillon gezeigt hatten, das sie schon seit so langer Zeit vermisste. Es entglitt ihrer zitternden Hand, als sie erfuhr, wo man es gefunden hatte. Dann erschienen ihr alle Details der damaligen Ereignisse in ihrer Erinnerung, und Tränen schossen ihr in die Augen. Sie berichtete von dem Dilemma, in dem sie einst gesteckt hatte. Von ihrer Wut, weil sie befürchtete, ihr Mann habe mit Johanna Grünberg ein Verhältnis gehabt. Von ihrer Vermutung, Johanna habe den Unfall in der Glasbläserei herbeigeführt. Von ihrer Verzweiflung, als sie ihr Leben und das ihres Jungen zerstört sah. Und sie beteuerte, keine Schuld an Johannas Tod zu haben. Als sie an jenem Tag am frühen Morgen Johanna aufgesucht habe, um sie zur Rede zu stellen, hätten urplötzlich die Geburtswehen eingesetzt. Und natürlich habe sie sich verantwortlich gefühlt, der werdenden Mutter bei der Entbindung beizustehen. Unmittelbar nach der Geburt habe Johanna ihr Bewusstsein verloren und sei wenig später gestorben. Sie habe sich nur noch zu helfen gewusst, den kleinen Säugling nach einer Erstversorgung zur Kaplanei zu bringen und die Tote zu begraben. Die wenigen Besitztümer der Toten habe sie verschwinden lassen, und beim Amt habe sie Bescheid gegeben, Johanna habe ihre Unterkunft mit all ihren Habseligkeiten scheinbar verlassen.
Niedergeschlagen wirkte Irmtraud nach ihrer Beichte. Eine große Leere empfand sie – zunächst. Dann spürte sie wieder, wie ihr die Ereignisse seit jener Zeit auf der Seele gelegen hatten. Die Bedrückung, die nun endlich einer großen Befreiung gewichen war. Endlich hatte sie aussprechen können, was die ganze Zeit ihr Gemüt belastete. Was auch immer nun folgen sollte, sie würde es ertragen.
Mit unerwartet gemäßigten Vorwürfen machten ihr die Männer Vorhaltungen und äußerten die Erwartung, dass Irmtraud zu den Vorkommnissen stehen und den Behörden die Wahrheit gestehen solle.
Derweil versuchte Mutter Sertürner Verständnis für das Verhalten der Frau zu entwickeln. Es gelang ihr, Kaplan Crux und ihren Mann zu überzeugen, dass niemandem damit gedient sei, wenn der Fall Grave neu aufgerollt werde. Vor allem – was würde aus dem Sohn Ernst werden? Selbst wenn die Mutter von Rechts wegen freigesprochen werden sollte – der Ruf der Familie wäre zerstört. Sicher verlöre Irmtraud die Arbeit und auch für Ernst gäbe es in Neuhaus und Paderborn kaum jemals eine gute berufliche Zukunft. Und schließlich, inwieweit hatte Irmtraud sich denn tatsächlich schuldig gemacht? Ja, sie hätte den Tod von Johanna anzeigen müssen. Ja, Johanna hätte ein anständiges Begräbnis bekommen sollen. Aber wer weiß, ob ihr das überhaupt zugebilligt worden wäre. Es lag schließlich auf der Hand, dass man ihr verwerfliches Verhalten und den unehelichen Balg nicht tolerieren würde.
»Wenn wir Stillschweigen wahren, können wir in Teufels Küche kommen!«, überlegte der Kaplan laut.
»In Teufels Küche?«, echote Sertürner. »Aber Kaplan, in Ihrer Stellung?«
»Mein lieber Josephus Simon, Sie scherzen? – Aber ehrlich gesagt, ich weiß auch keinen anderen Rat. Ich bin ratlos und beinahe auch sprachlos.«
Sertürners Augen funkelten: »Das, lieber Kaplan, sollte einem Mann der Kirche nicht passieren!«
»Ihren Humor möchte ich haben, Sertürner!«, seufzte Adam Crux und war schließlich doch dazu bereit, die Angelegenheit zu vertuschen. Lediglich die Familie Buchbinder sollte informiert werden, damit die Pflegeeltern ihrem Adoptivkind Ludwig zu gegebener Zeit Auskunft über seine Mutter geben konnten. Und natürlich mussten auch die Jungen verschwiegen mit den Informationen umgehen. Gerüchte würden schnell ein Eigenleben entwickeln.
»Wir sind jetzt richtige Geheimnisträger!«, schworen sich die Freunde aufeinander ein. Dabei verspürten sie mehr den Hauch eines Abenteuers, als dass sie das ganze Ausmaß der Situation überblicken und bewerten konnten.
Auch wenn die Familie Grave als Protestanten einer anderen christlichen Religionsgemeinschaft angehörten, so verspürte Kaplan Crux nun doch auch einen seelsorgerischen Auftrag. Vor allem durfte das Vertrauen von Ernst gegenüber seiner Mutter nicht erschüttert werden. Mutter und Sohn ließen es dankbar zu, dass sich der Kaplan um sie kümmerte. Schließlich legte er selbst Hand an und setzte sich dafür ein, dass die sterblichen Überreste der Johanna Grünberg in aller Stille in geweihter Erde bestattet wurden.
»Madame Grave«, hatten die Sertürners und der Kaplan gesagt, »wir werden Ihnen wieder auf die Beine helfen. Aber gehen müssen Sie selbst!«
Irmtraud hatte dazu nur beipflichtend nicken können. Wenn auch mit einem gewissen Unbehagen, so prägten doch Güte und Mitmenschlichkeit den weiteren Umgang mit ihr. Das vermochte die Betroffene einerseits zu würdigen. Ob es ihr andererseits jedoch auch ein schlechtes Gewissen bereitete? Denn Irmtraud Grave hatte nur einen Teil der Wahrheit preisgegeben. Verschwiegen hatte sie, dass sie bei den Habseligkeiten der Johanna Grünberg ein Tagebuch entdeckt hatte.
Irmtraud hatte die letzten Notizen von Johanna aus dem Tagebuch entfernt und übte weiter Druck auf den Amtmann Altemeier aus. Denn die nun noch vorhandenen Tagebucheinträge schienen eindeutig zu enthüllen, dass Franz der Vater des nunmehr dreijährigen Ludwig Buchbinder war.
Johanna hatte vermerkt, dass sie im März 1788 in Neuhaus eingetroffen war. In einem Kloster bei Soest war sie aufgewachsen, hatte das Lesen und Schreiben sowie das Rechnen gelernt. Sie hatte sich während der Ausbildung als Novizin prüfen wollen, ob sie dazu berufen sei, die Ordensgelübde, die Armut, die Ehelosigkeit und den Gehorsam abzulegen und hatte erkannt, dass sie sich nicht für eine klösterliche Zukunft begeistern konnte. Neben den schönen Erfahrungen in der Gemeinschaft waren es vor allem die Zudringlichkeiten eines Theologie-Lehrers, die ihren Glauben und ihr Vertrauen stark erschüttert hatten.
Als gedemütigtes Verführungsopfer war sie letztlich geflohen und konnte sich glücklich schätzen, dass sie auf eine kleine Mitgift ihrer Eltern, an die sie sich nicht mehr erinnerte, zurückgreifen konnte. An ihrem sechzehnten Geburtstag hatte sie ihren Schatz von der Mutter Oberin ausgehändigt bekommen, die ihr nachdrücklich nahegelegt hatte, das Geld ihrem klösterlichen Zuhause zu stiften. Glücklicherweise war sie nicht so einfältig gewesen, auf die bescheidene Mitgift zu verzichten.
Nach ihrer Flucht hatte sie sich unter den Schutz einer Pilgergruppe begeben können, die unterwegs auf dem Rückweg von Dortmund nach Höxter war. So gelangte sie auf der wichtigen historischen Handels- und Pilgerstraße entlang dem Hellweg fast bis nach Paderborn. Da es schwierig schien, in Paderborn Unterkunft und Arbeit zu finden, war sie einem Rat gefolgt und weiter nach Neuhaus gezogen.
Bei ihrer Anmeldung hatte ihr der freundliche Amtmann empfohlen, beim Glasbläser Grave vorstellig zu werden. Es war wohl bekannt, dass der Glasbläser ein Quartier zur Verfügung stellen konnte.
Johanna war es gewohnt, in bescheidenen Verhältnissen zu leben. Im Kloster hatte sie sich eine kleine Zelle mit einer anderen Bewohnerin teilen müssen; auch die Unterkünfte für die Pilger waren nur mit dem Wenigsten ausgestattet gewesen.
Über das Angebot des Glasbläsers war Johanna glücklich gewesen. Er hatte ihr eine Baracke zugewiesen, in der während des Siebenjährigen Krieges verletzte Soldaten und einige Jahre später Gehilfen der Glasbläserei untergebracht waren.
Hier wollte sie vorübergehend bleiben, vielleicht noch während des nahenden Frühlings. Sie wollte sich eine Arbeit suchen; dann würde sich gewiss etwas Wohnlicheres finden lassen. Merkwürdigerweise hatte Hermann Grave für die Unterkunft kein Geld verlangt und lediglich gemeint, Johanna könne sich ihm gewiss eines Tages »erkenntlich zeigen«.
In der Folgezeit hatte es eine Begegnung mit dem Amtmann Altemeier gegeben – einmal zufällig, dann hatten sie sich verabredet. Und weil sie mehr als nur Sympathien füreinander entdeckten, hatten sie sich immer häufiger getroffen. Am Anfang sehnte sie sich nach seiner Art, die ihr einen fast väterlich stützenden Halt zu geben schien. Erstaunlich schnell hatte sie Vertrauen zu ihm gefasst. Dann hatte sich die bloße Sympathie in Zuneigung gewandelt. Er fand immer Orte, an denen sie zusammenkommen konnten. Sie mochten sich sehr. Und darum verdrängte Johanna auch das Problem, als sie erfuhr, dass Franz Altemeier verheiratet war und zwei Töchter hatte. Franz unterstützte sie mit Geld und versprach ihr, er würde einen Weg finden, wie sie zusammenbleiben könnten. Natürlich müsse sie sich keine Arbeit suchen, sondern nur etwas geduldig sein. Er würde sich bemühen, eine gemeinsame Unterkunft für die Zukunft zu finden. Verwirrt hatte er sie – derart, dass sie nicht einmal moralische Skrupel hegte. Darüber war sie selbst ob ihrer streng religiösen Erziehung sehr erstaunt. Aber vielleicht musste es so sein, dachte sie. Nicht ohne Grund war sie schließlich diesem Leben ihrer Vergangenheit entflohen.
Glasbläser Grave war es nicht verborgen geblieben, dass Johanna und Franz sich bestens verstanden. Und dann hatte er sie für seine Zwecke eingespannt. Er benötigte für den Ausbau seiner Glasbläserei Genehmigungen vom Amt.
Natürlich war es für Franz Altemeier kein Problem, diese oft langwierigen Genehmigungsverfahren schnell zum Abschluss zu bringen.
Eine Hand wäscht die andere, dachten sich Hermann Grave, Franz Altemeier und Johanna Grünberg. Und so nahm es seinen Lauf, dass man einander gefällig war, bis ...
Es war im Herbst 1788, als Johanna ihrem Franz offenbart hatte, dass sie wohl ein Kind bekommen würde – von ihm, so hatte Franz die Nachricht wohl gedeutet. Ihre Freude wurde schnell getrübt, als Franz sie spüren ließ, dass er darüber gar nicht glücklich war. Natürlich hatte Johanna ihn angefleht, dass er sie nun nicht im Stich lassen möge. Aber er zog sich merklich zurück, und es wurde offensichtlich, dass sich seine Gefühle für Johanna deutlich abkühlten. Man traf sich immer seltener. Und auch seine finanzielle Unterstützung stellte er nach und nach ein. Als sie ihn angeschrien hatte, dass sie ihr Verhältnis bekannt machen würde, hatte er ihr die Tür gewiesen. Nun war die Geldquelle endgültig versiegt, und Johanna konnte nur noch auf ihre Reserven aus ihrer Mitgift zurückgreifen.
Mit diesen Informationen vom Oktober des Jahres endeten die Eintragungen im Tagebuch, wobei – wie schon angemerkt – die folgenden Seiten herausgetrennt worden waren.
Vier
Unersättlich
Im Verlauf des letzten Jahres hatte sich Lea Altemeier noch mehrmals mit ihrem Schwager getroffen. Einige Wochen nach der letzten Begegnung, die sie voller Lust und Leidenschaft ausgekostet hatte, begab sie sich nach Paderborn. Sie hatte eine Mietkutsche genommen, um die Distanz einer knappen Meile zügig zurücklegen zu können. Ihren Töchtern hatte sie das Versprechen abgenommen, eigenständig und nicht zu spät ins Bett zu gehen. Glücklicherweise konnte sie sich wenigstens auf ihre Zwillinge verlassen.
Es dunkelte, als sie Paderborn erreichte. Am Neuhäuser Tor ließ sie die Kutsche anhalten. Hier stieg sie aus, um noch einige Schritte in der lauen Luft des Abends zurückzulegen. Einige Augenblicke betrachtete sie fasziniert den funkelnden Sternenhimmel, dann schlug sie gezielt den Weg über einen gepflasterten Platz ein. Nur wenig später fand sie sich vor dem barocken Portal eines mehrstöckigen alten, ehemaligen Bürgermeisterhauses wieder. Sie blickte zu dem vom Sternenlicht beschienenen Mittelerker, hinter dem sie einen prunkvollen Saal gelegen wusste. Einmal mehr staunte sie, dass sich ein Oberamtmann ein derart prachtvolles Haus leisten konnte. Schon damals war sie darüber verwundert gewesen, als sie hier wegen Franz vorstellig geworden war. Kurz bedauerte sie es, dass sie ihrem Mann bisher die Details darüber verschwiegen hatte, wie sie einst hier ihren Körper als Ware feilgeboten hatte. Für den Fortbestand ihres ehemals guten Ehelebens wäre es vielleicht von Vorteil gewesen, wenn Franz zu schätzen gelernt hätte, dass er seine Anstellung ihrem damaligen Opfergang zu verdanken hatte. Kurz geriet sie wieder einmal darüber ins Grübeln. Sie hatte ihn so geliebt. Sie hatten sich beide leidenschaftlich geliebt. Aber nach der Geburt der Zwillinge hatte sich sein Sinnestaumel abgekühlt. Warum nur spickte Franz seine zunehmende Ablehnung jetzt mit Gehässigkeiten? Einmal hatte sie geglaubt, die Veränderungen seines Verhaltens schon während der Monate vor ihrem fünfundzwanzigsten Geburtstag beobachtet zu haben. Aber dann hatte er für sie ein rauschendes Fest arrangiert und sie mit Geschenken überhäuft. Sie schüttelte den Kopf. Sie gab es auf, nach den Ursachen für den schlimmen Wandel zu suchen. Widerwillig fand sie sich mit seiner Gereiztheit und Boshaftigkeit ab.
Lea drehte sich um, ließ den Blick über den Platz, in die angrenzenden Gassen und zu den Häuserfassaden schweifen. Als sie sich unbeobachtet wähnte, entnahm sie ihrem ledernen Jägerrucksack ein Billett und eine blaugrünlich schimmernde Maske mit grausilbern schillerndem Federschmuck. Beides hatte sie im Bett ihres Mannes unter der Matratze entdeckt. Es war eine Einladung seines Vorgesetzten zu einem Maskenball – eine Einladung, die auch an sie gerichtet gewesen war. Offensichtlich wollte Franz sie bei diesem gesellschaftlichen Ereignis nicht dabei haben, denn er hatte ihr die Einladung verschwiegen. Warum nur, hatte sie sich mehrfach gefragt. Die Antwort ahnte sie, aber sie war sich nicht sicher. Vielleicht war es ja nur eine Vorsichtsmaßnahme, denn offizielle Maskenbälle waren im Fürstbistum seit einiger Zeit verpönt. Nie wurde ein karnevalistischer Trubel für gut geheißen. Stets gab die Obrigkeit vor, der Verrohung der Sitten Einhalt gebieten zu müssen. Dem Verwerflichen, der Sündhaftigkeit, der vorsätzlichen Missachtung des Anstands musste getrotzt werden. Aber wer wollte schon kontrollieren, was man privat so trieb. Aus dem Fundus der Schauspieler-Gesellschaft ihres Schwagers hatte sich Lea ein Kostüm geborgt. Farblich passend zur Maske war sie als Försterin verkleidet.
Noch einmal vergewisserte sie sich, dass sie nicht beobachtet wurde. Sie nahm ihren Kapuzenmantel ab und verstaute ihn in dem Rucksack. Eine Flinte wurde geschultert, nachdem sie diese ihrer Schutzhülle entnommen hatte. Zuletzt streifte sie sich ihre Maske über. Schließlich bediente sie den Türklopfer.
Streichermusik, ein Gewirr an Stimmen und ein wiederholt ausgestoßenes schrilles Gelächter drang an ihr Ohr, als die Tür von einem Bediensteten geöffnet wurde. Er ließ sich Leas Billett zeigen und verglich den Namen mit einer umfangreichen Liste, die in einem Gästebuch mit einem tiefblauen Einband aufgeführt war. Er legte das Buch beiseite und bot sich an, den neuen Gast von seinem Rucksack zu befreien.
»Vielen Dank, aber der Rucksack gehört zu meiner Verkleidung«, ließ sie ihn wissen.
Er bedeutete ihr, sich einige Momente zu gedulden, verabschiedete sich mit einer tiefen Verbeugung und stolzierte davon, um den Hausherrn zu informieren. Es dauerte nicht lange, bis der Gastgeber erschien und ebenfalls einen Blick in das Gästebuch warf. Wie Lea, so trug auch er eine dieser bedrohlich wirkenden venezianischen Vogelmasken mit dem sehr langen, nach unten gebogenen Schnabel – eine Maskierung, die seinen Kopf vollständig bedeckte und nur wenige Schlitze zum Sehen und Atmen offenhielt. Zwei furchterregende Grimassen schauten einander an. Nicht minder unheimlich war die metallisch klingende Stimme.
»Frau Försterin, es ist mir eine außerordentliche Ehre, Sie begrüßen zu dürfen. Ich hatte schon nicht mehr mit Ihrem Erscheinen gerechnet. Ich erlaube mir vorauszugehen. Bitte folgen Sie mir!«, sagte er, als er gemächlich die Treppe hinaufschritt.
Lea neigte ihren Kopf und erwiderte: »Selbstverständlich, Herr Offizier, ich bitte darum.« Auch ihre eigene Stimme nahm sie unter ihrer Maske seltsam verzerrt wahr.
Während er die große Flügeltür öffnete, blickte Lea noch einmal zurück in die Eingangshalle. Der Lakai hatte wieder seine Position eingenommen. Weitere Neuankömmlinge wurden von ihm in Empfang genommen.
»Nur Mut«, wisperte der Gastgeber.
Als sie in den Saal trat, schlug ihr ein Schwall stickiger Luft entgegen.
»Oh!«, entfuhr es ihr.
»Ja, damit haben Sie wohl nicht gerechnet?«
Der Gastgeber meinte, ihr Ausruf habe den zahlreichen Gästen gegolten, die sich bereits im Saal tummelten. Alle Anwesenden trugen diese grässlichen Masken, die mal vergoldet waren, mal in einem abstoßenden Weiß oder in einem bedrohlichen Schwarz gehalten, mal in einem edlen Blau oder schillernden Lila, Violett oder fahlen Grau – stets farblich abgestimmt auf die jeweiligen Kostüme und versehen mit entsprechend farbigem Federschmuck.
Tatsächlich galt ihr überraschter Ausruf dem Geruch des Opiums, den sie bei ihrem Eintritt in den Saal sogleich wahrgenommen hatte. Hier also auch, dachte sie und erinnerte sich an den süßlichen Duft, der sie und ihren Schwager Georg schon mehrmals in einen Rausch versetzt hatte. Nach dem erstmaligen Konsum war ihr noch sehr schlecht geworden – derart, dass sie sich übergeben musste. Auch einige Male danach war ihr die Droge nicht gut bekommen. Doch wie Georg vorhergesagt hatte, hatte sich die Wirkungsweise verändert. Beim letzten Mal war ihr Bewusstsein in eine Traumwelt entführt worden, in der sie eine ungebändigte Zügellosigkeit genossen hatte.
Der Offizier führte Lea mit tänzelnden Schritten durch die wogende Menge. Dann begann er, ihr Avancen zu machen.
»Aber Herr Offizier, ich denke, Sie sind verheiratet.«
»Hat Sie das bei Ihrem letzten Besuch abgehalten? – Schauen Sie nur, auch Ihr Harlekin amüsiert sich schon prächtig mit der Sonnenkönigin«, plärrte er.
»Ein auffälliges Kostüm«, wies sie auf die überraschend große Gestalt in ihrem strahlenden Gelb und Gold. »Mir scheint, die Verhältnisse sind nicht stimmig. Sie überragt ihn um mindestens einen Fuß!«
»Sie liebt wohl das Rampenlicht – und der Harlekin nicht minder.«
»So lange er sich nicht zum Narren macht.«
»Dann sollten Sie ihm rechtzeitig Einhalt gebieten! Sie haben doch Ihre Flinte dabei, Frau Försterin!«
»Wohlan, Herr Offizier. Ich dachte, als Kavalier würden Sie mir mit Ihrem Säbel beiseite stehen.«
»Das ist ein Degen, Frau Försterin, nur ein Degen.«
Sie näherten sich einem anderen Gast.
»Ach, liebe gnädige Frau, darf ich Ihnen unseren Kaufmann vorstellen? Schauen Sie nur, er scheint sich zu langweilen! Sie entschuldigen mich fürs erste?«
Sie nickten einander zu. Dann ergriff der Kaufmann das Wort:
»Madame, ich bin Ihnen sehr verbunden, dass Sie mir Gesellschaft leisten. Darf ich Sie um einen Tanz bitten?«
Lea sah sich irritiert um. Man pflegte engen Körperkontakt beim Tanzen. So ist das also, dachte sie und hob die Augenbrauen unter ihrer Maske. Überall hätte man diesen Tanz mit seinen Figuren und dieser anzüglichen Haltung als unschicklich – ja geradezu als unsittlich herabgewürdigt. Hier schien offensichtlich alles erlaubt. Ein Unbehagen stieg in ihr hoch.
»Wird man über uns reden?«, fragte sie besorgt.
»Man wird über Sie reden, wenn Sie den Abend einsam und ohne Begleitung verbringen.«
Er führte sie in das Farbenmeer der bunten Kostüme. Sie stellte sich steif und ungeschickt an.
»Sie kennen den Teutschen nicht?«
»Wie bitte?«
»Der Teutsche, der Deutsche Tanz«, präzisierte er, »beginnt sich seit Kurzem in Wien durchzusetzen!«
»Scheinbar nicht nur in Wien«, bemerkte sie.
»Die Musik stammt – wie die Divertimenti zuvor – von Mozart«, kommentierte der Kaufmann.
»So?«
»Tänzer und Tänzerinnen umfassen sich mit einem Arm. Die beiden freien Hände werden ineinander gelegt, und die Arme werden ausgestreckt. Sehen Sie, so etwa. Dabei drehen wir uns.«
Verstohlen schaute sich Lea die anmutigen Verschlingungen der Arme, die sinnlichen Gesten und die verführerischen Körperstellungen der anderen Gäste an. Der Kaufmann schien den Tanz hingegen noch nicht so lange zu beherrschen. Schwerfällig führte er seine Partnerin und strich ihr wiederholt wie beiläufig über ihre Brust. Auch bei den anderen Tänzern wanderten die Hände unzüchtig an diverse Körperstellen ... Man schmiegte sich eng aneinander und schien zu genießen.
Irgendwann wurde Lea an den Rand der Tanzfläche und schließlich zu einer Fensternische geleitet. Auf einer schmalen Bank nahm sie neben dem Kaufmann Platz. Seine Aufdringlichkeiten nahmen zu. Lüstern griff er der Försterin zwischen die Beine.
Lea schlug ihm auf die Finger. Allerdings war ihre Empörung eher gespielt. Ihre Gegenwehr fiel sehr verhalten aus. »Sagen Sie mal, Kaufmann, in was für eine Art von Mummenschanz bin ich hier eigentlich geraten?«
Er ignorierte die Frage, die sich wie von selbst zu beantworten schien. Aus einem Nachbarraum vernahm Lea ein wollüstiges Stöhnen.
Er legte seine Hand auf ihre Schulter. Von dort aus fuhren seine Fingerspitzen über ihren Oberarm, verharrten einen Moment und bewegten sich dann auf den hochgeschlossenen Kragen des Kostüms zu. Dort nestelte er an einem Verschluss. Lea wollte kein Aufsehen erregen, zumindest jetzt noch nicht. Also ließ sie ihn gewähren.
Unvermittelt fragte er: »Frau Försterin, haben Sie eigentlich schon davon gehört, dass in der Residenz ein Porzellan-Service vermisst wird? Es soll eine echte Fürstenberger Rarität sein.«
Lea zuckte zusammen. Einen Moment war sie sprachlos. Alarmiert. Ihr Hirn vollbrachte Höchstleistung, vermochte den Wirrwarr an Gedanken jedoch kaum zu ordnen.
»So? – Weiß man, wer oder was dahintersteckt?«
»Ich wäre an dem Service interessiert. Ich mache Ihnen ein gutes Angebot!«
»Warum wenden Sie sich an mich?«
»Ich bin ein Kaufmann, durch und durch.«
»Und ein Spieler, wie mir scheint. Ein Spieler, der sich ausgezeichnet verstellen kann.«
»Der leider gegen den Harlekin mehrmals den Kürzeren gezogen hat.«
Mit einer Geste seines Kopfes wies er auf den Gast in seinem Flickenkostüm mit einer schwarzen Maske.
»Dann sollten Sie besser in Ihrem Gewerbe tätig bleiben, welches Sie hoffentlich besser beherrschen!«
»Wie meinen Sie?«
»Schuster, bleib bei deinen Leisten!«
»Ich bin in Schwierigkeiten, Frau Försterin. Ich stecke in großen Schwierigkeiten.«
»Und die wollen Sie ihm anhängen?« Lea blickte hinüber zum Harlekin.
»Helfen Sie mir?«
»Warum fragen Sie mich?«
»Ist er ... Ist er denn nicht ... Mir ist aufgefallen, dass Sie ständig nach ihm Ausschau halten.«
»Merkt man mir das an?«
Der Kaufmann ließ die Frage unbeantwortet im Raum stehen. »Von unserem Gastgeber habe ich nur einen kleinen Tipp erhalten, Madame.«
Entrüstet erhob sich Lea. Zorn stieg in ihr hoch: »Kann es sein, dass ich hier eine groteske, schäbige, abscheuliche Inszenierung erlebe, die meinen Mann ans Messer liefern soll? War das die Idee unseres spendablen Offiziers?« – Leas Blick fiel auf den Aufbau eines verschwenderisch überladenen Buffets. »Es sieht so aus, als habe er keine Ausgaben gescheut.«
»Was wissen Sie über das Service?«, versuchte es der Kaufmann erneut.
Auch Lea erlaubte sich, eine Frage unbeantwortet zu lassen und erwiderte: »Wenn Sie den Harlekin so gut kennen, wissen Sie bestimmt auch, wer sich hinter der Verkleidung der Sonnenkönigin verbirgt?«
»Eifersüchtig?«
»Er macht ihr den Hof, nicht wahr?«
»Machen wir nicht alle einander den Hof?«
»Mein Gott, die hängen ja wie Kletten aneinander!«
»Haben Sie nicht gemerkt, dass sie eine ganze Weile verschwunden waren?«
»Und Sie meinen, die Beiden hätten ...«
»Im Schutz unserer Verkleidungen ist alles möglich, alles erlaubt!«
Lea hatte ihn verstanden. »Nun gut, mein lieber Kaufmann, wenn Sie mir nichts verraten wollen ... Ich schlage vor, Sie wenden sich mit Ihrem Ansinnen an den Mohren – da drüben, der mit der orientalischen Kopfbedeckung!«
»Was sollte der Mohr damit zu tun haben?«
»Wenn etwas fehlt, sind es doch meistens die Mohren, die überall ihre Finger im Spiel haben, oder nicht?«
»Hm. Der Mohr? Meinen Sie?«
Einige Wimpernschläge lang war der Kaufmann irritiert. Dann durchschaute er das Ablenkungsmanöver.
»Sie haben recht. Aber manchmal sind es auch die Juden!«
»Sollten Sie nicht fündig werden, geben Sie sich einfach mit dem Blumenfräulein zufrieden! – Sehen Sie nur, das Mädchen lechzt schon danach, von Ihnen umworben zu werden.«
»Das Blumenfräulein ist meine Tochter, Madame.«
Unmerklich schüttelte Lea den Kopf. Zustände sind das hier, dachte sie.
»Sucht sie hier etwa ihr großes Glück?«
»Wie meinen Sie, Madame?«
»Sie wirkt etwas verloren, so ganz ohne Begleitung in diesem wilden Haufen. Sollte sie hier etwa den Mann fürs Leben zu finden hoffen?«
»Wenn sie die Möglichkeit fände, zukünftig einer anständigen Arbeit nachgehen zu können, wäre uns schon geholfen. Sie ist fünfzehn.«
»Ach, sie sucht anständige Arbeit. Und die sucht sie in diesem ..., in diesem Etablissement?«
»Wenn Sie eine Idee hätten, Madame. Ich wäre gerne bereit, das mit dem Porzellan-Service zu vergessen.«
»Ich werde es mir überlegen, Kaufmann. – Machen Sie mich nun bitte mit dem Pfaffen bekannt.
»Nanu, mit dem Pfaffen?«
»Falls ich etwas mit dem Diebstahl des Services zu tun habe, sollte ich doch schleunigst meine Sünden beichten, oder?«
Der Kaufmann verneigte sich. »Madame, ich wünsche Ihnen noch einen amüsanten Abend mit dem Pfaffen. Ich bin sicher, er wird Ihnen liebend gerne seinen Beichtstuhl zeigen.«
»Seinen Beichtstuhl?«
»Sein kleines verträumtes Séparée!« –
Als sich nun auch der Kaufmann erhob, um das Buffet näher in Augenschein zu nehmen, fiel ihm ein Billet aus einer seiner Taschen. Lea hob es auf und staunte nicht schlecht, als sie den Namen las: Simon Fromme, Walkmüller, nebst Tochter Charlotte.
Lea blickte hinter ihm her. Jetzt suchte er das Gespräch mit dem Blumenfräulein. Er hatte Lea auf einige Ideen gebracht.
Unauffällig ging sie ihren Weg, grüßte hier, plauderte dort und fand sich bald im Treppenhaus des noblen Domizils wieder. Der Lakai war nirgends zu entdecken. Das blaue Gästebuch hingegen lag unbeaufsichtigt auf einem Pult. Lea konnte der Versuchung nicht widerstehen. Schnell hatte sie in Erfahrung gebracht, was sie schon eine Weile ahnte. Ihr Mann Franz hatte gemeinsam mit der Sonnenkönigin das Haus betreten. Franz Altemeier stand da geschrieben, in Begleitung von Irmtraud Grave.
Als Lea noch einmal den Saal betrat, sah sie ihn sofort. Als Spaßmacher war er wieder in Aktion getreten und machte durch gewagte Sprünge auf sich aufmerksam. Einigen Gästen hielt er ein Holzschwert unter die Nase und forderte sie auf, eine Gabe in seinen Dukatenbeutel zu stecken. Und schon war er wieder zu seiner Königin zurückgekehrt. Bisher war Lea ihnen aus dem Weg gegangen. Zielstrebig näherte sie sich nun dem ungleichen Paar. Im Getümmel der Menschenansammlung trat sie dem Harlekin unvermittelt auf die Füße, als er sich eng umschlungen mit seiner Partnerin vergnügte – zu eng, wie Lea meinte.
»Trampel!«, raunte er der Försterin zu. Doch diese ließ sich nur zu einer Warnung hinreißen, bevor sie die Lasterhöhle verließ: »Vorsicht, mein lieber Narr. So nah bei der Sonne hat sich schon mancher die Fühler verbrannt!«
»Wo kommst du her?« – Der Schreck fuhr Lea in die Glieder. Es dauerte, bis ihr klar wurde, wer ihr da im Dunklen auflauerte. Wolken bedeckten jetzt den Sternenhimmel. Sie erkannte nur die Silhouette des Mannes mit der Kopfbedeckung des Harlekins.
»Spionierst du mir nach?«, zischte er.
»Hast du Grund, dies zu befürchten?«
»Du weichst meiner Frage aus!«
»Ich war da, wo auch du warst. Ich habe mich köstlich amüsiert – du etwa nicht?«
Unvermittelt schlug er ihr ins Gesicht. »Willst du meine Karriere ruinieren?«, herrschte er sie an.
»Karriere? Deine Karriere?«, provozierte sie ihn. »Wer bist du denn schon? Kannst dich an einer wehrlosen Frau vergreifen, du Stümper! Das, was du bist, hast du mir zu verdanken – schon vergessen?«
Er trat auf sie zu, umfasste ihr Gesicht mit einer Hand und presste die Spitzen seiner Finger kräftig in ihre Wangen. Dann schlug er sie und drohte: »Wenn du mich zum Gespött machen willst, werde ich dich erledigen!«
»Was willst du von mir, Franz? Nur weil ich der Einladung deines Vorgesetzten gefolgt bin, die an uns beide gerichtet war, gebärdest du dich jetzt wie der letzte Unmensch? Sieh dich vor, sonst wird der Oberamtmann dich erledigen. Du bist ja so verblendet, dass du nicht einmal ahnst, dass man dir an den Kragen gehen will!«
Er zögerte. Dann ließ er sie los. »Wir sind noch nicht fertig miteinander!«
»Franz, du irrst dich! Ich bin mit dir fertig. Und deine Kinder ebenfalls! Geh uns zukünftig aus dem Weg!«
Sie drehte sich um, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Diesmal lief sie den Weg nach Neuhaus zurück. Es war ihr gleichgültig, dass sie sich zu mitternächtlicher Stunde den besonderen Gefahren durch das sich herumtreibende Gesindel aussetzte.
Zuhause angekommen, ergriff sie das edle Porzellan, das sie voller Wut gegen den Spiegel warf. Es war das Ende all ihrer bis zuletzt aufrechterhaltenen Sehnsüchte, Träume und Illusionen. Vom Lärm des zerschellenden Geschirrs und des berstenden Spiegelglases aufgeweckt schauten die Zwillinge in die Stube. Schreckensbleich standen sie da in ihren Nachthemden.
»Hat er dich wieder geschlagen Mama?«, fragte Agnes, als sie in das Gesicht ihrer Mutter schaute und die Blutergüsse entdeckte. Auf dem Nasenrücken war die Haut abgeschürft. Unter der Nase und in einem Mundwinkel befanden sich noch Krusten getrockneten Blutes. Tränenüberströmt nahm die Mutter ihre Mädchen in die Arme.
Noch viele Stunden später befand sich Lea in einem schläfrigen Dämmerzustand. Sie war aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ausgezogen und krümmte sich nun in Elsbeths Bett. Die Zwillinge schliefen ab sofort gemeinsam im anderen Bett des Kinderzimmers.
»Georg, hilf mir«, flüsterte Lea zu sich selbst. Sie öffnete ihre Augen und starrte in den dunklen Raum. »Schaff ihn mir von Hals, ich will ihn nicht mehr sehen!« Dabei wusste sie, dass sie ihren brutalen Ehemann sobald nicht loswerden würde und dass es schwer werden würde, sich aus dem Weg zu gehen. Nie würde er durch eine Trennung von der Familie das Scheitern seiner Ehe öffentlich zugeben. Aber sie nahm sich fest vor, sich ihm ab sofort zu verweigern, selbst wenn er sie dafür totschlagen sollte.
In der Bevölkerung von Neuhaus waren die Exhumierung der sterblichen Überreste von Johanna Grünberg und ihre Bestattung auf dem Kirchhof unbeachtet geblieben.
Irmtrauds Erpressungen gegenüber dem Amtmann hatten eine neue Dimension erhalten. Seit dem Maskenball forderte sie seine Zärtlichkeiten ein und diese zu geben, war Altemeier liebend gerne bereit. Da schreckten ihn die Zahlungen in überschaubarer Höhe nicht wirklich.
Nur um den Schein zu wahren, kehrte Franz Altemeier sporadisch in die Wohnung zurück, in sein Zuhause. Im Grunde war ihm jeder andere Aufenthaltsort lieber als die Schlafkammer, in die er sich ausschließlich zurückzog, wenn er daheim war. Die Stimmung, die ihm entgegenschlug, war eisig. Nur Elsbeth trat gelegentlich mit ihm in Kontakt. Während Agnes ihren Mund stets verschlossen hielt und Lea ihrem Mann konsequent aus dem Weg ging, war Elsbeth von ihren Eltern auserkoren Sprachrohr zu sein, wenn es darum ging, dringend notwendige Informationen auszutauschen.
»Mutter braucht mehr Geld«, gab sie ihm zu verstehen. »Sie hat ein Kindermädchen für uns angestellt, das auch die Wohnung sauber hält.«
»Ist sie sich auf einmal zu fein dafür? – Sag ihr, sie solle sich ihr Geld gefälligst verdienen!«
»Mutter sagt, es ist die Tochter vom Walkmüller Fromme!«
»Und was habe ich mit dem Fromme zu schaffen?«
»Das wüsstest du sehr wohl, sagt Mutter. Es hat irgendwie mit dem neuen Porzellan zu tun. Auch kennt ihr euch wohl vom Kartenspiel?«
Altemeiers Stirn bewölkte sich und eine tiefe Falte erschien. »Das Porzellan, das hat sie ja nun zerschlagen. Damit dürfte das Problem aus der Welt geschafft sein, oder?«
Unsicher hob Elsbeth ihre Schultern. »Mutter sagt, der Walkmüller habe dich in der Hand.«
Franz zuckte zusammen. Seine Gesichtsmuskeln gerieten in Bewegung. Nach einigem Zögern ergriff er seinen Geldbeutel. »Sag ihr, das muss vorerst reichen. In den nächsten beiden Monaten kann ich nichts mehr entbehren. – Ist sie wenigstens nett?«
Fragend blickte Elsbeth ihn an.
»Frommes Tochter, meine ich, das Kindermädchen.«
»Agnes mag sie ganz gerne. Sie bringt uns Lesen und Schreiben bei.«
»Soso, das kann sie? Und du? Magst du sie auch?«
»Sie ist manchmal etwas streng.«
»Das kann nicht schaden«, brummte Altemeier. »Das hätte ich mit deiner Mutter auch sein sollen, dann wäre mir manches nicht aus dem Ruder gelaufen.«
Altemeier verstand es, aus seinen Bekanntschaften Vorteile für sich zu ziehen. Deren Türen standen ihm nach wie vor weit offen. Auch die Damen seiner Freunde waren ihm meist zugetan. Ein Kompliment hier, eine Aufmerksamkeit da, gelegentlich wechselte auch mal eine Münze den Besitzer. Dafür war manche Gastgeberin gerne bereit, ihn sogar zu beköstigen. Zum Stelldichein mit Irmtraud fand er stets einen ansprechenden Ort. Ein hübsches Liebesnest zu finden, damit kannte er sich aus.
Wie lange er dieses Leben aufrechterhalten wollte und konnte, wusste er nicht. Das hing auch davon ab, ob er weiterhin durch die eine oder andere Betrügerei seine Barschaft aufbessern konnte. Denn als Amtmann verdiente er kein Vermögen. Zu einer offiziellen Trennung von seiner Familie konnte er sich nicht durchringen – derzeit jedenfalls noch nicht.
Ebenso wie Franz Altemeier hatte auch Lea daran Gefallen gefunden, ihre Vergnügungen in den Mittelpunkt ihres Daseins zu stellen, während sie das tägliche Einerlei, die häusliche Arbeit und die Betreuung ihrer Kinder bei Frommes Tochter in guten Händen wusste. Zu den Treffen mit ihrem Schwager Georg kam es immer seltener; stattdessen schlitterte sie in so manche andere Affäre. Hin und wieder kam sie mit dem Oberamtmann zusammen. Bei ihrem ersten Wiedersehen war sie für ihn noch begehrenswert. Für sie war beim nächsten Mal der Reiz des Verbotenen einmal mehr aufregend. Doch schon bald wichen Leidenschaft und das Außergewöhnliche der Monotonie. Man langweilte sich. Eines Tages suchte Lea den Walkmüller auf. Sie hatte seiner Tochter Charlotte Arbeit verschafft. Und so stand er in ihrer Schuld, wie sie meinte.
»Ich bin in Schwierigkeiten, Frau Försterin. Ich stecke in großen Schwierigkeiten«, hatte er beim Maskenball gesagt. Nun konnte sie sein Klagen nur allzu gut nachempfinden. Wie hatte dieser Pächter der Walkmühle seinen Besitz nur so verkommen und herunterwirtschaften lassen können. Das war ihr schleierhaft. Einige Gebäudeteile waren einsturzgefährdet, das Gebälk des Dachstuhls marode, auch einige Karren und die Rahmen zum Aufspannen der Tuche faulten. Der metertiefe Schacht, in dem einst das große Mühlrad klapperte, drohte zu verfallen. Die Mutter seiner Tochter hatte vor drei Jahren hier ihren Tod gefunden. »Mein Gott, Simon, dieser Zustand deiner Walkmühle ist doch das Ergebnis eines längeren Prozesses. Du hast dich durch jahrelange Nachlässigkeit selbst ruiniert!«, hatte sie ihm die Meinung gegeigt.
»Weder die Tuchmacherzunft hat sich gekümmert, als sich die Müller von mir abgewandt haben, noch das Hochstift hat jemals auf meine Unterstützungsanträge reagiert!«, hatte er nach Ausreden gesucht. »Da sitzt jemand das Problem aus. Mir scheint, man will mich bewusst in den Ruin stürzen.«
»Kann da der Franz was machen?«
»Der Franz?« Fromme wirkte überrascht. »Das sagst ausgerechnet du? Du denkst, dein Mann könnte mir helfen wollen? – Nein, Lea, der hat doch selbst keinen Rückhalt mehr im Amt. Lea, ich bin wirklich verzweifelt. Ich habe keine Idee mehr, wie ich an Geld kommen kann. Das, was Lotte bei dir verdient, reicht gerade mal, dass wir überleben können.«
»Kannst du die Gebäude nicht wenigstens derart zurichten, dass sie zum Beispiel als Schafstall genutzt werden könnten? Oder als Waisenhaus? – Simon, ich habe eher den Eindruck, du legst deine Hände untätig in den Schoß.«
»Ja, Lea, ich lege die Hände in den Schoß, aber nicht untätig. Ich lege sie in deinen Schoß! Findest du nicht, dass ich dazu gut geeignet bin?«
Sie hatte seine Frage mit einem Seufzer und mit dem Austausch von Zärtlichkeiten beantwortet. Ja, Simon Fromme war in vielen Dingen ein eher zurückhaltender und ängstlicher Typ. Vor allem aber war er ein Mann ohne Mumm, ohne Bereitschaft sich den Problemen und der Arbeit zu stellen. Er neigte zur Trägheit. Nur im Bett, da wusste er sich zu profilieren.
Eine Weile fand Lea das anregend, bis seine Spielchen zunehmend rabiater wurden. Und dann immer diese Fragen: War ich gut? Bist du mit mir zufrieden? Was denkst du, wenn wir beisammen sind? Sie hasste diese Eitelkeiten, diese Selbstsucht. Immerzu hatte er nur sein eigenes Wohlbefinden im Blick. Nichts als neue Abhängigkeiten, stellte sie meist unbefriedigt und ernüchtert fest. Und dann hatte er sie auch noch zu kritisieren gewagt.
»Warum tust du das?«, hatte er sie gefragt und auf ihren Blick hin präzisiert: »Warum tust du es deinem Mann gleich und suchst eine Affäre nach der anderen, begibst dich von einer Liaison in die nächste?«
»Ich will Gerechtigkeit«, hatte sie geantwortet.
»Nein«, hatte Fromme geantwortet, »du willst keine Gerechtigkeit, du bist nur von Rachegedanken getrieben!«
Vielleicht hat er recht, hatte sie einige Augenblicke lang gedacht. Doch dann hatte sie schnell wieder ihren Blick auf seine Schwächen gerichtet. Es war ihr klar geworden, dass seine Zudringlichkeiten immer besitzergreifender wurden. Das hatten wir gerade erst, machte sie sich ihre Gedanken. Das wollte sie unter keinen Umständen wieder zulassen. Sie musste sich wohl wieder umorientieren.
Sie war auf dem Rückweg von der Walkmühle nach Neuhaus und dachte an Franz. In Frommes Schlafkammer hatte sie eine Waffe gesehen. Sie war mehrfach versucht gewesen, die Schrotflinte in ihren Besitz zu bringen, um damit diesen jämmerlichen Hornochsen von Ehemann ... Sie stellte sich vor, wie die Schwätzer in Neuhaus über ihn herziehen würden: »Ja, der Altemeier. Er wollte immer schon hoch hinaus. Aber tief ist er gefallen; bis unter die Grasnarbe hat ihn seine Überheblichkeit und Selbstsucht gebracht. Geschieht ihm recht, die Ratte.« – Noch hatte er Glück. Sie hatte die Waffe nicht berührt. Und sie würde sie auch nicht bekommen. Denn ein letztes Mal hatte sie Fromme aufgesucht, das stand jetzt für sie fest. Aber um Franz Altemeier aus dem Weg ... Es würde sich schon noch eine Gelegenheit finden lassen.
Sie hatte die Schlosswache passiert, wo der Wachhabende gelangweilt und stupide seinen kurzen Weg abschritt. Für jemanden, der es darauf anlegte, würde es keine große Kunst sein, an eine Waffe zu gelangen. Sie näherte sich dem Park der Residenz von seiner östlichen Seite. Das Zwitschern der Vögel wurde vom aggressiven Krächzen zweier sich bekämpfender Elstern übertönt. Lea war im Begriff aus dem Schatten einer dicken alten Weide zu treten, als sie am hinteren Zugang zum Schloss bekannte Gesichter gewahrte: Da sah sie den alten Sertürner im Gespräch mit einem Pfaffen. Tja, wenn er jünger wäre, überlegte sie, als sie intuitiv wieder einige Schritte zurückging und im Halbdunkel des Baumes verharrte. Ob es ihr gelingen würde, seiner spießigen Alten den ach so über jeden Makel erhabenen und tugendhaften Ehemann auszuspannen? Das zu versuchen, wäre gewiss ein besonders aufregender Zeitvertreib. Sie könnte natürlich auch versuchen, in das Umfeld des Fürstbischofs ... Sie musterte den durchaus attraktiven Kaplan. »Der Beichtstuhl als Séparée«, hatte Fromme einst seiner Phantasie freien Lauf gelassen. Das hatte was ... Aber vielleicht steht der Pfaffe nur auf Seinesgleichen, spann sie die Fäden ihrer Gehässigkeiten weiter.
Lea wurde beinahe übel, als sie bemerkte, wie Irmtraud Grave mit ihrem Sohn zu den beiden Männern trat. So eine Heuchlerin, ging es ihr durch den Kopf.
Zu der Gruppe gesellten sich noch der Lehrer der Elementarschule sowie seine Frau mit dem drei- oder vierjährigen Jungen. Der Junge drückte seiner Mutter einen dicken Kuss auf die Wange. Es war eine Szene, die Lea einen heftigen Stich versetzte.
»Welch ein Idyll«, seufzte sie. »Skrupellos und geschickt verstehen sie es, eine Fassade des Glücks aufrechtzuerhalten«, redete sie sich ein. Dabei fühlte sie sich sehr einsam. Und als der Neid sie zu überwältigen drohte, versuchte sie vor den sich übermächtig entwickelnden Gefühlen des Versagens zu flüchten. Opium, kam ihr lediglich in den Sinn. Ihr Leben bedurfte einerseits seiner euphorisierenden Wirkung. Aber andererseits wollte sie auch vergessen. Sie sehnte sich nach einem inneren Frieden.
Fünf
Trübe Aussichten
Derweil kreisten Franz Altemeiers hauptsächliche Gedanken um seine berufliche Zukunft. Er hatte sich beim Landdrosten um eine Position für den Unterwaldischen Distrikt beworben. Auch das Spezialamt/Rentamt hatte seinen Sitz im fürstbischöflichen Residenzort Neuhaus. In diesen Tagen, die geprägt waren von einer unruhigen politischen Lage, war es jedoch ungewiss, wann über seine Bewerbung entschieden würde. Leider zeichneten ihn die wenig schmeichelhaften Referenzen des ihm vorgesetzten Oberamtsmannes nur unzureichend aus. Zudem hatte man ihn unglücklicherweise bei Tumulten gesehen. Was war geschehen?
Unter dem Eindruck der Französischen Revolution kam es auch im Hochstift Paderborn zu gelegentlichen Unruhen. Die unteren Schichten begehrten gegen die Stände auf, wobei die Bevölkerungsmehrheit zwar an Reformen aber noch nicht an eine gänzliche Auflösung der traditionellen Ordnung interessiert schien.
Altemeier war eher zufällig dabei gewesen, als es zur Aufrichtung eines Freiheitsbaums kam. Jenem Symbol für die Freiheit, das angeblich der Marquis de La Fayette aus Amerika mitgebracht hatte. Die Jakobiner hatten in Paris den ersten l'arbre de la liberté errichtet, krönten ihn mit der Freiheitsmütze und umtanzten ihn, wobei sie Revolutionslieder sangen. Rasch gehörte dieser Tanz um den Freiheitsbaum zu den Festen der Revolution.
Nun hatte die Stadt Paderborn eine an den Fürstbischof und das Domkapitel gerichtete Beschwerdeschrift gerichtet. Sie erhob vor dem Hintergrund der mehrfachen Inanspruchnahme der Untertanen durch Steuer, Pacht und Zehnt Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Steuerfreiheit von Adel und Geistlichkeit. Im Verlauf dieses Streits stellten Unbekannte eine Pappel als Freiheitsbaum auf mit der Aufschrift: Liebe Bürger! Schüttelt endlich Euer Joch von euch und schwört bei diesem Baum frei zu sein.
Auch wenn die Auseinandersetzungen später zur Folge haben würden, dass Adel und Geistlichkeit das Privileg der Steuerfreiheit auf Grundvermögen aufgeben würden, so wurde zunächst das Aufstellen von Freiheitsbäumen als Bekenntnis zu den Idealen der Revolution in den deutschen Fürstentümern streng geahndet.
In Paderborn ließ die Obrigkeit den Baum fällen. Einige wenige vermeintliche Unruhestifter wurden abgeführt. Altemeier gehörte dazu.
Er kam als Amtmann zwar schnell wieder frei – anders, als sein Schwager Georg, der Schauspieler, zu dem Franz seit geraumer Zeit keinen Kontakt mehr pflegte. Dass er ausgerechnet den in der Arrestzelle antreffen musste ... Dennoch: Auch von Franz Altemeier hatte man die Personalien erhoben. Er war auffällig geworden. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Nun konnte er nur darauf hoffen, dass ihm dies nicht zum Nachteil gereichte. Er hoffte vergebens. Wochen später teilte man ihm mit, dass die Stelle im Rentamt bis auf weiteres doch nicht besetzt werden würde.
Höhnisch lachte er, weil man die Entscheidung damit begründete, dass man die politischen Entwicklungen in diesen unruhigen Zeiten abwarten wolle. Vielmehr glaubte er zu wissen, dass er seinem Vorgesetzten den abschlägigen Bescheid zu verdanken hatte. Aber was blieb ihm übrig? Er musste die Entscheidung hinnehmen. Franz Altemeier war jedoch nicht bereit zu resignieren. Nun gut, dachte er. Man hatte über ihn ein Urteil gefällt, das ihn herausforderte, neue Wege zu beschreiten. Dazu hatte er sich schon etliche Gedanken gemacht. Er war nicht unvorbereitet. Jetzt galt es, aufmerksam die politischen Ereignisse zu verfolgen.
Natürlich war Altemeier bekannt, dass der französische König Ludwig XVI vergeblich versucht hatte, ins Ausland zu fliehen. Auch war ihm nicht entgangen, dass das revolutionäre Frankreich von einer absolutistischen in eine konstitutionelle Monarchie umgewandelt worden war.
Die Österreicher, die zahlreichen französischen Adligen Zuflucht gewährten und die Preußen hatten der revolutionären Regierung in Frankreich mit einer Intervention gedroht, wenn die Monarchie dort angetastet werden würde. Nachdem in der Folge die Franzosen den Krieg erklärt hatten, wurde die Ankündigung in die Tat umgesetzt, wobei es nicht gelungen war, eine geschlossene Front gegen die französischen Revolutionstruppen aufzubauen. Die Chance, das gesamte Heilige Römische Reich Deutscher Nation hinter sich zu bringen, hatte der erst kürzlich gewählte Kaiser Franz II durch den Umstand vertan, dass er das österreichische Staatsgebiet unbedingt vergrößern wollte, notfalls auf Kosten anderer Reichsmitglieder. Und auch Preußen wollte sich für seine Kriegskosten durch die Einverleibung geistlicher Reichsgebiete schadlos halten.
Der Krieg hatte mit anfänglichen Erfolgen der Alliierten begonnen, bis der Vormarsch auf Paris nach der Kanonade von Valmy gestoppt worden war. Die Revolutionsarmee war zur Gegenoffensive übergegangen und hatte verschiedene Gebiete, darunter die österreichischen Niederlande und Teile des Rheinlandes, besetzt. Einen Tag nach dem französischen Sieg bei Valmy war in Paris die Monarchie aufgehoben und die Erste Französische Republik proklamiert worden. Dann erfolgten in Paris nach kurzem Prozess die öffentlichen Hinrichtungen von Ludwig XVI und seiner Frau Marie Antoinette.
Altemeier registrierte, dass für das Hochstift Paderborn in Südost-Westfalen wie für viele Westfalen die zahlreichen royalistischen Emigranten der erste spürbare Kontakt mit den Auswirkungen der Revolution waren. Vor allem nach dem Vorrücken der Revolutionsarmee nach Belgien und den Niederlanden waren tausende Priester und Adelige nach Westfalen geflohen. Im Amt hatte sich auch herumgesprochen, dass in Hamm zeitweise die jüngeren Brüder des hingerichteten Franzosenkönigs Aufnahme gefunden hatten – der Comte de Provence und der Graf von Artois. Dort schienen sie mit der Aufstellung einer gegenrevolutionären Emigrantenarmee beschäftigt.
Und dann wurde im Paderbornischen sichtbar, dass man im Rheinland Angst vor einer französisch geprägten Zukunft hatte. Denn im August 1794 wurden ein Teil der Reichsinsignien, die Aachener Kleinodien, und der Domschatz von Aachen ins Kapuzinerkloster nach Paderborn ausgelagert.
Während also die politische Großwetterlage in diesen Jahren insbesondere durch die Französische Revolution und ihre Folgen bestimmt wurde, drohte über das Hochstift Paderborn ausnahmsweise kein militärischer Orkan hinwegzufegen. Gleichwohl lag Ungemach über Neuhaus und Umgebung.
Feuchtwarme Luft bestimmte das Wetter in der ersten Augustwoche des Jahres 1795. Häufiger als gewöhnlich schaute man zum Himmel in der Annahme, dass sich hier gewiss bald drohende Wolkenformationen zeigten. Hoffentlich würde ein Gewitter keine allzu großen Schäden verursachen. Immerhin könnte danach eine Schönwetterphase andauern.
Agnes hatte ihre Mutter und die Schwester gerufen, um gemeinsam das flammend rot erleuchtete Himmelsgewölbe zu bestaunen. Sie hatten sich die schiefe Stiege zur Dachstube hinaufgedrängt. Von dort konnten sie einen noch besseren Blick auf das Naturschauspiel werfen. Es war ein spannendes Ereignis – eine Entschädigung dafür, dass das Kindermädchen heute nicht seinen Dienst aufnehmen würde. Frommes Tochter Charlotte war erkrankt.
Selten kamen sie auf den Dachboden. Der Raum unter dem Dach war ja auch wenig einladend. An Sommertagen meistens zu heiß, im Winter in der Regel eiskalt. Spinnweben allerorten zeugten davon, dass sich kaum jemand hierhin verirrte. An den Dachsparren baumelten aufgespannte Schirme – für den Fall, dass es durch das überwiegend mit Stroh und nur teilweise mit Schindeln gedeckte Dach tröpfelte. An Stellen, an denen es erfahrungsgemäß intensiver hereinregnete, waren Wannen deponiert. Lea machte darauf aufmerksam, dass eins dieser Behältnisse eine morsche Bohle abdeckte. Ein vorsichtiges Begehen des Dachbodens war angeraten.
In einer Ecke befand sich eine alte zerschlissene Matratze, aus deren aufgeplatzten Nähten Rosshaar quoll. Der Bezug war mit Stockflecken und eingetrocknetem Mäusekot übersät. Die Katze, die ebenfalls den Weg auf den Dachboden gefunden hatte, erkundete trotz des muffigen Geruchs aufmerksam die Lage. Dabei grub sie ihre scharfen Krallen in das Polster. Schließlich hob sie das grobe Gewebe eines Sacks an und versteckte sich darunter.
Elsbeth und Agnes duckten sich unter einige zerlumpte Handtücher, die vor Zeiten zum Trocknen über eine dicke Kordel gehängt worden waren. Jetzt waren sie steif wie ein Brett. Elsbeth öffnete das schmale Fenster in der Dachgaube. Dicht beieinander standen die Mädchen nun. Gebeugt lehnten sie sich mit den Unterarmen auf das schmale Fensterbrett. So konnte auch Lea hinter den Mädchen stehend über die benachbarten Gärten hinwegsehen.
Fasziniert betrachteten sie, wie die Sonne die Wolkenfront im Westen anstrahlte. Ob es sich hierbei um Vorboten einer Regenfront handelte?
Irgendwann bemerkten sie, dass nicht der geringste Luftzug auch nur irgendwas bewegte. Das Gezwitscher der Vögel verebbte. Die ungewöhnliche Stille rief eine merkwürdige Atmosphäre hervor.
Es dauerte nicht mehr lange, bis der Wind von Westen her auffrischte und Gewitter mit einer rasanten Geschwindigkeit heranzogen. Jetzt wirkte die Katze beunruhigt, lief hin und her, bis sie sich aus der Dachkammer zurückzog. Und von einer Sekunde auf die andere wurde es dunkel über Neuhaus und Umgebung. Auch Leas Blick verfinsterte sich. Im Dämmerlicht schaute sie zu den Dachsparren. Sie zog die Stirn in Falten. Einmal mehr war sie verärgert – verärgert darüber, dass sich der Herr des Hauses einfach nicht kümmerte. Noch immer war das Dach nur unzureichend gedeckt und würde dem aufziehenden Sturm eine gefährliche Angriffsfläche bieten.
Während man bei den Sertürners und den Buchbinders ebenfalls Respekt vor den Launen der Natur hatte und sich Irmtraud Grave und ihr Sohn Ernst in dem steinernen Gemäuer des Marstalls von Schloss Neuhaus sicher fühlten, verfolgten die Altemeiers die weitere Entwicklung nun ängstlich. Die noch vor kurzem ausgelassene und heitere Stimmung hatte sich gänzlich gewandelt. Ein greller Blitz und ein unmittelbar folgender ohrenbetäubender Knall erschreckten die Zwillinge. Elsbeth dachte an ihren Vater, den sie im Amt bei der Arbeit wähnte.
»Lasst uns nach unten gehen«, forderte Lea ihre Töchter auf. Nahezu gleichzeitig hob der Sturm einen kleinen Teil des Daches an.
»Aber wenn es nun hereinregnet?«, fragte Agnes. »Ich hole die Eimer, die beim Badezuber stehen. Dann können wir die Wannen ausleeren!« Noch während sie das sagte, eilte sie die Treppe bereits hinunter.
Taubeneigroße Hagelkörner prasselten nun nieder, gefolgt von sintflutartigen Regenfällen. Immer größere Teile des Daches lösten sich.
»Das hat keinen Zweck! Hier oben sind wir den Gefahren zu sehr ausgesetzt!«
Kaum hatte die Mutter Elsbeth aufgefordert, das Dachgeschoss zu verlassen, da überschlugen sich die Ereignisse. Der Wind, der die Tür zum Baderaum hinter Agnes zuschlug, pfiff durch das Haus. Blitze, überall gleichzeitig, und das Krachen des Donners ließ den Erdboden erzittern. Neben dem ungewöhnlich heftigen Lärm war Geruch von verkohltem Holz wahrzunehmen. Der Schornstein neben dem Dachfirst hielt den Böen nicht mehr Stand. Die Reste des Daches hatten der Zerstörungskraft nichts entgegenzusetzen und stürzten ein.
Wassermassen ergossen sich in die ungeschützten Kammern. Wie gelähmt wirkte Lea für einen Moment. Endlich schob sie Elsbeth zur Hintertür.
»Ich muss nach Agnes sehen!« schrie sie, während die Panik immer größer wurde.
Zur gleichen Zeit übermannte auch Agnes die Hilflosigkeit. Sie vermochte es nicht, sich aus dem Baderaum zu befreien. Die Türe schien zu klemmen. In ihrer Höllenangst hämmerte sie schreiend gegen den verbarrikadierten Durchlass.
Elsbeth hörte Glas bersten, Holz splittern und Steine platzen. Aus der Ferne, so schien es, ertönten Kirchenglocken. Derweil schlugen meterhohe Flammen aus der Giebelfront des Hauses empor. Das Fachwerk, ein Geflecht aus Holzbalken mit festgebackenem Lehm und Stroh, brannte schnell lichterloh. Menschen kamen zusammen und wollten helfen, das Feuer zu löschen.
»Mutter und meine Schwester sind noch da drin!«, schrie Elsbeth. Sie fuchtelte mit den Händen, doch niemand schien sie zu verstehen.
Sie war im Begriff sich wieder in den Gefahrenherd zu stürzen, als man ihr einen Eimer in die Hand drückte. Und noch einen. Kaum hatte sie ihn weitergereicht, empfing sie den nächsten. Immer wieder. Unversehens war sie Teil einer Eimerkette geworden. Das Wasser schwappte über, während die Behälter geschwungen wurden. Längst war sie durchnässt. Vom Regen. Vom Löschwasser. Vom Schweiß. Funken stoben, und Brandrückstände wurden aufgewirbelt. Die Asche flog Elsbeth ins Gesicht. Sie brannte in den Augen. Elsbeth hielt sich die Hände vor das Gesicht, als wollte sie sich vor der sengenden Hitze schützen. Ruß setzte sich in die Poren der Haut. Elsbeth musste spucken. Dann wischte sie sich über ihr Antlitz. Nun war es vom Schmutz verschmiert. Ihre Tränen flossen darüber. Sie ahnte, dass ihr Tun vergeblich war.
Lea mühte sich verzweifelt, die schwere Bohle beiseite zu schaffen, die vom Dachboden gestürzt war und die Tür zum Baderaum blockierte. Das Atmen, der Rauch und die stetig zunehmende Hitze machten ihr zu schaffen.
Die Urgewalt des Feuers fraß sich durch das Haus und ließ heiße Glut zurück. Auch den dicken Balken hatten die Flammen schon zu verzehren versucht, doch das massive Holz hatte bisher widerstanden. Nur die äußeren Schichten waren verkohlt, glommen aber immer weiter. Die Zeit drängte. Lea mühte sich inzwischen mit bloßen Händen. Sie schien unter einer Schockwirkung zu stehen. Die Brandwunden an Händen, Armen und Füßen spürte sie nicht.
Noch immer stand Elsbeth bei den Helfern, die längst resigniert hatten. Denn das Holz des Fachwerkhauses brannte wie Zunder. Hier konnte man nicht mehr helfen; im Gegenteil. Man brachte sich nur selbst in Gefahr. Der Löschtrupp konzentrierte die Bemühungen darauf, die Nachbarhäuser zu tränken. Dabei standen zunehmend mehr Gaffer im Weg. Zu den Schaulustigen zählte auch eine Greisin, die mahnend einen Zeigefinger hob: »Gott wacht über diejenigen, die auf ihn vertrauen und nach seinen Geboten wandeln«, bemerkte sie. »Aber nicht jeder verdient sich seinen Schutz.« Elsbeth musste kräftig schlucken. Ob die Frau recht hatte mit dieser Ansicht?
Nach wie vor peitschten die Sturmböen über die Straßen, Gärten und Häuser. Die Windstöße wirbelten das Geäst von Büschen und Bäumen, von Balken und Dachschindeln durch die Luft. Dumpf dröhnte es, als ein Teil der Wand aus Fachwerk auf die Seite schlug. Dann standen Lea und Agnes im Freien. Nur mit Mühe waren sie der Hölle entkommen. Sie taumelten. Agnes keuchte. Sie hatte Abschürfungen an Armen und Händen. An Lea hingegen hing der Gestank nach verbranntem Fleisch. Sie hielt sich stöhnend die Schulter, an der ein Stein sie getroffen hatte. Sie krümmte sich und röchelte.
»Mama!«, rief Agnes fassungslos. Derweil machte Elsbeth schreiend und winkend auf sich aufmerksam, als sie ihren Vater näherkommen sah, der sich mühsam durch das Gedränge zwängte. Mit leeren Blicken schauten sich ihre Eltern einander an.
»Mama hat Agnes gerettet!«, rief Elsbeth, die sich an ihren Vater zu klammern versuchte. Doch Altemeier schüttelte seine Tochter ab. Einen Lidschlag später wurden Trümmerteile umhergeschleudert. Auch neben Agnes sauste ein Bruchstück des Mauerwerks herab. Ein Fragment des Dachfensters baumelte daran. Die spitzen Zacken des geborstenen Glases waren von verheerender Wirkung. Während Agnes nicht zu Schaden kam, wurde ihre Mutter von dem Geschoss niedergestreckt. Zugleich bohrten sich Splitter kleinster Glas- und Steinbröckchen in ihren Körper.
»Mama!«
Agnes ließ sich im Schlamm auf die Knie fallen.
»Mama!«
Tränen quollen dem Kind aus den Augen. Mit Entsetzen erblickte Agnes die heftig blutende weit klaffende Wunde an der Stirn und das bleiche Gesicht ihrer Mutter. Lea schien Worte formen zu wollen, doch ihre Lippen bewegten sich kaum. Wie ein Hecheln wirkte es, als sie darum kämpfte, Atem zu holen. Es war ein mühevolles Ringen. Die giftigen Dämpfe des Rauchs hatten ihr Opfer gefunden. Der zusätzliche Hieb hatte ein Übriges getan.
»Agnes«, flüsterte die Mutter ein letztes Mal. Ein Zittern durchfuhr sie, während sie den letzten Atemzug ausstieß.
Agnes presste eine Faust vor ihren Mund und biss auf die Knöchel.
»Mama!«, schrie sie verzweifelt. »Nun helft ihr doch! Warum hilft ihr denn niemand?«
Hinter einem Tränenschleier sah sie Menschen, die miteinander zu tuscheln schienen. Aber niemand rührte eine Hand. Auch Altemeier scherte sich nicht um die tödlich Verletzte.
»Dieses törichte Ding musste sich unbedingt im Haus verstecken, anstatt sich schleunigst in Sicherheit zu bringen«, wies die Alte auf Agnes. »Ungehorsames Blag! Voller Widersetzlichkeit und Trotz! Aber wen wundert’s, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm!«, schimpfte die Furie.
»Das ist nicht wahr!«, erhob Elsbeth die Stimme. »Ihr da! Sagt was! Sagt, dass diese widerliche Kröte die Unwahrheit spricht! Sie kann doch überhaupt nicht wissen, was im Haus vorgefallen ist!«
Elsbeth schien die Fassung zu verlieren, während Agnes zitternd und entmutigt neben ihrer Mutter kniete. Greinend vor Angst. Niedergeschlagen von dieser Ungerechtigkeit, die ihr hier widerfuhr. Voller Gram in Anbetracht der Feigheit der Umstehenden und im Angesicht des Todes ihrer Mutter. Sie sah, wie die Hexe mit ihrem Krückstock drohend auf Elsbeth einschlug, während der Vater nichts tat, um der geifernden Alten Einhalt zu gebieten.
Entkräftet ließ sich Agnes von Elsbeth hochziehen. Mit Mühe wichen sie beiseite, um den Hieben zu entgehen.
Nachdem sich Franz Altemeier kurz und emotionslos über die tote Mutter seiner Kinder gebeugt hatte, schaute er noch einmal zu den Ruinen seines Hauses, das von einer schwarzen Rauchsäule verhüllt wurde. Schließlich traf Agnes sein vernichtender Blick.
Welchen weiteren Verlauf dieser Unglückstag im August nahm, daran vermochten sich die Mädchen später nur mit Unbehagen zu erinnern. Dass die Regenmengen die Alme, die Lippe und die Pader überfluteten, dass die Auen nunmehr Seenplatten glichen, die Tiere, Gärten und einige nahegelegene Häuser verschlangen, das sollte sich in den folgenden Tagen erst noch zeigen. Wie in Trance und erschüttert durch die Ereignisse und durch den Verlust ihrer Mutter stolperten Elsbeth und Agnes als verstörte Gestalten ihrem Vater hinterher.
»Folgt mir!«, befahl er mit barschem Tonfall. »Aber haltet Abstand!«
Agnes litt seelischen Schmerz. Sie wusste, dass es um das Miteinander ihrer Eltern schlimm gestanden hatte. Sie hatte immer gespürt, dass auch die Mutter ihren Beitrag dazu geleistet hatte – selbst wenn der Vater die Ursache allen Übels war, so war sie überzeugt. Immerhin hatte sie bis vor wenigen Tagen noch zu ihrer Mutter ins Bett krabbeln dürfen, wenn die bösen Träume kamen. Papa ist ein Scheusal, das war Mamas Meinung gewesen. Agnes stimmte dem zu. Angsterfüllt und argwöhnisch blickte sie hinter ihrem Vater her.
Altemeier sah sich genötigt, Leas leblosen Körper zum Marstall der Residenz zu tragen. Dort traf er auf Irmtraud Grave und ihren Sohn, die sich mit großer Anteilnahme um die Mädchen kümmerten. Nunmehr richtete Altemeier seine Boshaftigkeit ausschließlich gegen Agnes. Anklagend wies er auf seine Tochter, die er mit zorniger Herablassung anstarrte:
»Sie hat es getan! Sie hat mich um meinen Besitz gebracht. Sie ist verantwortlich! Ich will sie nie mehr wiedersehen!«
Irmtraud und ihr Sohn Ernst nahmen Franz Altemeier in ihren Haushalt auf. Auf Irmtrauds Initiative hin erhielt Agnes bei den Buchbinders ein Dach über den Kopf. Da würde sie besser aufgehoben sein, um – fern ihres Vaters – mit ihren traumatischen Erlebnissen leben zu lernen. Recht hatte sie. Die Buchbinders richteten dem Kind einen Schlafplatz ein, besorgten dem Mädchen Kleider und vor allem: Sie mühten sich redlich, nicht nur die körperlichen Wunden zu heilen, die Agnes in dem Inferno ihres Elternhauses davongetragen hatte. Irgendwann ließ Agnes es sogar zu, dass man sie wieder in den Arm nehmen durfte.
Elsbeth fand bei der vierzehnjährigen Cousine Sophie ein neues Zuhause. Sophies Eltern, das Schauspielerehepaar Georg Gottfried Bürger und Wilhelmine Charlotte Albertine, die Schwester Leas, waren dazu bereit, die Verwandte aufzunehmen. In der Not schienen sie also zusammenzuhalten, die Bürgers und die Altemeiers, obwohl man sich einst nach einem Streit und dem folgenden Zerwürfnis jahrelang aus dem Weg gegangen war.
»Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen«, hatte Irmtraud zu Franz Altemeier gesagt. Der hatte nur zustimmend den Kopf genickt und Irmtrauds Tatkraft und Entschlossenheit bewundert. Wie hatte er sich doch einst in Irmtraud Grave getäuscht.
Er dachte über seine in letzter Zeit vage umrissenen Pläne nach. Sie würden unter den neuen Gegebenheiten gewiss schnell konkrete Gestalt annehmen können. Jetzt war er sich sicher: Sein Leben musste eine deutliche Veränderung erfahren.