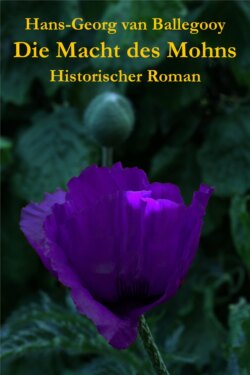Читать книгу Die Macht des Mohns - Hans-Georg van Ballegooy - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zweiter Teil: 1796 – 1799. Ein verhängnisvolles Erbe
ОглавлениеEins
Sommer 1796 – Neubeginn
Veränderungen gab es nicht nur in Neuhaus und Paderborn; ein Wandel bahnte sich im Sommer des folgenden Jahres auch im etwa eine Tagesreise entfernten Lemgo an:
Es war am ersten Juni-Tag. Adalbert Schmidt aß mal wieder einen Pickert, zur Abwechslung nicht mit grober Leberwurst sondern mit Rübenkraut. So viele regionale Variationen dieser typischen Speise der ärmeren Bevölkerung im Westfälischen hatte er in seinem Leben schon verzehrt. Dennoch war er diesem Gericht nie überdrüssig geworden. So gab es wenigstens etwas Genießbares, das seiner ohnehin schlechten Stimmung nicht noch einen zusätzlichen Dämpfer verpasste. Der Suche nach seiner Halbschwester war er inzwischen sehr müde geworden. Allerdings – gleichgültig war es ihm noch nicht, was aus Johanna geworden sein mochte. Tief in Gedanken versunken sinnierte er über ihre Vergangenheit, als er das pfannkuchenartige Gericht aus Buchweizenmehl und geriebenen Kartoffeln verspeiste.
Er hatte Johanna nahezu zwanzig Jahre lang nicht mehr gesehen. Sie war noch ein Kind gewesen, als ihre Mutter, die zweite Frau seines Vaters, gestorben war. Der Vater hatte die Tochter in Soest in ein Kloster gegeben. Damals musste sie ungefähr sechs Jahre alt gewesen sein. Obwohl er damit gegen seinen eigenen Willen handelte, hatte Vater Schmidt damit ein Versprechen eingelöst, das er Johannas Mutter auf dem Sterbebett gegeben hatte. Er schien darüber nicht glücklich zu sein. Im Kloster war die Tochter als Johanna Grünberg bekannt. Dort trug sie den Namen ihrer Mutter. Auch das war wohl einer der letzten Wünsche ihrer Mutter gewesen. So viel hatte Adalbert inzwischen bei seinen Nachforschungen herausgefunden.
Adalbert langte noch einmal zu. Abfällig hatte irgendeiner seine Leibspeise kürzlich als »Gefräß« tituliert. Und dass man dazu Kaffee trank – dafür hatte jener Banause nur Unverständnis übrig. Adalbert kommentierte die Sichtweise dieses Zeitgenossen, indem er eine seiner rötlichen Augenbraue hob. Dann reckte er sein markantes Kinn vor und genehmigte sich ein Gläschen Kornbrand. Er betrachtete das Glas, in dem er sein Spiegelbild entdeckte: Aus seinem Zopf hatten sich einige der mehr rötlichen als braunen Haare gelöst. Sie ringelten sich entlang der Koteletten über die kurzen Bartstoppeln des länglichen Gesichts bis hin zu den Mundwinkeln. Er strich die widerspenstigen Strähnen beiseite, die ihn kitzelten und schaute in sein Antlitz. Er sei seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten, hatte man gesagt. Tatsächlich gab es viel Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn.
Adalbert war das einzige Kind aus der ersten Ehe seines Vaters – eine Ehe, die vom Leid des Siebenjährigen Krieges geprägt gewesen war.
Er seufzte in Gedanken daran, was ihm sein Vater einmal berichtet hatte: Die Eltern hatten in Minden in einem Lazarett geholfen. In der Lazarettkirche St. Simeonis hatten sie die wirkliche Brutalität des Soldatendaseins erlebt. Denn die Mehrzahl der Soldaten starb nur selten an Schussverletzungen sondern meistens an Krankheiten, Seuchen und mangelhafter Hygiene. Kurz vor dem Ende des Krieges 1763 war die Mutter wenige Wochen nach seiner Geburt ebenfalls gestorben. An Typhus, hatte ein Arzt festgestellt. Bereits ein Jahr später hatte der Vater, der ehemalige Postmeister, Bibliothekar und Schriftsteller Moritz Schmidt, der sich auch auf das Zeichnen von Portraits verstand, wieder geheiratet.
Adalbert ließ sich noch einen Korn bringen. In Gedanken stieß er auf das Wohl seiner Schwester an.
Im Jahre 1770 war Johanna geboren worden. Und bei seiner Stiefmutter waren Johanna und er schließlich aufgewachsen. Er war sieben Jahre älter als Johanna und zählte bereits dreizehn Jahre, als Maria Grünberg starb und Johanna ins Kloster aufgenommen wurde. Seit jeher war es ihm ziemlich unverständlich, warum die Klosterobrigkeit verlangte, dass der Kontakt zur Familie unterbunden werden sollte. Für ihn schien es, als sei Johanna hinter Klostermauern begraben worden. Und sein Vater hatte sich geweigert, in der Folge jemals über Johanna zu sprechen.
Erst als sein Vater im vergangenen Jahr starb, war mit diesem Tabu gebrochen worden. Adalbert hatte versprechen müssen, nach Johanna zu suchen. So wie er für sich selbst vom Vater ein beträchtliches Vermögen erhielt, so sollte er auch seiner Halbschwester ein beachtliches Erbe aushändigen. Sofern sie dazu bereit wäre, ihr Leben außerhalb der Klostermauern fortzusetzen, hatte der Vater verlangt.
Adalbert blickte sich in dem Raum des Gasthofs um, in dem er seine letzte Speise eingenommen hatte. An der Wand hing ein Gemälde – eine Ansicht der Stadt Lemgo.
Hierhin hatte es ihn kurze Zeit später geführt, nachdem Johanna aus ihrer Mitte verschwunden war. Er war in der ehemaligen Meyerschen Druckerei und Hofbuchhandlung in die Lehre gegangen, wo man ihm auch Unterkunft gewährt hatte. Derweil arbeitete sein Vater in der preußischen Besitzung Mark in dem kleinen ländlichen Städtchen Hamm. Unweit des Nassauer Hofs, einem ehemaligen Adelssitz, bewohnte der Vater ein Häuschen. Vor zwei Jahren hatte er sein Heim fluchtartig verlassen müssen, und natürlich hatte Adalbert ihm Aufnahme in seiner eigenen kleinen Wohnung in Lemgo gewährt. Beiden war es nur noch für kurze Zeit vergönnt gewesen, gemeinsam im Buchladen zu arbeiten. Dann hatte der Vater plötzlich gefühlt, dass sein Ende nahte.
»Pecunia non olet«, hatte der Vater einen römischen Kaiser zitiert – Geld stinkt nicht, oder doch? Da war sich Adalbert nicht sicher, als er erfahren hatte, woher der größte Teil des Reichtums stammte, den er erben sollte. Und darum hatte er sich nach dem Tod seines Vaters zunächst nur zögerlich und halbherzig dem Vermächtnis entsprechend seine Schwester zu finden bemüht.
Inzwischen hatte er auch von einer anderen Redewendung gehört: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Hieß es nicht so? Bedeutete dies nicht, dass man ein Geschenk nicht bemängeln oder kritisieren, sondern dankbar annehmen solle? Also hatte er sein Erbe doch angetreten. Schließlich machte es ihn recht unabhängig. Gleichwohl hatte zuletzt noch die tägliche Arbeit im Mittelpunkt gestanden, obwohl es des Gelderwerbs wegen nicht mehr notwendig war. Adalbert konstatierte, dass er der Arbeit stets mit Freuden nachgekommen war, besonders bei der Gestaltung der Lippischen Intelligenzblätter.
Ob er das auch eines Tages von seiner zukünftigen Tätigkeit würde sagen können? Er war im Begriff, nach Paderborn umzuziehen und in die Druckerei und Setzerei des Paderbornischen Intelligenzblatts zu wechseln.
Von dort würde er hoffentlich weitere Nachforschungen anstellen können, war sein Plan. Denn er hatte aus einem Briefwechsel Johannas mit einer Freundin erfahren, dass seine Schwester vor Jahren dem Klosterleben entsagt hatte und nach Neuhaus geflohen war.
»Bist fast ein alter Säufer, Adalbert Schmidt!«, sprach er zu sich selbst. In einem Zug kippte er seinen dritten Korn hinunter. »Auf geht’s! Paderborn, wir kommen schon!«
Zehn Tage später geschah es in Paderborn, dass die kleine Sophie Bürger für ihren ersten Auftritt in der Schauspielertruppe begeisterten Applaus erhielt, nachdem sie in der Kinderrolle als Lina in Karl Ditters von Dittersdorfs Werk DAS ROTE KÄPPCHEN überzeugt hatte. Soeben war das Singspiel aufgeführt worden, das vom Gemeindevorstand Nitsche handelt, der eifersüchtig über seine Frau wacht. Um den Frieden im Haus zu wahren, bekommt Nitsche ein rotes Käppchen mit der Versicherung geschenkt, dem Träger dieses Käppchens werde keine Frau untreu werden. Und so wird Nitsches Eifersucht nichtig.
Elsbeth Altemeier und ihr Vater Franz befanden sich im Publikum, das sich trefflich amüsierte und gemeinsam mit allen Schauspielern das wundertätige Käppchen pries: »Und wenn es nicht helfen sollte, so wird es auch nicht schaden!«
Ob der Georg wohl ebenso ein rotes Käppchen gebrauchen könnte, dachte Franz Altemeier bei sich. Denn der neigt gleichfalls zu Eifersüchteleien, obwohl er selbst kein Kind von Traurigkeit ist. Oder sollte es eher Wilhelmine tragen, um ihren Mann davor zu warnen, sich weiterhin in die Schauspielerkollegin Elise zu vergucken?, ging es ihm durch den Kopf.
Schon einige Auseinandersetzungen hatte es deswegen im Hause der Bürgers gegeben. Aus diesem Grund und wegen des unsteten Lebenswandels seines Schwagers wuchs der Zweifel bei Franz, ob Elsbeth weiterhin bei der Schauspielerfamilie untergebracht bleiben sollte.
»Na, Georg, wie lange bleibt denn eure Truppe diesmal in Paderborn? Kann ich euch die Elsbeth noch ein Weilchen anvertrauen?«, fragte Franz mit leicht provozierendem Unterton, als sie in die Unterkunft der Bürgers zurückgekehrt waren.
»Da hab mal keine Sorge«, fuhr Wilhelmine dazwischen. »Die Mädchen kommen prima miteinander aus. Sie lernen zusammen. Elsbeth begleitet uns gerne zu den Theaterproben und ... Übrigens: Die Gesellschaft Heinzius hat kürzlich erst die Konzession erhalten, auch ein weiteres Jahr noch in Paderborn zu bleiben. Unter Berücksichtigung der großen Kosten zur Erbauung der Theaterbude wird die Erlaubnis erteilt, hat es vom Rat geheißen. Und wegen der schlechten Geschäfte in diesen Zeiten und weil der Direktor auch in Schulden geraten ist, wird die normalerweise anfallende tägliche Gebühr von zwei Talern sogar zur Hälfte erlassen«, ergänzte Wilhelmine höhnend. »Ja, Franz, großzügig ist man in Paderborn!«
»Das war aber wohl nicht immer so«, erwiderte Franz. »Bei eurem letzten Aufenthalt habt ihr doch kaum eine Vorstellung geben können.«
»Ja, im Jahr 81, war noch manches anders. Da gab es noch die Bedingung, dass man die in jener Woche aufzuführenden Schauspiele stets in der vorhergehenden Woche dem worthabenden Bürgermeister zum Zwecke ihrer zu verfügenden Zensur einzureichen habe«, zitierte Georg eine Verfügung aus dem Gedächtnis.
»Oh, den Wortlaut hast du dir aber gut gemerkt«, spottete Franz.
»Der Georg hat sich seit damals einiges gemerkt«, hänselte Wilhelmine. »Nicht wahr, Georg, damals hast du dich schon von den bewaffneten Kompanien beeindrucken lassen, die der Fürstbischof Wilhelm Anton nach den Ereignissen beim Kaffeelärm einrücken ließ!«
»Was hatte es eigentlich mit dem Kaffeelärm auf sich?«, fragte Franz. »Wir haben das damals gar nicht so genau verfolgt. Wir wohnten zu der Zeit noch nicht im Hochstift.«
»Na ja, du weißt doch, der Fürstbischof Wilhelm Anton war eine einfache Persönlichkeit, die sich gab, wie sie war. Immerzu gerade heraus, formlos im äußeren Auftreten, freimütig und ungezwungen in der Rede und im Handeln«, erinnerte sich Georg. »Sein Lebenswandel erfüllte die strengsten Forderungen der Sittenreinheit, und in seiner Denkweise zeigte er sich edel und menschlich fühlend. Ihm fehlte außerdem keine der Eigenschaften eines sparsamen Hausherrn.«
»Wenn es wahr ist, was unterrichtete Zeitgenossen zu erzählen wissen«, führte Wilhelmine fort, »so war die Vorliebe zum Geld seine große Schwäche, wobei er keineswegs verschwenderisch damit umging. Im Gegenteil: In seinen Mußestunden soll das Zählen der Goldrollen eine seiner Lieblingsbeschäftigungen gewesen sein, wie man sagt.«
»Einerseits muss man ihm zugute halten, dass er sein Gut keineswegs durch Monopole oder vermehrte Auflagen anhäufte. Hingegen beschränkte er die Hofhaltung und passte seinen eigenen Lebensstil an. Andererseits neigte er dazu, in die innersten Verhältnisse des Privatlebens seiner Untertanen zu dringen. Dabei gab er sich leider alle Mühe, den mittleren und niederen Volksklassen die Gelegenheiten zur Genusssucht und Verschwendung zu nehmen«, kommentierte Georg.
»Stimmt es, dass er die ausschweifenden Fastnachtsbelustigungen einstellte?«, fragte Franz.
»Das ist wohl richtig. Und er stellte die unmäßigen Gast- und Saufgelage ab, welche bei den Hochzeiten, Kindtaufen und Begräbnissen der gemeinen Bürger und Bauersleute üblich waren. Auch strebte er danach, den Kleideraufwand in diesen Ständen zu steuern, indem er genau vorschrieb, was sie tragen, und was sie nicht tragen sollten.«
»Nun wollte Wilhelm Anton auch den Versuch machen, seinen Untertanen das Kaffeetrinken abzugewöhnen«, lamentierte Wilhelmine. »Des Haushaltswesens kundig und in Zahlen geübt überschlug er die enormen Summen, die der Verbrauch des Kaffees Jahr für Jahr aus dem Lande zog, was ihn bewog, diesen Luxus-Artikel aus dem Leben des gemeinen Menschen zu verbannen.«
»1777 erließ er ein Edikt, das dem Bürger- und Bauernstande und den niederen Beamten – also auch dir, Franz – den Ankauf und Gebrauch des Kaffees untersagte. Doch gleichzeitig gestand man dem Adel, den höheren Beamten und der Geistlichkeit dieses Getränk zu. Und der Handel mit Kaffee wurde nur noch den Paderborner Kaufleuten gestattet. Bei Missachtung der Anordnung sollte konfisziert werden. Sogar Geldbußen bis zu zehn Gulden wurden erhoben.«
»Und natürlich durfte auch der Georg zahlen, den irgendjemand denunziert hatte«, beklagte sich Wilhelmine.
»Vor allem die Ungerechtigkeit führte natürlich zur Verbitterung«, redete sich Georg nun in Rage. »Man gestand dem Vornehmen und Reichen wieder einmal ein Privileg zu, das man dem weniger Begüterten versagte. Indes glaubte ein Jeder, dass er auf dieses Getränk einen Anspruch hätte. Einstweilen begnügte man sich mit bitteren Äußerungen der Unzufriedenheit und mit Spottreden. Derweil trösteten wir uns mit der Überzeugung von der praktischen Unausführbarkeit der Verordnung, weil die mit der Handhabung zunächst beauftragten niederen Polizeibeamten die Bedürfnisse und Gefühle der Menge selber teilten und daher ihren Kontrolldienst meist sehr nachlässig versahen.«
»Vier Jahre waren beinahe vergangen. Man hatte den Vorgang bereits vergessen, als es dem Regenten einfiel, das Verbot zu erneuern. Da hielt sich das Volk nicht länger an den Anordnungen. Drohungen und Verwünschungen kennzeichneten den Ungehorsam. Es wurden verhöhnende Gassenlieder gesungen, und ein Unruhe stiftender Auftritt reihte sich an den andern. Und Georg war dabei«, schimpfte Wilhelmine.
»Vor allem richteten wir unseren Zorn gegen den damaligen Vizepräsidenten Meyer, dem man hauptsächlich für die Einführung des verhassten Edikts verantwortlich machte. Als unsere Unzufriedenheit eskalierte, haben wir ihm heimlich alles Wasser aus seinem Brunnen in den Keller geleitet. Bedauerlicherweise ging dabei ein großer Teil seines Weinvorrates zu Grunde«, amüsierte sich Georg noch im Nachhinein. Seine Schadenfreude war unverkennbar. Und weiter ereiferte er sich:
»Eines Abends wurde auf dem Marktplatz an hell erleuchteten Tischen ein öffentlicher Kaffeeausschank gegeben. Ein Jeder konnte hier frei trinken, was weidlich genutzt wurde. Ganze Scharen beiderlei Geschlechts eilten herbei und stillten ihre Begierde nach dem begehrten Getränk. Gleichzeitig war in der Nähe auf einer Tribüne ein Musikchor aufgestellt, dessen Gesang sich mit dem Lärm der versammelten Menge vereinigte. Zur Steigerung der erhitzten Gemüter ließen wir auch geistige Getränke in Fülle reichen. Und unter den Straßenjungen ließen wir sogar zur Vermehrung des Durcheinanders Trommeln und Pfeifen verteilen. Durch diesen Auftritt entstand ein so heilloses und wirres Chaos, dass die nächtliche Ruhe der Stadt erheblich gestört wurde.«
»Wie die Kompanien mit geladenem Gewehr einrückten und sich vor dem Rathaus aufstellten, begrüßten wir sie mit den geistlichen Liedern AVE MARIA und STABAT MATER, verhielten uns aber ansonsten ruhig im Angesicht der Waffen«, führte Wilhelmine weiter aus.
»Deswegen sahen die Führer der Truppen auch keine Notwendigkeit, mit Schärfe einzuschreiten«, beschwichtigte Georg.
»Der militärische Aufzug lief daher mit einer bloßen Drohung, ohne Verhaftungen und ohne irgendeine Anwendung von Gewalt ab. Im Grunde war uns auch nur daran gelegen, das Kaffee-Edikt lächerlich und auf diese Weise unwirksam zu machen. Und dies gelang vollkommen. Es wurde offiziell nie zurückgenommen, aber man ignorierte es einfach.«
»Dies wäre doch wunderbarer Stoff fürs Theater«, neckte Franz.
»Vielleicht«, nahm Georg die Idee auf. »Ich versuche ohnehin, irgendwann einmal etwas Literarisches zu verfassen.«
»Übrigens«, nahm Wilhelmine einen Themenwechsel vor, »nur wenige Tage später wurde unsere Sophie im Gasthaus Zum Bremer Schlüssel geboren. Und jetzt spielt sie schon mit in unserer Truppe. Vielleicht finden wir auch für Elsbeth noch eine geeignete Rolle.«
»Welche Rollen spielt ihr denn in eurer Gesellschaft?«, wollte Franz wissen. Da holte Wilhelmine einen Theaterkalender hervor:
Mme Bürger:
Erste Singrollen, sanfte Weiber,
zärtliche und affektierte Mütter im Lustspiel
Liebhaberin im Lust- und Trauerspiel
Hr. Bürger:
Chevaliers, Pedanten, Spitzbuben, Juden
»Ich würde aber auch gerne intrigante Rollen spielen«, hoffte Georg Bürger, dass ein lang ersehnter Traum bald in Erfüllung ginge.
Da könnte ich vielleicht auch erfolgreich mitspielen, dachte Franz Altemeier bei sich, der sich in den Gedanken verrannt hatte, die Preußen mehr als bisher zu umgarnen. Nachdem man ihm vor vier Jahren die Stelle im Rentamt verwehrt hatte, war er mehr und mehr zu der Überzeugung gekommen, dass er in der Verwaltung bei den Preußen sicher längst eine gute berufliche Laufbahn eingeschlagen hätte.
Gut eine Woche später, am 19. Juni, hatte Friedrich Wilhelm Adam Sertürner sein dreizehntes Lebensjahr vollendet und seinen Geburtstag gefeiert. Sein größter Wunsch sollte ihm am Tag danach erfüllt werden: Er durfte seinen Vater bei einer seiner Inspektionsreisen begleiten.
Wie schon in den frühen Tagen seiner Kindheit konnte sich Friedrich Wilhelm immer noch für die naturwissenschaftlichen Inhalte besonders begeistern, sowohl im Rahmen des schulischen Unterrichts als auch, wenn sein Vater ihm das Wissen vermittelte, das dieser aus seiner Tätigkeit als Landvermesser und Architekt bezog. Wegen des großen Interesses an der Arbeit des Vaters bemühte sich Josephus Simon gerne, den Sohn auf den väterlichen Beruf vorzubereiten. Denn das stand für Friedrich Wilhelm fest: Er würde den Beruf des Vaters erlernen und ausüben wollen.
Bei seiner Tätigkeit im Dienste der Hofkammer des Fürstbistums Paderborn nahm der Vater Inspektionen beim Straßen-, Wege- und Brückenbau wahr, bei der Regulierung von Flüssen und Bächen, aber auch beim Bau von Kirchen. Und so führte der Weg von Vater und Sohn an diesem Tag nach Paderborn.
Zunächst suchten sie die Paderquellen auf, die der Stadt ihren Namen gaben. An der Quelle der Wäschepader begegnete ihnen der Blaufärber Rieländer, ein Bekannter von Josephus Simon. Über den wusste der Vater, dass es Differenzen mit der Hofkammer gab, weil der Blaufärber einen Garten veräußern wollte, der zu den bischöflichen Ländereien gehörte.
»Schön, Sie zu sehen, Rieländer! Hatten Sie schon den Termin wegen Ihres Gartens?«, sprach Josephus Simon den Blaufärber an.
»Ach ja, nur Ärger, immer nur Ärger: Damals war doch dem Tiemann und dem Thunemeyer ihrer Bitte entsprochen worden, dass man sie befreien möge von der Verpflichtung, der bischöflichen Küche zu Neuhaus Eier und Hühner abführen zu müssen, weil dem Einen im letzten Sommer der Garten von der Alme fortgerissen worden war und dem anderen zwei Morgen Land von der Lippe abgespült sind. Und was muss ich sagen? Was muss ich sagen? Jetzt gehöre ich doch tatsächlich zu den verpflichteten Einwohnern, Hühner und Eier liefern zu müssen, und ich darf den Garten nicht veräußern«, klagte Rieländer. »Aber ich bin nicht der einzige mit Problemen, bin nicht der einzige: Habe soeben Bäcker Reitemeyer getroffen, der mit Conrad Schäfer den Garten tauschen möchte. Dem will man aber nicht stattgeben, weil beim Conrad noch Zahlungen des Bürgergeldes ausstehen aus der Zeit seiner Ansiedlung. – Das ist alles nicht so einfach, gar nicht einfach!«, antwortete der Blaufärber mürrisch.
»Meister Rieländer, das ist übrigens mein Sohn: Friedrich Wilhelm begleitet mich zum ersten Mal zu den Paderquellen«, stellte Josephus Simon seinen Sohn dem Blaufärber vor.
»Na dann pass mal gut auf, mein Junge! Pass gut auf, damit du’s auch mal zu was bringst, so wie dein Vater. Weißt du eigentlich schon, was an der Quelle der Wäschepader so besonders ist? Sie ist nämlich was besonderes, darum heißt sie auch Warme Pader. Das Wasser ist erheblich wärmer als das Wasser der anderen Quellen. An besonders kalten Frosttagen dampft es. Und das Wasser ist immer klar. Darum ist das Quellbecken der bevorzugte Platz für die Wäscherinnen«, erklärte der Blaufärber.
»... und wir müssen feststellen, dass hier etliche Balken und Bretter fehlen, aus denen Stege über das Wasser gebaut waren«, stellte der Vater stirnrunzelnd fest. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stege weggeschwemmt worden sind. Gewiss konnte jemand das Holz für eigene Zwecke gebrauchen. Vielleicht sollte eine Wache doch auch gelegentlich hier mal ihre Runden drehen«, merkte Josephus Simon an, »wäre sicher auch beruhigend für die Waschweiber ... Aber jetzt wollen wir weiter zur Kolkpader. Meister Rieländer ...«
Josephus Simon war im Begriff sich vom Blaufärber zu verabschieden, als er von einem etwas ungehobelt pöbelnden Subjekt angerempelt wurde und beinahe in das Quellbecken gestürzt wäre, wenn Rieländer ihn nicht reaktionsschnell aufgefangen hätte.
»Leute gibt’s, sag ich, Leute gibt’s«, gab Rieländer kopfschüttelnd zum Besten. »Da scheint’s jemand sehr eilig zu haben. Und schlechte Laune hat er auch noch«, schaute der Blaufärber dem Mann verwundert nach. »Na dann, nen schönen Tag noch, Herr Sertürner! Schönen Tag noch, Junge!«
Als sie sich verabschiedet hatten, teilte Friedrich Wilhelm dem Vater eine Beobachtung mit, die noch bedeutsam werden würde. Denn bei dem soeben erlebten Zwischenfall hatte Friedrich Wilhelm wahrgenommen, dass der Mann hinkte.
»Hier haben wir die Dammpader«, erläuterte Vater Sertürner im weiteren Verlauf des Rundganges. »Sie heißt wegen des künstlichen Damms so, der diesen Paderarm von der Warmen Pader trennt. Und hier, von Osten kommend, mündet ein Teil der Börnepader in zwei Armen ins Quellbecken der Dammpader. Den meisten Leuten ist die Dammpader als Kolkpader bekannt, weil sich im südwestlichen Teil des Quellbeckens der blaue Kolk befindet, eine Quellvertiefung ... Scheint alles in Ordnung zu sein. Der Damm hat keine Brüche und die Mündungsarme der Börnepader sehen auch unverändert aus.«
»Der Lehrer hat mal erwähnt, dass die Börnepader auch Tränkepader genannt wird«, stellte Friedrich Wilhelm fragend fest.
»Das hat seinen Grund darin, dass die Ackerbürger ihr Vieh zu diesem flachen Quellbecken, also zur Tränke treiben. Schon vor über zweihundert Jahren ließ die Stadt an dieser Stelle eine Wasserkunst errichten. Die Wasserkraft wird über ein Wasserrad auf eine Kolbenpumpe übertragen, die über ein Rohrleitungssystem Wasser künstlich in die Kümpe der höher gelegenen Stadtteile befördert. Diese Holzleitungen müssen natürlich immer mal wieder ausgebessert werden.«
»Warum wurde solch eine Wasserkunst errichtet?«, fragte Friedrich Wilhelm.
»Nun, es muss zuvor einen großen Stadtbrand gegeben haben. Der war Anlass zur Errichtung der Wasserkunst, so dass immer genügend Wasser zur Verfügung stand, wenn irgendwo ein Feuer ausbrach«, antwortete der Vater. »Wir wenden uns jetzt nach Osten zum Dom. In der Nähe befindet sich das Quellbecken der Rothobornpader.«
Am Ziel angelangt erläuterte Sertürner weiter: »In dieses Becken mündet die Augenquelle und der Rothoborn, eine sehr starke Quelle im Keller der Kaiserpfalz. Diese Quelle soll der Legende nach Heilkraft erlangt haben. Auch die Augenquelle ist sehr sauber. Ihr Wasser wird gern zum Augenwaschen benutzt, wobei sich die Leute auf den im Wasser liegenden Trittstein stellen.«
»Gibt’s nicht auch noch eine Dielenpader?«
»Die befindet sich weiter östlich. Der Fußweg besteht lediglich aus einer Lage Dielen, die auf Pfählen ruhen. Die Pfähle sind in den Flussgrund eingerammt. Da müssen unbedingt Reparaturen vorgenommen werden. Denn etliche Pfähle und Dielen sind morsch, so dass wir dort besser nicht entlanglaufen sollten. Wir nehmen einen anderen Weg in Richtung des Neuhäuser Tores. Dann kommen wir auch zur Spitalmauer, wo sich schließlich noch die Quelle der Maspernpader befindet ...«
»Iiieeh, hier riecht’s nicht wirklich gut«, rümpfte Friedrich Wilhelm wenig später die Nase.
»Du siehst die nebeneinander liegenden Gruben? Es sind Gemeinschaftseinrichtungen der Gerber sowie der Schuhmacher, die ihr eigenes Leder herstellen. Die Häute werden in Kalkwasser gelegt, um sie zu entfetten und aufschwellen zu lassen, sodass sie dann weiterverarbeitet werden können. Das Äschern entfernt die Haare von der Rohhaut und bereitet so das Gerben vor. – Glücklicherweise haben wir hier keine Kontrollen durchzuführen«, bestätigte der Vater den unangenehmen Gestank.
»Hier, am oberen Flusslauf, treibt die Pader zahlreiche Mühlen an, zum Schmieden, zum Getreide Mahlen, und es gibt noch Öl- und Walkmühlen, die teilweise nicht in bestem Zustand sind. Ich muss dringend mit den Pächtern besprechen, was verbessert werden kann ... Da vorne sehe ich Müller Stümpel. Seine Mühle wird mit einem unterschlächtigen Wasserrad betrieben. Dabei fließt das Wasser unter dem Rad durch eine Führung, die verhindert, dass Wasser unterhalb und seitlich der Schaufeln abfließt, ohne das Rad anzutreiben. – Wenn wir jetzt nach Neuhaus zurückwandern, kommen wir bei der Kirche St. Heinrich und Kunigunde vorbei. Wie du weißt, wird da immer gebaut. Manchmal kann ich einen Rat geben«, bemerkte Josephus Simon, während er unterwegs seinem aufmerksamen Sohn etliche Vorgänge aus seinem reichhaltigen beruflichen Erfahrungsschatz schilderte.
»Lehrer Buchbinder, was ist bei der Kirche los? Ich sehe einige Wachen aufgeregt herumlaufen«, rief Josephus Simon schon von Weitem.
»Ach, Meister Sertürner, wir haben soeben eine vermummte Gestalt gesehen, die sich am Opferstock zu schaffen machte. Sie trug auch schwer an einem Sack. Es scheint, als seien Kerzenleuchter gestohlen worden.«
»Und dann lief der Dieb schnell weg«, erzählte der kleine Ludwig aufgeregt, der seinen Adoptivvater begleitete.
»Leider konnten wir ihn nicht erkennen«, klagte Buchbinder.
»Aber wir konnten den Wachen beschreiben, dass der Räuber hinkt«, berichtete Ludwig stolz.
»So so, der Hinkebein also«, sprach Josephus Simon. »Wir haben ihn heute schon einmal getroffen – ist vermutlich einer der Beutelschneider. Angerempelt hat er mich. Ich wäre beinahe in die Pader gestürzt. Aber gestohlen hat er mir wohl nichts«, merkte Sertürner an.
»Er lief hinüber in Richtung zu der baufälligen Mühle, Sie wissen schon, die an Simon Fromme verpachtete Walkmühle. Vielleicht hat er ja da sein Schlupfloch«, mutmaßte der Lehrer.
»Wir könnten ja mal vorbeigehen. Möglicherweise lässt sich der Walkmüller auch endlich mal aufstöbern. Wegen des schlechten Zustands seiner Mühle hat man ihm der Bitte entsprochen, dass er nur noch die halbe Pacht zahlen muss. Darüber will ich ihn schon eine Weile informieren, konnte ihn aber nie antreffen. Ich habe mich schon gefragt, wo er sich wohl immer aufhalten mag«, wunderte sich Sertürner zum wiederholten Male. »Wenn natürlich unser Rechtsbrecher ...«
»Ob wir einen Polizisten dazu bewegen sollten, uns zu begleiten?«
»Ich frage mal nach ...«, griff Sertürner die vernünftige Anregung des Lehrers auf.
»Und meine Frau, die Elisabeth, könnte die Jungen mit nach Hause nehmen. Sie macht gerade noch einige Besorgungen auf dem Markt ... Ah, da sehe ich sie! Ich hätte kein gutes Gefühl dabei, wenn Friedrich Wilhelm und Ludwig uns folgten. Wer weiß, auf welch kriminelles Gesindel wir noch stoßen«, sorgte sich Buchbinder.
Behutsam näherten sich die drei Männer der Walkmühle. Aus einem der Kellerräume waren Wortfetzen zu vernehmen. Offensichtlich hatten hier mehrere Personen zu tun. Man fühlte sich scheinbar sehr sicher. Oder war der flüchtige Gehbehinderte gar an einen anderen Ort geflohen, und die drei Verfolger waren auf einer falschen Fährte?
»Wie lange soll der ganze Plunder noch hierbleiben?«, brummte ein Mann mit einer tiefen Stimme.
»Das muss schleunigst verschwinden«, kam eine Antwort. »Dieser Steinmetz ist noch mit den Vermessungen in Rietberg beschäftigt und kann in Kürze hier eintreffen. Auch wenn wir für die Preußen diese krummen Dinger abziehen, muss der Lieutenant davon nichts erfahren. Man weiß nie, wem man trauen kann.«
»Die Stimme kenn ich«, flüsterte Sertürner dem Lehrer ins Ohr.
»Ja, was treibt denn der Franz Altemeier bei den subversiven Elementen?« Beinahe hätte Buchbinder seine Überraschung lauthals kundgetan. Doch rechtzeitig mäßigte er sich: »Wir behüten seine Tochter Agnes – er gaukelt uns den rechtschaffenen Bürger vor. Und nun müssen wir hören, dass er es an Loyalität gegenüber seinem Landesherrn deutlich missen lässt«, stellte Buchbinder entsetzt fest.
»Und der Brummbär ist der Simon Fromme. Sieh mal einer an, wie man sich doch täuschen kann«, staunte Sertürner. »Da will das Hochstift ihm Unterstützung gewähren, und unser Fürstbischof wird von den eigenen Leuten hintergangen.«
»Na ja, wenn da was Politisches im Verzug ist, sollten wir uns vielleicht nicht unbedingt einmischen und unserem Ordnungshüter den Vortritt lassen«, wurde der Lehrer unsicher.
»Ich werde versuchen genauer zu observieren, um was es geht. Bevor ich das Nest aushebe, möchte ich schon gerne wissen, wie viele Personen da beisammen sind«, bestimmte der Polizist. »Aber da Sie die Herren zu kennen scheinen, sollten Sie mitkommen. Vielleicht können Sie mir einen guten Rat geben. Stellen Sie sich darauf ein, dass ich bei Bedarf meine Waffe einsetze«, wurden sie von dem Uniformierten ermahnt.
Als sich Sertürner, der sich hinter einem Berg von Gerümpel verborgen gehalten hatte, etwas vorwagte und einen Blick in einen Kellerraum werfen konnte, erkannte er den versehrten Gauner, der sich über eine Truhe beugte, während Altemeier und Fromme etwas abseits standen und beobachteten, wie der Beutelschneider unzählige Münzen durch seine Hände gleiten ließ. Hinter der Truhe lagen auf einer Kiste Gegenstände aus der Gold- und Silberschmiedekunst: Kerzenleuchter, ein goldener Pokal und mehrere Kelche, ein dickes Buch – vielleicht ein Evangeliar – mit einem edelsteinbesetzten Einband, und auch eine Monstranz war zu erkennen.
»Da ist einiges zusammengekommen, was wir den Pilgern und den französischen Adeligen abspenstig machen konnten«, lächelte der Halunke selbstgefällig.
»Na, und einiges haben Sie auch aus unseren Kirchen und Klöstern entwendet«, beklagte Fromme.
»Sie haben es nicht anders verdient«, sprach Altemeier mit einiger Genugtuung. »Auch wenn diese Schätze dem Hochstift gut zu Gesicht stehen – da Fürstbischof Franz Egon sich immer noch ziert, die Preußen für ihre Dienste zu entschädigen, ist es nur recht und billig, wenn wir da etwas nachhelfen.«
»Welche Dienste leistet Preußen denn für uns, wenn ich fragen darf? Was haben wir denn davon, dass der Preußenkönig aus dem Krieg gegen Frankreich im letzten Jahr ausgestiegen ist?«, fragte Simon Fromme skeptisch und kritisierte fortwährend: »Eher wird sich der dicke Lüderjahn unsere letzten Ersparnisse für seine Affären, allen voran diese Mätresse Wilhelmine, und für seine Verschwendungssucht einverleiben!«
»Na ja, er mag ein Taugenichts und Lebemann sein, der Preußenkönig, aber immerhin hat er uns den Frieden gesichert. Die Franzosen haben die rechtsrheinischen Gebiete geräumt, die wären wir also erst mal los«, meinte Altemeier. »Und der Aufbau der Demarkationslinie und die Sicherung durch Truppenkontingente kostet den Preußen einen Batzen Geld. Wenn unser Stift schon keine Truppen stellt, sollten wir die Preußen wenigstens mit Geldmitteln entschädigen«, verteidigte Altemeier ihr gemeinsames Vorgehen vehement. »Aber Franz Egon schielt immer nur zum Kaiser nach Wien und erhofft sich von dem die Sicherheitsgarantien. Doch der rührt für unsere Belange kaum einen Finger. Die Zeiten ändern sich. Selbst der Maximilian Franz, der Kölner Kurfürst, soll schon im letzten Jahr geäußert haben, dass man in der gegenwärtigen Situation keine andere Wahl habe, als den Preußen schön zu tun. Es pfeifen schon die Spatzen von den Dächern, dass das Reich fast am Ende ist und die Zukunft Preußen gehört. Und dazu werden wir auch bald gehören«, betätigte sich der Amtmann als Visionär.
»Ja, ja, jetzt sind die Franzosen verhasst«, wandte Fromme ein. »Jetzt denkt keiner mehr daran, dass die im Pariser Frieden von 63 die Existenz des Hochstifts erst gesichert haben. Damals wären wir nämlich von Braunschweig-Lüneburg annektiert worden und von der Landkarte längst verschwunden. So ändern sich die Zeiten!«
»Na, na, Fromme, Sie verdienen auch nicht schlecht daran, wenn Sie Ihr Fähnchen nach dem Winde hängen«, widersprach Altemeier.
»Ich weiß, ich weiß. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Ich bin mir wohl bewusst, auf was ich mich eingelassen habe. Aber jetzt sagt mir endlich mal einer, was dieser Steinmetz hier will?«, fragte der Besitzer der Walkmühle.
»Der hat doch nur den Auftrag, für diesen Oberst Le Coq das Stift zu vermessen«, informierte ihn der Amtmann. »Der hat sich in den Kopf gesetzt, für das Gebiet der Demarkationsarmee und die angrenzenden Gebiete verbessertes Kartenmaterial zu erstellen. Und nun schickt er seine Ingenieur-Offiziere los, das Land kartographisch zu erfassen. Die Unsrigen fürchten natürlich, dass hier überall rumgeschnüffelt wird und die Preußen sich Kenntnisse aneignen, die ihnen für diplomatische Verhandlungen oder für Militäraktionen Vorteile bringen.«
»Das tun sie wahrscheinlich auch. Aber das ist mir eigentlich einerlei«, maulte Fromme ziemlich gleichgültig. »Ich will lediglich raus aus der Schusslinie. Wie sind denn nun die weiteren Pläne?«
»Mein Auftrag ist es, unsere Habe nach Minden zu bringen«, meldete sich der namenlose Gesetzesbrecher zu Wort. »Da ist das Hauptquartier der Demarkationstruppen stationiert. Da treffe ich meinen Kontaktmann und übergebe dieses kleine Vermögen. Jetzt warte ich auf einige Begleiter von diesem Offizier Steinmetz. Denn in deren Anwesenheit wird es unterwegs keine Schwierigkeiten für mich geben. Für Morgen ist ein Treffen am Diebesweg, jenseits des Mastbruchs geplant. Und dann könnten wir schon bald verschwunden sein.«
»Das glaube ich kaum!«, rief der Polizist, der mit vorgehaltener Waffe den Kellerraum stürmte. »Jetzt wird Er mir zusammen mit den anderen Herren folgen, auf dass die Gerichte sich mit diesem Verrat beschäftigen!«
Wer nun gedacht hätte, dass sich Hinkebein in sein Schicksal ergeben würde, der irrt. Plötzlich und recht behände sprang der Gauner auf, warf eine Hand voll Münzen dem Ordnungshüter ins Gesicht und versuchte zu fliehen. Aber schon löste sich ein Schuss aus der Waffe des Wachhabenden und streckte den Beutelschneider nieder. Amtmann Altemeier und Walkmüller Fromme ergaben sich widerstandslos. Peinlich berührt war Franz Altemeier, als er bemerkte, dass Josephus Simon Sertürner und Clemens Buchbinder diesen unseligen Zwischenfall verfolgt hatten.
»Ich kann nicht erwarten, dass Sie meine Motive verstehen und gutheißen, Buchbinder«, versuchte Franz Altemeier erst gar nicht um Verständnis zu werben. »Ich möchte Sie und Ihre Frau aber darum bitten, sich auch weiterhin dem Wohl meiner Tochter Agnes zu widmen«, wandte sich der Amtmann verschämt an den sprachlosen Lehrer. Und hoffentlich kommt die Irmtraud ihrer Versicherung zur Verschwiegenheit auch jetzt noch nach, dachte Altemeier. Nicht, dass mir nun zusätzlich noch die Vaterschaft über den kleinen Buchbinder zur Last gelegt wird.
Altemeier und Fromme wurden in Arrest genommen und würden früher oder später frei gelassen werden, denn für ein ordentliches gerichtliches Verfahren mit einer zu erwartenden drastischen Sanktionierung war die politische Situation zu prekär. Spionage war in diesen Zeiten an der Tagesordnung, und man musste mit ihrer Bekämpfung sehr sensibel umgehen. Schließlich wollte man die politischen Gegner nicht unnötig reizen. Denn einem Truppeneinmarsch der Preußen, der Hannoveraner oder der Braunschweiger hatte man im Hochstift Paderborn militärisch nichts entgegenzusetzen.
Für Vater Sertürner war nun aber auch klar, dass er sich die geplante Inspektionsreise mit seinem Sohn an die Grenze zur Grafschaft Rietberg sparen konnte. Denn während er sich als Landvermesser in der Vergangenheit bei der fachlichen Beilegung von Grenzstreitigkeiten zwischen der Grafschaft und dem Fürstbistum Paderborn einen Namen gemacht hatte und immerzu bemüht wurde, wenn es Probleme gab, würde dieser Arbeitsbereich für ihn gewiss bald hinfällig werden. Die preußischen Kartographen würden die Grenzen exakt fixieren. Und es würde ein Leichtes werden, zukünftige Grenzverletzungen hüben wie drüben zu verfolgen.
»Sie wissen, dass ich Ihrem Schwager Franz nach dem Unglück im vergangenen Sommer Obdach gewährt habe?«, stellte sich Irmtraud Grave bei dem Schauspieler Georg Gottfried Bürger vor. »Er bittet Sie, seiner Tochter Elsbeth noch eine Weile die Vorzüge Ihrer familiären Gemeinschaft zuteilwerden zu lassen.«
»Gewiss, gewiss, Madame. Der Lebenswandel ihres Vaters soll nicht der Tochter zum Nachteil gereichen. Wissen Sie schon, wann mit einer Anklage zu rechnen sein wird?«, fragte Georg Bürger.
»Es kann dauern. Wobei es ungewiss ist, ob es zu einer Anklage kommen wird. Ein gemeinsamer Bekannter, der Lehrer Buchbinder, bei dem Elsbeths Zwillingsschwester Agnes derweil lebt, teilte mir mit, dass Franz an einer Verschwörung beteiligt gewesen sein soll. Es bleibt abzuwarten, ob dieses Vergehen publik gemacht wird. Dann muss der Franz mit dem Schlimmsten rechnen. Ich versuche herauszufinden, in welchem Arrestloch man ihn festgesetzt hat. Man wird sehen, ob man mich zu ihm vorlassen wird«, sprach Irmtraud Grave. »Ich werde Ihnen berichten. Vielleicht könnte auch ein Versuch Ihrerseits, als Verwandter meine ich, erfolgreich sein«, versuchte Irmtraud, den Georg Gottfried Bürger dazu zu gewinnen, sich für seinen Schwager einzusetzen.
»Gewiss, gewiss, Madame. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie uns auf dem Laufenden halten«, wiegelte Bürger erst mal ab. »Bitte grüßen Sie ihn von uns!«
Damit war das kurze Gespräch schnell beendet. Als sich die Tür hinter ihr schloss, konnte Irmtraud Grave sich nur darüber wundern, dass dem Franz Altemeier scheinbar nur wenig Mitgefühl seitens seiner Verwandtschaft entgegengebracht wurde.
Irmtraud Grave konnte ja nicht ahnen, dass sie gar ungelegen erschienen war. Denn während seine Frau bei einer Theaterprobe weilte, hatte Georg Bürger Besuch von seiner Schauspielkollegin Elise erhalten.
»Nun komm schon, mein kleiner Dichter.« Elise räkelte sich lasziv auf dem großen Bett. »Bei mir ist’s so gemütlich«, flüsterte sie ihrem Liebhaber ins Ohr, nachdem sich dieser schnell seiner Kleidung entledigt und sich rücklings in die Kissen hatte fallen lassen. »Jetzt ist nicht die Zeit für Grübeleien. Deine Verwandtschaft interessiert dich doch schon lange nicht mehr. Du wurdest belogen, du wurdest betrogen und du fühlst dich jetzt zu deiner Elise hingezogen«, liebkoste Elise ihren Verehrer, während sie ihm den Bart kraulte und sich ihre Münder langsam einander näherten. Seine Lippen berührten leicht ihren halb geöffneten Mund. Und als seine Zunge die Mundwinkel erkundete und sanft weiter vordrang, wurden unendliche Glücksgefühle in ihm wach, wie er sie nur mehr genießen konnte, wenn er sein Täubchen, wie er Elise zu nennen pflegte, in den Armen hielt. Ja, sie war doch noch ein ganz anderes Kaliber als seine Schwägerin Lea.
»Ich wurde belogen, ich wurde betrogen und fühle mich nun zu meinem Täubchen hingezogen«, hauchte er Elise zu. »Wer ist wohl der Dichter von uns beiden?« Zärtlich summte er, als sich die blütenweiße Haut ihrer Brüste rosa färbte und sich ihre elfenbeinfarbenen Beine eng um seine Hüften legten: »Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich! Oh, so ein sanftes Täubchen ist Seligkeit für mich, ist Seligkeit für mich!« – Dann liebten sie sich.
»Ich wünsche mir, dass mein Dichter und Vogelfänger mich bald nach Wien begleitet. Dort finden wir gewiss die Möglichkeit, dass wir Mozarts ZAUBERFLÖTE gemeinsam aufführen. Und du kannst endlich deinen schriftstellerischen Neigungen nachkommen«, redete Elise auf ihren Geliebten ein, als sie einander in den Armen lagen. »Was hält dich hier? Du weißt, dass deine Frau dich belügt und betrügt. Du hast doch den Brief von diesem Keilholz aus Hamburg gelesen ... Wach auf, meins Herzens Schöne, so war doch eindeutig zu lesen. Und wegen deiner Tochter mach dir besser keine Gedanken! Lass dir von deinem Täubchen gesagt sein: Für deine Frau steht gewiss längst fest, dass sie die Sophie mitnimmt. Deine Tochter ist den ersten Schritt ihrer Karriere schon gegangen und wird bald in bekannten Bühnenhäusern auftreten. Da ist kein Platz für dich. Aber hier, hier in meinem Herzen, da ist dein Platz! Wir könnten in wenigen Wochen in Wien sein. Bei meiner Verwandtschaft ist für uns immer eine Tür geöffnet.«
»Wien ist mir etwas sehr nah gelegen beim Kampfgeschehen von diesem Bonaparte, der für die Franzosen einen Sieg nach dem anderen gegen Österreich erringt. Vor wenigen Wochen soll er erst bei der Schlacht an der Brücke von Lodi erfolgreich gewesen sein«, brummte Georg Bürger zweifelnd.
»Aber mein armer Zauderling, Lodi ist in Italien. Da sind wir hier um ein Vielfaches mehr in Gefahr. Denk doch nur an deinen Schwager. Und, wenn du mich fragst, die erfolgreiche Zeit der Gesellschaft Heinzius ist längst vorbei. Hier haben wir keine Zukunft«, gab Elise zu Bedenken.
»Nun gut, nun gut. Du hast gesagt ... hast gesagt, du kannst unsere Reise in aller Heimlichkeit vorbereiten? Das hast du gesagt!«, stotterte Bürger.
»Ja, das habe ich gesagt«, kicherte Elise belustigt. »Du willst deinem Weib deine Entscheidung sicher nicht vis-à-vis mitteilen, oder?«
»Vis-à-vis?«, echote Bürger verschmitzt und ließ dabei seine Augen rollen.
»Na also. Mein süßer Dichter und Komiker hat seinen Humor wiedergefunden. Jetzt wird alles gut«, lachte Elise auf und gab ihrem Buhlen einen nicht enden wollenden Kuss.
Wenige Tage später wurde Bürgers Gattin Wilhelmine bei Irmtraud Grave vorstellig. »Seien Sie gegrüßt, Madame! Erst gestern habe ich erfahren, dass mein Schwager Franz in Arrest genommen worden ist. Können Sie über Neuigkeiten berichten?«, fragte sie, die von ihrer Tochter Sophie und ihrer Nichte Elsbeth begleitet wurde.
»Schön, Sie zu sehen! Treten Sie ein, Madame. – Ja, ich habe erfahren, dass der Franz im Zuchthaus einsitzt, wobei man ihn vergleichsweise schonend behandelt. Er ist ja noch nicht verurteilt. Nicht mal Klage hat man bisher gegen ihn erhoben. Aber aufgrund von Zeugenaussagen wirft man ihm die Beteiligung an politisch motivierter Kriminalität vor. Einige nennen es Spionage, andere Verrat. Das könnte schlimm für ihn enden. Es bleibt zu hoffen, dass er sich durch den zunehmenden Einfluss der Preußen auf den weltlichen Herrschaftsbereich des Hochstifts retten kann. Es scheint, dass sich dieser Lieutenant Steinmetz, der sich bereits zum Kartographieren in Neuhaus einquartiert hat, für den Franz einsetzt und der noch mal seinen Kopf aus der Schlinge ziehen kann«, schluckte Irmtraud hörbar. »Auf jeden Fall wird er seine Stellung im Amt erst mal los sein. Und was wird aus Ihren Nichten, die Elsbeth und die ...«
»Deswegen sind wir hier, Madame Grave«, wurde sie durch Wilhelmine unterbrochen. »Wir können Elsbeth nicht mehr bei uns behalten. Stellen Sie sich nur vor, mein Mann hat uns verlassen. Seine persönliche Habe ist verschwunden. Und ich fürchte, er ist heimlich abgereist, vermutlich nach Österreich. Denn auch eine österreichische Schauspielerkollegin ist seit einigen Tagen nicht mehr bei der Gesellschaft aufgetaucht. Man munkelt, die beiden hatten wohl nicht nur beruflich miteinander zu tun, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Ach?«, fragte Irmtraud Grave erstaunt. »Na, so sind die Männer«, gab sie lapidar zurück. »Meiner ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Gott hab ihn selig. Aber ich bin mir längst nicht mehr sicher, ob er stets treu gewesen ist«, sagte sie zweifelnd und mit etwas verhaltener Stimme, während ihr Blick zu dem Mädchen hinüberglitt.
»Vielleicht ist es besser so«, wirkte Wilhelmine sehr gefasst. »Eigentlich wollten wir unser Engagement bei der Gesellschaft Heinzius ohnehin längst aufgelöst haben. Ich habe eine Einladung nach Hamburg bekommen. Sophie und ich werden bei der Tyllischen Gesellschaft unterkommen, die in der nächsten Zeit Rostock und Stralsund bespielen wird. Und der Sophie wurden schon Auftritte in St. Petersburg und in Reval in Aussicht gestellt. Allerdings können wir Elsbeth leider nicht mitnehmen, daher ...«
»Das sind natürlich Entwicklungen«, wandte sich Irmtraud an Elsbeth. »Wenn du willst, kannst du gerne bei mir und meinem Sohn Ernst bleiben. Wir sind uns schließlich nicht unbekannt. Und deine Zwillingsschwester Agnes wohnt ja auch nicht weit entfernt bei den Buchbinders. Ich hatte deinem Vater Obdach gewährt, nun bleibst du eben bei mir. Wenn du zustimmst, zeige ich dir, wo du dein Gepäck lassen kannst. Ich hätte sogar eine Überraschung für dich«, warf Irmtraud Grave der Elsbeth einen aufmunternden Blick zu.
Während Elsbeth nur stumm dastand und einzig mit einem kurzen Blickkontakt fragend antwortete, erfuhr sie von Irmtraud etwas, das sie in diesen traurigen Augenblicken sehr glücklich stimmte: »Du wirst es nicht erraten, wer vor kurzer Zeit hier aufgetaucht ist«, machte es Irmtraud spannend: »Eure Katze ist hier; die hat euch nicht im Stich gelassen!«
Zwei
Ferdinand und der Schwanewert
Da saßen sie nun bei den Buchbinders zusammen: Irmtraud und Ernst Grave, Agnes und Elsbeth Altemeier. Auch Friedrich Wilhelm Sertürner hatte soeben in Begleitung seiner Mutter und seiner ältesten Schwester Maria Catherina Theresia das Haus betreten und wurde von seinem Freund Ernst begrüßt. Wie in letzter Zeit immer häufiger scharwenzelte zudem der inzwischen siebenjährige Ludwig um die Jungen herum.
Zudem war Kramer Heinrich Hensler mit seinem Fuhrwerk erschienen. Der Kramer hatte eine Genehmigung, in den Heidewäldern von Bentfeld Preiselbeeren zu sammeln. Und dahin wollte er zusammen mit seiner Frau Franziska und den versammelten Damen in Kürze aufbrechen. Tausend fleißge Hände regen, helfen sich im muntern Bund, ging ihm eine Zeile aus dem Glockengießerlied von diesem Dichter Schiller durch den Kopf, wovon er vor wenigen Wochen gehört hatte, als sein Schwager Walther Winkler aus Jena zu Besuch war. – Die zu erwartende üppige Ernte würde er morgen auf dem Markt von Paderborn feilbieten.
»Und die Jungen sind pünktlich zurück!«, ermahnte Elisabeth Buchbinder die Drei: »Denkt dran: Sonst holt euch der Schwanewert! Und beschränkt euren Fisch- und Krebsfang auf den Bereich am unteren Krebs Bach, nur da ist es erlaubt!«
»Wer ist der Schwanewert?«, fragte Ernst.
»Oh, du kennst die Geschichte nicht?«, gab Elisabeth zurück. »Dem Ludwig habe ich sie schon häufiger erzählt. Und der Friedrich Wilhelm kennt sie gewiss auch, oder? Der kann sie euch noch mal darlegen!«
Als Friedrich Wilhelm zustimmend nickte und etwas Verpflegung zusammenpackte, drängelte der Kramer zum Aufbruch. Wenig später hörten die Jungen nur noch, wie sich das Fuhrwerk langsam über die holprige Straße entfernte.
»Die Geschichte vom Schwanewert hat mir der Vater mal erzählt. Es gibt wohl sehr verschiedene Geschichten über ihn, und manchmal heißt er auch Swannewärt«, erinnerte sich Friedrich Wilhelm, als die Jungen auf dem Weg zum Krebs Bach waren, den sie zügig erreichten. Denn der mündete ganz in der Nähe in die Lippe.
»Schwanewert ist ein preußischer Soldatenschreck, der vermutlich aus einem Gasthof Zum Schwanen stammt. Er war ziemlich berüchtigt und rücksichtslos und versuchte, für die Garde der Langen Kerls des preußischen Königs Rekruten anzuwerben. Dabei holte er aber nicht ihre Einwilligung ein, sondern er suchte vielmehr die Burschen teils mit List, teils mit Gewalt in seine Hände zu bringen. Eines Tages soll er versucht haben, auch einen Schäfer zu überreden – ein sehr schlauer Schäfer, der sich wohl dachte, dass der Werber keine Ruhe geben und ihn sicher des Nachts in seinem Schäferkarren überfallen werde. Da bat er einfach die Stallmagd um einen Gefallen. Für einen Taler kletterte sie an seiner statt in den Karren. Gleich in der Nacht schlich Schwanewert zum Schäferkarren, verriegelte ihn und entführte ihn zusammen mit seinen Gesellen. Und als der Karren später geöffnet wurde, kletterte die Magd, dieser seltsame Rekrut, kreischend und schimpfend vom Stroh und enteilte. Diesen schlauen Schäfer hat Schwanewert also wohl nicht in die Hand bekommen. Aber noch so manches Sennebauern groß gewachsenen Sohn hat er in die Potsdamer Montur gebracht. Und dazu soll er viel schlimmere Schandtaten begangen haben. Und es hieß über ihn, dass er seine Seele dem Teufel verschrieben habe. Aber eines Tages wurde er durch eine Kugel des Försters getroffen, als er mal wieder durch den Wald schlich und eine Untat plante.«
»Das war recht so«, kommentierte Ludwig das Geschehen.
»Jedoch, bis heute kann kein Mensch glauben, dass der Bösewicht bei Gott zu Gnaden gekommen ist«, führte Friedrich Wilhelm weiter aus. »Man glaubt, dass er seit jeher in der Gestalt eines großen, schwarzen Hundes mit glühenden Augen umhergeistert. Und die Kinder, die abends nicht zeitig vom Spiel nach Hause finden, gehorchen sofort, wenn die Mutter ruft: Kommt, sonst holt euch der Schwanewert!«
»Na, schaut mal«, flüsterte Ernst, »da vorne ist kein großer schwarzer Hund mit glühenden Augen, da ist ein Mädchen, das Beeren pflückt«, kicherte er.
»Das ist aber sehr ungewöhnlich, wenn sich hier ein Mädchen ohne Begleitung herumtreibt«, gab Friedrich Wilhelm überrascht zurück. »Die macht mich aber neugierig. Wollen wir ihr folgen und sie beobachten?«, fragte er.
»Und sie vielleicht auch ein bisschen erschrecken?«, dachte Ludwig über einen kleinen Schabernack nach.
»Kannst ja sagen, du wärst der Schwanewert«, lachte Ernst.
»Und dann frage ich sie, ob sie zu des Königs Soldaten möchte«, unkte Friedrich Wilhelm.
»Das könnte sie aber missverstehen«, erwiderte Ernst verschmitzt.
»Vielleicht möchte sie ja auch mit uns Krebse fangen«, warf Ludwig belustigt ein.
»Oder wir laden sie – im Auftrag des Fürstbischofs – zur Preiselbeerernte ein«, alberte Ernst, während alle gleichzeitig laut losprusteten und sich ihr Gelächter zu einem Gackern und Wiehern entwickelte.
Erschrocken drehte sich das Mädchen um, blickte auf, war sich zunächst unschlüssig, ob es nicht besser sei, schleunigst zu verschwinden und entschied sich dann doch, direkt auf die drei Freunde zuzugehen.
Nun waren aber die Jungen irritiert. Wie versteinert standen sie plötzlich da, schauten einander an, blickten dann hinüber zu dem Mädchen, das sich ihnen – eher unbeholfen, plump und wenig grazil – näherte. Zwar schwieg es, aber von Schüchternheit konnte keine Rede sein. Als es sich bis auf wenige Armlängen genähert hatte, bückte es sich und schrieb etwas in den Sand. HELFT MIR, war zu lesen, als sich die Jungen über das Geschriebene beugten. BIN HUNGRIG UND DURSTIG, stand da in großen Buchstaben geschrieben. Natürlich holten die Jungen schnell ihre Verpflegungspakete und ihre Wasserflaschen hervor und mussten miterleben, wie das Mädchen das Dargebotene an sich riss und hastig verschlang. Und als es nach etlichen kräftigen Schlucken aus der Wasserflasche laut vernehmlich rülpste, waren die Jungen mit ihrer Zurückhaltung am Ende. Sie redeten durcheinander und eine Kaskade von Fragen prasselte auf das Mädchen nieder. Aber das Mädchen blieb stumm. Es blieb auch stumm, als Friedrich Wilhelm anbot, es könne die Jungen nach Hause begleiten, wenn es denn wolle.
»Vielleicht ist der Vater schon daheim«, sagte Friedrich Wilhelm. »Die anderen werden noch unterwegs sein.«
»Er hat gar nichts von sich erzählt«, berichtete Friedrich Wilhelm seinem Vater, als das vermeintliche Mädchen seine Verkleidung abgelegt hatte. Der ungefähr dreizehn-, vierzehnjährige Junge hatte ein Bad genommen. Beim Essen hatte er anschließend kräftig zugelangt. Ängstlich schien er nicht, auch wenn gelegentlich ein nervöses Zucken eines Gesichtsmuskels auftrat. Gerne hatte er auch davon Gebrauch gemacht, als man ihm einen Schlafplatz zugewiesen hatte. Aber er blieb schweigsam. Seinen Namen gab er nicht preis; vielleicht kannte er den ja selbst nicht. Keiner wusste, woher er stammte. Nur einmal hatte er zustimmend genickt, als man ihn auf seine Mädchenkleidung angesprochen hatte. Da hatte man sich zusammenreimen können, dass er wohl schon eine Weile unterwegs gewesen sein musste und sich irgendwo die Kleidung angeeignet hatte. Er war offensichtlich auf der Flucht, aber vor wem?
»Meister Sertürner, Sie haben nach mir geschickt? – Friedrich Wilhelm hat mir schon einiges über Ihren Gast berichtet«, sagte Clemens Buchbinder. »Aber ich kann mir dieses Verhalten kaum erklären.«
»Schön, dass Sie gekommen sind, Lehrer Buchbinder«, begrüßte Sertürner ihn. »Es ist schon sehr merkwürdig: Er redet nicht, aber er scheint uns zu verstehen. Er ist nicht aggressiv und auch nicht übermäßig ängstlich. Er war sehr hungrig und durstig, und jetzt ist er sehr müde. Wird wohl eine Weile unterwegs gewesen sein. Spricht einiges dafür, dass er etwas Schreckliches erlebt haben mag. Andererseits: Dann würde er sich vielleicht eher teilnahmslos und träge zeigen. Vor allem wäre mit mehr Argwohn, Furcht oder Verschüchterung zu rechnen, denke ich. Was meinen Sie, ob wir einen Mediziner zu Rate ziehen sollten?«
»Hm, ich habe mal von dem Wilden Peter gehört. Das war ein Junge, auch so im Alter von dreizehn Jahren. Der wurde auf einer Wiese vor der Stadt Hameln gefunden. Er wurde nach seiner Entdeckung in die Stadt gebracht, wo er großes öffentliches Interesse erregte. Allerdings war er auch wohl sehr auffällig. Denn die Bewohner beschrieben ihn als ein schwarzbehaartes Geschöpf mit bräunlicher Haut. Sein Verhalten glich dem eines wilden Tieres. Und er ernährte sich vorwiegend von Vögeln und rohem Gemüse. Er schien auch hinsichtlich seiner Intelligenz nicht ganz gesund. Er erlernte nie das Sprechen, er lachte nie und zeigte sich wohl sehr gleichgültig. Nur die Musik, die interessierte ihn sehr. Er muss vor einigen Jahren gestorben sein, irgendwo in England. Einige waren der Meinung, dass es sich um ein Wolfskind handelte. Andere glaubten, dass er nur das Opfer einer Prügelei geworden war. Das könnte bei Ihrem Hilfesuchenden wohl auch möglich sein. Aber alles andere hat er sicher nicht mit dem Wilden Peter gemein.«
»Wir sollten ihn eine Weile beobachten, bevor wir den Arzt um Rat fragen«, schaltete Friedrich Wilhelm sich in die Überlegungen ein. »Vielleicht kommt seine Sprache bald wieder. Er hat sich uns anvertraut. Darum sollten wir ihn nicht wegschicken.«
»Ich will wohl mit der Elisabeth sprechen, ob sie noch Platz an unserem Tisch für einen zusätzlich Hungrigen hat«, antwortete Clemens Buchbinder. Dann könnte er bei uns wohnen, wenn er will. Warum sollten wir nicht auch ihm Logis gewähren? Wir werden dann bald eine Großfamilie sein. Aber ich denke, wir könnten ihn schon auch noch durchfüttern.« Seitdem unser Fürstbischof die Normalschule eingerichtet hat, wo auch wir Landschullehrer uns fortbilden können, gibt’s einen Unterhaltszuschuss aus der Landeskasse, dachte der Lehrer bei sich. So könnte es gehen. »Vielleicht können wir mit Hilfe von Ernst, Friedrich Wilhelm und Ludwig mit der Zeit erfahren, wie er heißt und woher er kommt«, sprach der Lehrer seine Überlegungen aus.
»Wenn die Frauen und Mädchen von ihrer Preiselbeeren-Ernte zurückkommen, werden sie sich wundern, was wir heute erlebt haben«, sagte Friedrich Wilhelm in die Runde. Denn auch die anderen beiden Jungen waren noch zugegen und freuten sich, dass ihr neuer noch namenloser Bekannter erst mal bei ihnen bliebe.
Zu Viert waren sie nun meistens unterwegs: Friedrich Wilhelm und seine beiden Freunde, die ihrem neuen Bekannten alles erklärten, was sie für interessant und zeigenswert hielten. Auch wenn er selbst nie redete – sie konnten sich gut mit ihm verständigen. Allerdings durften sie ihn nicht nach seiner Vergangenheit fragen. Dann wurde er ablehnend und versank in seine eigene Gedankenwelt, in die er sie nicht eindringen ließ.
Es war an einem regnerischen Tag, als sie sich auf dem Gelände von Schloss Neuhaus aufhielten, dort, wo auch der Kartograph von Steinmetz derzeit einquartiert war. Dieser nahm heute keine Messungen vor Ort vor. Stattdessen empfing er eine Reihe anderer Lieutenants, um die in den letzten Tagen erhobenen Daten zusammenzutragen. Gerade sahen die Jungen, wie einige Reiter ihre Pferde in den Hof des Marstalls führten und sich anmeldeten. »Lieutenant von Lindenbach meldet sich zum Rapport gemeinsam mit von Klarholz, von Rehberger und von Molle«, stellte dieser die Kollegen vor.
Dann folgte ein Augenblick, der sehr bedeutsam werden sollte: Als einer der Begleiter des Letztgenannten ins Blickfeld der Jungen gelangte, erschrak ihr neuer Freund heftig und zog sich schnell hinter einen Mauervorsprung zurück.
»Den da, mit der langen Narbe im Gesicht, den kenne ich!«, sagte er zur Überraschung der anderen. »Lasst uns schnell verschwinden!«
Seine Stimme bebte. Das Zucken unter seinem rechten Auge geriet jetzt ungewöhnlich heftig. Sein blasses Gesicht zeigte Abscheu, als er noch einmal zu dem Fremden hinüberschaute, dessen schreckliche Brandnarben das Gesicht entstellten. Eine wulstige Narbe zog sich vom Kinn über die rechte Wange bis zur Augenbraue. Die Partie bis zum Ohr wies eine gespannte glatte Haut auf, deren Färbung sich von der anderen Gesichtshälfte deutlich unterschied. Mit der scharlachroten Wange kontrastierten einzelne helle Hautflecken. Die deformierte Nase und sein dichtes, schwarzes zerzaustes Haar unterstrich die teils verwegene teils brutal wirkende Erscheinung des Mannes.
Sie kehrten in die Unterkunft der Graves zurück, wo Friedrich Wilhelm freudig aussprach, was alle dachten: »Was ist los? Du hast deine Sprache wiedergefunden! Was ist passiert?«
Erst jetzt wurde dem bisherigen Schweiger bewusst, dass sich etwas Entscheidendes ereignet hatte und verlegen stotterte er:
»Ich, ich kenne ihn. Er ist ein schrecklicher, ganz schrecklicher Mensch!«
»Was ist passiert? Wer bist du? Woher kommst du?«, unterbrach ihn Ludwig erregt.
Da begann er zögernd über seine Erinnerungen zu sprechen: »Er ... Ich ... Oh, nie werde ich diesen Anblick vergessen, niemals! ... Man nannte mich Ferdinand ... Ferdinand Heller.«
Er barg seinen Kopf in beiden Händen. Dann blickte er auf: »Ich, ich war wohl eine Weile unterwegs, bis ich euch traf ... Komme aus Rietberg, aus der Grafschaft ... Aber ich war in dieser Bauernschaft ... Bauernschaft Mastholte und musste da bei dem Bauern arbeiten, dem Bauern Block, ein Onkel meiner Mutter.«
Nun schüttelte er seinen Kopf. »Ich weiß nicht mehr genau, was damals alles geschehen ist, es war entsetzlich«, verlor er sich in Gedanken. Noch einmal zuckte es kräftig in seinem Gesicht. Dann ebbte diese Regung merklich ab. Sie sollte später nur noch einmal auftreten. Mehr und mehr Einzelheiten kamen ihm wieder ins Bewusstsein, und es brach aus ihm heraus, etwas durcheinander, aber seine Freunde hörten ihm geduldig zu.
Seine Eltern hatte er lange nicht mehr gesehen. Und er fragte sich mit einer gehörigen Portion Traurigkeit in der Stimme, ob er sie jemals wiedersehen würde. – Er berichtete, dass sein Vater in jungen Jahren ohne Zunftordnung als Nachfolger für das väterliche Malerhandwerk auserkoren worden sei. Er sei aber nicht Geselle geworden, sondern habe die Alternative gewählt, die Wanderschaft. In Antwerpen sei er bei einem Gildemeister in die Lehre gegangen. Dort habe er seine spätere Frau Hildegard Block kennengelernt.
»1782 bin ich geboren worden.« Ferdinand legte jetzt eine kurze Pause ein. »Dann ist Vater dem österreichischen Militär beigetreten und unter dem General ... General von Kaunitz-Rietberg – ja so hieß der General wohl, wenn ich mich recht erinnere. Unter diesem General hat Vater an der Schlacht von Charleroi teilgenommen ... Ich meine, irgendwann im Jahre 94.«
Dies musste für den Vater ein schreckliches Erlebnis gewesen sein, so berichtete Ferdinand, denn noch vor den nächsten Kämpfen sei er desertiert. Er sei wieder aufgegriffen worden und wäre beinahe zum Tode verurteilt worden. »Man gewährte ihm aber das Leben. Er musste jedoch zum Spießrutenlauf durch die Gasse gehen, was ... Was ich ... Was auch ich mit ansehen musste.« Eine Träne lief Ferdinand über die Wange. Dann sprach er wieder gefasst: »Zudem sollte ich im Alter von vierzehn Jahren ebenfalls dem Militär beitreten. Dies wusste jedoch die Mutter zu verhindern.«
Über Freunde, die entfernt Bekanntschaft pflegten mit einem Bruder des Generals, einem Grafen von Rietberg, hatte die Mutter ihren Ferdinand zu ihrem Onkel, dem Bauern Maximilian Block nach Mastholte bringen lassen. Der habe eine Arbeitskraft zwar gut gebrauchen können, sei aber nicht besonders glücklich darüber gewesen, dass er nun seinen Großneffen durchfüttern sollte, stellte Ferdinand betrübt fest.
»Gewiss, wegen der für die Landwirtschaft schlechten Böden inmitten vom Sumpfgelände, zählte mein Großonkel zu den armen Bauern, aber das gab ihm doch lange nicht das Recht ...« Wieder musste Ferdinand kräftig schlucken, bevor er darstellte, dass Bauer Block ihm gegenüber häufig sehr unleidlich geworden sei. Als einmal die Kornrechnung zu bezahlen war, habe der jähzornige Mann seine Wut an Ferdinand ausgelassen. Und dann, es war im Juli, sei es zum Allerschlimmsten gekommen, was Ferdinand bisher erleben musste:
»In Mastholte sollte der Jakobimarkt stattfinden. Wir freuten uns sehr auf diesen alljährlich stattfindenden Pferde- und Krammarkt«, erzählte Ferdinand. »In selbstgebauten Wohnwagen erschien am Tage vor Jakobi das fahrende Volk. Die schwarzen Kastenwagen der Zigeuner waren behangen mit Körben, Kannen, Pfannen und anderen Geräten, die im Haushalt gebraucht werden konnten. Unter dem Wagen hing der Geflügelkasten, aufgehängt an vier Ketten. Darin gackerten Hühner und schnatterten Gänse. An den Seiten sprangen Hunde herum. Kleinwüchsige Pferde zogen diese Fracht die holprige Dorfstraße hinunter. Auf dem Bock saß, die Peitsche schwingend, das Oberhaupt der Sippe. Am hinteren Ende trotteten Ponys und auch ausgewachsene Pferde, die auf dem Markt gehandelt werden sollten. Am Abend wurde ein Lagerfeuer entzündet, Musik spielte auf, es wurde getanzt und gesungen. Auch ich war mit einigen Knechten zu diesen lustigen Darbietungen gegangen. Während die Knechte Ausschau nach ihren Mädchen hielten, bewegte ich mich etwas abseits – das war mein Fehler.«
»Was ist geschehen?«, fragte Ernst.
Ferdinand zögerte mit einer Antwort: »Nun ... Ich ... Ich wurde von hinten gegriffen. Man hielt mir den Mund zu, fesselte mich und stopfte mir etwas in den Mund, sodass ich nicht schreien konnte. Und dann sah ich ihn – den, den ich vorhin wiedererkannt habe«, berichtete Ferdinand mit einem verzweifelten Blick und war sich nicht sicher, ob er wirklich weitersprechen wollte. »Er ... Er riss mir die Hose herunter ...« Ferdinand schluckte kräftig. »Er nahm mir nicht nur die Kleidung, sondern entblößte selbst sein Geschlecht ..., stieß mich brutal, sodass ich bäuchlings über einen Baumstamm zu liegen kam und ... Er tat mir Gewalt an.«
Die Freunde trauten ihren Ohren kaum, während Ferdinand sein Martyrium schilderte. Immer wieder unterbrach er seine Ausführungen. Er schämte sich sehr.
»Währenddessen ... Währenddessen drohte er mir ein schreckliches Ende an, wenn ich je mit jemandem darüber spräche ... Ich habe kaum mehr wahrgenommen, was später geschehen ist. Irgendjemand muss mich gefunden haben, der mich von meinen Fesseln befreite. Ich glaube, es war einer dieser Zigeuner. In Erinnerung ist mir geblieben, dass ich später von meinem Großonkel angebrüllt wurde, weil ich ihm nicht antworten konnte. Ich bekam einfach kein Wort mehr heraus ... Und irgendwann ... Irgendwann bin ich einfach fortgelaufen. Weggelaufen. Planlos. Bin anderen Menschen ausgewichen, bis ich irgendwo in ein Haus eingebrochen bin. Da habe ich die Kleider gefunden und bin wieder geflohen ... Habe mich von Beeren ernährt ... Und dann habt ihr mich gefunden.« Ferdinand blickte zu Boden.
Schockiert und sprachlos wandten auch die Freunde ihre Blicke voneinander ab. Und erst nach einer Weile stellte Friedrich Wilhelm fest: »Wir sollten es den Eltern berichten, wenn es dir recht ist. Nur so können wir dir wirklich helfen. Außerdem ist es im Moment das Wichtigste, dass du diesem Kerl nicht noch einmal über den Weg läufst, denke ich. Wir müssen gemeinsam überlegen, wie wir dich verstecken und schützen können.«
Ferdinand stimmte diesem Vorhaben zu. Und so kam es, dass des einen Leid den anderen Freude bescherte. Denn Friedrich Wilhelm, Ernst und Ludwig hatten einen neuen Freund gewonnen.
Drei
Traditionen:
Libori und Bleiläuse am blauen Montag
Es war am Montag, zu Beginn der Fastenzeit des Jahres 1797: Der blaue Montag wurde Jahrhunderte lang von den Setzern und Druckern genutzt, um sich einmal in geselliger Runde zu vergnügen, statt zu arbeiten. Im Fürstbistum Paderborn galt er zwar schon vor etlichen Jahren als abgeschafft, dennoch wurde er in der Hofbuchdruckerei heimlich begangen.
Packt an Gesellen,
lasst seinen Corpus Posterium fallen
auf diesen nassen Schwamm,
biß trieffend beide Ballen.
Der durst'gen Seele
gebt ein Sturtzbad obendrauff,
das ist dem Sohne Gutenbergs
die allerbeste Tauff.
So sprachen die Gesellen beim Gautschen, dem alten Zunftbrauch, bei dem aus den ausgelernten Lehrbuben brauchbare Gehilfen gemacht wurden. Bei der Gautsch-Zeremonie wurde der Kandidat auf einen nassen Schwamm gesetzt und außerdem in einen mit Wasser gefüllten Trog getaucht. Und so wurde er von den in der Lehrzeit begangenen Fehlern befreit. Heute bestand zudem die Gelegenheit, den Neuling Ernst Grave, der in diesen Tagen seine Lehre begonnen hatte, mit den Bleiläusen vertraut zu machen.
Adalbert Schmidt, der sich im Verlaufe der letzten Monate einen guten Stand beim Vorgesetzten und den Kollegen in der Setzerei erworben hatte, ließ sich diese Gelegenheit zu einem traditionellen Streich nicht nehmen: Dazu goss er auf einem Setzschiff, auf dem der Setzer üblicherweise den Satz aus dem Winkelhaken ablegte, Wasser aus. Nun warteten alle – und insbesondere Ernst Grave – darauf, dass dort Bleiläuse erschienen. Nach wenigen Augenblicken waren sie angeblich für alle sichtbar, nur nicht für Ernst. Adalbert hielt ihn dazu an, ganz genau hinzusehen. Und als dieser sich mit dem Gesicht immer mehr dem Schiff näherte, schob Adalbert die Stege zusammen, worauf das Wasser dem Opfer ins Gesicht spritzte. Nun war also auch Ernst Grave die erste Taufe in seinem Arbeitsleben zuteil geworden.
»Na, Ernst, jetzt gehörst auch du dazu. Brauchst mich nun auch nicht mehr so förmlich anzureden. Ich bin der Adalbert. – Wie waren denn die ersten Arbeitstage?«
»Abwechslungsreich, aber auch lang«, antwortete Ernst. »Zwölf bis vierzehn Stunden Arbeit am Tag sind doch noch etwas ungewohnt.«
»Das stimmt, aber da gewöhnst du dich dran. Ich werde dir dabei helfen«, lachte Adalbert und klopfte seinem Lehrling aufmunternd auf die Schulter.
»Aber sag einmal, du wohnst doch in Neuhaus. Kennst du da zufällig eine Johanna Grünberg?«, fragte Adalbert neugierig.
Ernst zuckte zusammen. »Hm ... tja.« Er schien zu überlegen. Dabei zauderte er, weil er unsicher wurde, befangen und argwöhnisch. Vielleicht war es riskant, Auskunft zu geben. Es blieben ihm nur Augenblicke und er entschied sich, dem Problem aus dem Wege zu gehen: »Den Namen habe ich schon mal gehört, aber ... Sie ... ähm ... du kannst ja morgen mal die Mutter fragen, die kommt um die Mittagszeit zum Saubermachen.«
»Ach so, sie ist deine Mutter, die hier die Lettern aufräumt?«, fragte Adalbert zurück. »Danke für den Rat! Ich werde sie morgen fragen. Hoffentlich kann sie mir weiterhelfen. Ich suche nämlich meine Schwester«, ergänzte Adalbert Schmidt.
Monate später: Die Gelegenheit könnte besser nicht sein, dachte Irmtraud Grave, als sie im Juli durch das Neuhäuser Tor schritt. Wie zahlreiche andere Bürger aus Neuhaus und dem Umland, die heute schon am frühen Morgen Einlass begehrten, hatte sie eine ganze Weile warten müssen, bis das Stadttor pünktlich geöffnet wurde. Mit einem Sack bepackt war sie durch die mit Fahnen und Blumen geschmückten Straßen von Neuhaus geschritten, hatte sich über die Blaue Brücke, den Fürstenweg, der Stadt Paderborn genähert und war nun endlich gemeinsam mit dem anderen Fußvolk auf dem Weg zum Markt- und Domplatz. Aus allen Richtungen strömten die Menschen ins Herz der Stadt, aus südwestlicher Richtung durch das Westerntor, durch das Kasseler Tor im Süden, durch das Gierstor im Osten in der Nähe der Busdorfkirche und durch das Heierstor im Norden, das man von Auswärts über die Detmolder Straße erreichte.
Welch eine glückliche Fügung, glaubte Irmtraud, als sie an der Ostseite der Pfalzkapelle angelangt war und an dem Halbrund der Apsis dieser dem Heiligen Bartholomäus geweihten Kapelle ihren Sack ablegte. Zuvor hatte sie sich davon überzeugt, dass sie nicht beobachtet wurde.
Sie ließ sich an der Mauer nieder und würde eine Zeitlang hier verharren müssen, bis Franz Altemeier nach hoffentlich geglückter Flucht den Sack mit seiner Kleidung und etwas Proviant entgegennähme. Im Durcheinander der Menschenmenge, die sich heute in Paderborn zum Libori-Fest sammelte, würde sein Verschwinden kaum auffallen. Dass Agnes und Elsbeth ausgerechnet gestern dieses Schaf retten mussten, brachte sich Irmtraud in Erinnerung, das macht das heutige Vorhaben um vieles leichter, hoffte sie.
Agnes und Elsbeth waren am Vortag – wie so oft in den zurückliegenden Monaten – als Helferinnen auf dem fürstbischöflichen Gut Nachtigall tätig gewesen und hatten dem Pferdeknecht, der in der Nähe der Lippe-Aue zu tun hatte, eine Stärkung gebracht. Der Knecht gab ihnen für den Rückweg ein kleines Fuhrwerk mit, das von einem Pony gezogen wurde. Auf dem Karren befanden sich Seile, Holzpflöcke und Werkzeug. Und während die Mädchen Pony und Karren laut scherzend zu Fuß begleiteten, bemerkten sie eher zufällig, dass das Pony etwas unruhig wurde und die Ohren spitzte. Irgendwann hörten auch sie das Blöken eines Schafes. Das war sehr ungewöhnlich, denn weit und breit war keine Herde zu sehen. Immer lauter vernehmbar wurde das jammernde Klagen des Schafes, das sie schließlich in einer Erdsenke fanden. An den mannshohen sandigen Wänden rutschte es immer wieder ab und konnte daher aus eigener Kraft nicht emporklettern. Elsbeth ließ sich kurz entschlossen selbst in die Tiefe gleiten, griff sich das noch recht junge Schaf und ließ sich an einem Seil, das Agnes an den Karren gebunden hatte, durch das Pony hinaufziehen. Groß war die Freude, als sie den Gutshof wieder erreicht hatten. Und vom Verwalter hatten beide Mädchen ein Säcklein mit Schillingen und Pfennigen erhalten – eine beachtliche Belohnung, denn sogar ein Reichstaler war dabei – , für die sie sich heute beim Libori-Volksfest etwas Schönes erstehen wollten.
Die Buchbinders hatten sich bereiterklärt, die Mädchen und auch Ludwig und Ernst nach Paderborn zu begleiten, während Ferdinand, der nun schon etliche Monate als Gehilfe des fürstbischöflichen Hofgärtners arbeitete, auch an diesem Festtag in der Gartenanlage von Schloss Neuhaus zu tun hatte. So konnte Irmtraud Grave ungestört ihren Plan umsetzen, den sie mit Franz Altemeier ersonnen hatte. Dem Franz hatte es im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich gestunken, dass ihm in den letzten Monaten im Zuchthaus die Aufgabe zukam, die Latrinen auszuheben und zu reinigen. Und da ihn seine ungewisse Zukunft inzwischen sehr zermürbte, hatte er sich zur Flucht entschlossen. Am Libori-Festtag sollte es sein; die Gelegenheit schien günstig.
»Warum werden Pfauenwedel der Prozession vorangetragen?«, richtete Agnes ihre Frage an Lehrer Buchbinder, als sie zusammen mit ihrer Schwester Elsbeth, zusammen mit Ernst und mit Ludwig sowie seiner Adoptivmutter Elisabeth den kirchlichen Umzug zum Fest des Paderborner Schutzpatrons begleiteten.
»Das hängt mit einer Legende zusammen, die man sich seit langer Zeit in Paderborn erzählt«, antwortete Clemens Buchbinder. Damals, vor vielen hundert Jahren, wollte man in Paderborn einen Heiligen haben. Der Paderborner Bischof Badurad bemühte sich bei Bischof Aldrich aus dem französischen Le Mans um die Gebeine eines heiligen Fürsprechers. Dieser schenkte dem Paderborner Bischof die Gebeine des Heiligen Liborius. Eine Delegation holte im Jahre 836 die kostbare Gabe ab und begründete einen Freundschaftsbund zwischen der fränkischen und der noch sehr jungen sächsischen Kirche. Zum Abschied überreichte ihnen Bischof Aldrich Pfauenwedel, die bei feierlichen Gottesdiensten in Le Mans verwendet wurden. Der Pfauenwedel ist ein Zeichen der Unsterblichkeit. Er möge euch auf dem Rückweg begleiten und als ein Symbol ewiger Freundschaft zwischen den Völkern der Franken und Sachsen gelten, wünschte der Bischof damals. Im Laufe der Zeit entstand aus diesem Pfauenwedel die Legende vom Pfau, der den Pilgern voranflog. So oft die Pilger auf ihrer Reise anhielten, flog der Vogel zur Erde nieder und ruhte sich auch aus. Wenn sie aufbrachen, flog er ihnen wieder voraus. Als die Paderborner endlich ihre Stadt erreichten, hielt der Pfau solange im Flug inne, bis der feierliche Einzug in den Dom begann. Dann erhob er sich zu seinem letzten Flug. Auf der Spitze des Domes setzte er sich schließlich nieder. Als die Reliquienträger und die singenden Christen den Dom betraten, fiel er tot zur Erde. Zum Andenken an ihn wird noch heute dem Liborischrein ein Pfauenwedel voran getragen«, erklärte der Lehrer.
»Und der Schrein ist aus purem Gold?«, fragte Ludwig interessiert.
»Dies ist nicht mehr der ursprüngliche Schrein«, erklärte Buchbinder. »Während des Dreißigjährigen Krieges raubten Landesknechte des Herzogs Christian von Braunschweig den Paderborner Domschatz und den Schrein mit den Gebeinen des Heiligen Liborius. Der protestantische Feldherr ließ den Schrein einschmelzen und daraus Münzen prägen. Der nun geschaffene sogenannte Pfaffenfeindtaler trug die Aufschrift: Gottes Freundt, der Pfaffen Feindt. – Fünf Jahre später kehrten die Reliquien gegen Zahlung einer hohen Rückgabesumme wieder nach Paderborn zurück. Vor weit über einhundertfünfzig Jahren wurde dann ein neuer, prachtvoll vergoldeter Silberschrein für die Reliquien des Heiligen Liborius geschaffen.«
Im Sog der Menschenmassen zogen sie mit der Prozession durch die Stadt und waren soeben auf dem Rückweg vom Rathausplatz zum Markt, als Ernst am Eingang der Gaukirche einen Mann bemerkte.
»Du glaubst es nicht, wen ich gerade entdeckt habe«, flüsterte Ernst seinem Freund Ludwig ins Ohr. »Es ist dieser schreckliche Mensch mit der Narbe, du weißt schon, der den Ferdinand damals so gequält hat«, sprach Ernst, während er sich mit Grauen erinnerte.
»Ich kann nichts sehen«, sprach Ludwig nun deutlich vernehmbar. »Ich bin zu klein und kann nicht über die Köpfe der Menschen hinwegsehen«, beklagte er sich. »Vater, dort drüben, an der Gaukirche ist dieser Mann mit der Narbe«, sagte er in einer Lautstärke, dass auch die Mädchen ihn verstehen konnten.
»Und ich sehe ... «, rief Elsbeth ihrer Schwester zu, »da, in der Montur eines Holzfällers ... Das ist doch ... Ja, es ist Vater! Kommt, wir müssen ihm folgen!«
Agnes sah ihren Vater nicht. Sie wollte ihn auch gar nicht erkennen. Sie starrte die Wasserspeier am Dach der Kirche an. Dieser Anblick war schrecklich genug. Eine der verzerrten Grimassen ähnelte dem Gesicht ihres Vaters. Agnes hatte den Eindruck, dass sie mit der fürchterlichen Fratze bedacht wurde. Der Brand ihres Elternhauses drang wieder in ihr Bewusstsein. Sie glaubte die gewaltige Rauchsäule zu sehen, die die Flammen zu ersticken schien. Ängstlich drückte sich Agnes an die Seite von Elisabeth Buchbinder. Hier fand sie Halt; ein wenig Kraft, um sich gegen das Gefühl der Ohnmacht zu wehren, die sie immer dann beschlich, wenn sie ihren Vater in der Nähe wähnte.
Elsbeth hingegen wirkte unbekümmerter. Schon brach sie aus der geordneten Reihe der Prozession aus und kämpfte sich durch das Gewühl der Menschenmenge. Ihren Vater hatte sie kurzzeitig aus dem Blick verloren. An der Gaukirche vorbei rannte sie durch die Giersstraße. Dort entdeckte sie ihn wieder, als er zusammen mit einem anderen Mann schnellen Schrittes links hinter dem Dom und den angrenzenden Gebäuden abbog. Wieder war er verschwunden. Elsbeth mühte sich über einen Platz, auf dem sie – durch zahlreiche Fuhrwerke und eine größere Ansammlung von Pferden behindert – kaum vorankam. Aber sie sah, dass sich die Männer hinüber zur Kaiserpfalz begaben. Sie rief ihrem Vater etwas hinterher. Er schien sie aber über diese Entfernung hinweg kaum hören zu können, oder doch? Kurz drehte er sich um, hielt einen Augenblick inne, während er mit dem anderen Mann sprach, lief einige Schritte zurück, um sich dann um so zügiger wieder abzuwenden. Schließlich eilte er davon, als er sah, dass eine Polizeiwache auf das Mädchen aufmerksam geworden war. Jetzt geschah alles sehr schnell. Noch während der Polizist auf das Mädchen einredete und seinen Unmut darüber kundtat, dass sie so ohne jegliche Begleitung durch die Paderborner Straßen irrte, sah sie aus der Ferne, wie ihr Vater in Begleitung von nunmehr zwei Männern auf Pferden in Richtung des Heierstores davonpreschte. Der zweite Mann trug die Kluft eines Zuchtmeisters. Enttäuscht ließ sich Elsbeth von dem Polizisten zum Eingang des Domes führen, wo sie hoffte, die anderen im Strom der Prozession wiederzutreffen. Und da hatte sie wohl richtig vermutet – allein, Clemens Buchbinder war nicht bei den anderen. Der hatte vergeblich versucht, Elsbeth bei ihrem unüberlegten Verschwinden zu folgen. Dieses Ziel hatte er verfehlt. Und dennoch war er nicht ergebnislos geblieben. Denn zur großen Überraschung hatte er Irmtraud Grave entdeckt, die soeben aus der Pfalzkapelle herausgetreten war.
»Ich habe Elsbeth in Begleitung eines Polizisten zum Domeingang gehen sehen«, sagte sie und raunte ihm in wenigen Worten zu, dass sie sich an der Flucht von Altemeier beteiligt habe.
Sie hatte schon vor Tagen einen Zuchtmeister bestochen, der seine Kollegen ruhigstellte, indem er ihnen Gelegenheit gab, ihrer Trunksucht zu frönen. Dann erklärte sie, dass es, wie in jedem Jahr üblich, einigen Gefangenen erlaubt gewesen sei, zum Libori-Fest am Gottesdienst teilzunehmen. Und diese Gelegenheit zur Flucht habe Franz sich nicht entgehen lassen können.
»Die beiden anderen Männer begleiten ihn jetzt nach Minden«, bemerkte Irmtraud knapp.
Vier
Geld macht nicht glücklich
Spätsommer. Blumen legte er am Grab von Johanna nieder. Clemens Buchbinder und seine Frau Elisabeth hatten ihn hierhin begleitet. Endlich hatte er die Hintergründe über den Tod seiner Halbschwester erfahren. Die Mutter seines Lehrlings Ernst hatte ihm berichtet, dass Johanna bei der Geburt ihres Sohnes Ludwig zu Tode gekommen war. Viele Jahre waren seither vergangen und fast war es ihm wie in einem anderen Leben, als sie sich zum letzten Male gesehen hatten. Natürlich hatte er sehr darauf gehofft, sie glücklich und lebend wiederzusehen. Es sollte nicht sein. Überrascht stellte er fest, dass er kaum zu trauern vermochte. Vielmehr verspürte er einerseits etwas Resignation und andererseits Wut darüber, dass es so weit gekommen war. Das ist das Schicksal, würde mancher sagen. Aber so dachte er nicht. Dass ihr Lebensweg so vorgezeichnet gewesen sein sollte, dass konnte er nicht glauben. Vielmehr neigte er dazu, das Verhalten Einzelner als persönliches Versagen zu verurteilen: das Versagen von Johannas Mutter, die ihre Tochter in einem Kloster untergebracht wissen wollte. Das Versagen seines Vaters, der es sich zu leicht gemacht hatte, indem er seine Tochter einfach abgeschoben hatte. Sein eigenes Unvermögen und die mangelnde Bereitschaft, sich Gedanken über den Lebensweg seiner Halbschwester zu machen und sie auf diesem Weg zu begleiten. Das Versagen der Kirche, die diesen Menschen in einer Weise geformt hatte, dass es zu einem unguten Ende kommen musste. Die Unfähigkeit von Ludwigs unbekanntem Vater, der sich seiner Verantwortung entzogen hatte und schließlich das Unvermögen von Johanna selbst, ihrem Leben eine sinnvolle Richtung zu geben. Nein, trauern konnte Adalbert Schmidt nicht. Aber in Gedanken versprach er seiner toten Halbschwester, alles ihm nur erdenklich mögliche zu tun, seinem Neffen Ludwig das zuteilwerden zu lassen, was dieser verdiente, nachdem er schon seit seiner Geburt die leiblichen Eltern und ihre Familie entbehren musste. Ludwig sollte eines Tages die Erbschaft seines Großvaters antreten, das Erbe, das für Johanna vorgesehen war. Auf dass es ihm auf seinem Lebensweg eine Stütze sein könnte.
Auch Ernst war in diesen Tagen besonderen Gefühlsschwankungen ausgesetzt: zwischen Freude und Traurigkeit, zwischen Glück und Enttäuschung, zwischen Hoffnung und Misstrauen. Und sein größtes Problem war es, dass er all diese Gefühlsregungen nicht zeigen wollte. Er genoss es, wenn er mit seinen Freunden zusammen sein konnte. Neben den Sertürners mochte er auch die Buchbinders. Ebenso konnte er Agnes und Elsbeth gut leiden. Glücklich war er über die nun schon einige Monate währende Bekanntschaft mit Adalbert, der sich während seiner Lehrzeit intensiv um ihn kümmerte und ihm half, wo er nur konnte. Aber Traurigkeit, Enttäuschung und Misstrauen musste er mehr denn je seiner Mutter entgegenbringen, und das war sehr schlimm. Wieder und wieder las Ernst in dem Tagebuch dieser Johanna Grünberg, das er tief verborgen in einer Wäschetruhe seiner Mutter gefunden hatte – eher zufällig, während die Mutter nun schon den zweiten Tag nicht zu Haus war. Seit diesem Ereignis bei dem Libori-Fest, als sie dem Franz Altemeier bei seiner Flucht aus Paderborn geholfen hatte, war es einige Male vorgekommen, dass sie über Nacht weggeblieben war. Sie sei bei einer Freundin aus Kindertagen, die sie nach langer Zeit auf dem Weg zur Arbeit zufällig getroffen habe und die jetzt in Lippspringe wohne, hatte sie gesagt. In Begleitung des Kramers Hensler werde sie reisen, hatte sie erklärt. Allein, er glaubte seiner Mutter nicht. Er glaubte ihr nicht mehr, seitdem er dieses Tagebuch gefunden hatte. Der Deckel der Truhe war nicht verschlossen gewesen und die Katze hatte es sich zwischen der Wäsche gemütlich gemacht. Und dann hatte die Katze die Wäschestücke herausgezogen und ein unsägliches Durcheinander angerichtet. Als Ernst für Ordnung sorgen wollte, hatte er das Tagebuch entdeckt. Er hatte darin gelesen und erfahren, dass Franz Altemeier angeblich Ludwigs Vater war. Ob Ludwig darüber glücklich sein würde, wenn er diese Wahrheit eines Tages erführe? Sehr gut konnte sich Ernst daran erinnern, dass er damals mit Friedrich Wilhelm die Leiche der Johanna gefunden hatte. Sehr deutlich hatte er das Medaillon seiner Mutter vor Augen, das die Jungen bei der Toten gefunden hatten. Sehr wohl klangen ihm noch die Erklärungen seiner Mutter in den Ohren, die damals behauptet hatte, dass sie den kleinen Ludwig ausgesetzt habe, nachdem Johanna bei der Geburt gestorben sei. Während der Vater unbekannt sei. Es war eine Lüge, eine ganz abscheuliche Lüge. Franz Altemeier war der Familie nicht nur seit langem bekannt – mehr noch: Über zwei Jahre hatte dieser seit dem damaligen Sturm über Neuhaus mit ihnen gemeinsam unter einem Dach gelebt – der Vater seines Freundes Ludwig. Und diesem Mann hatte seine Mutter zur Flucht verholfen. Bis auf Elsbeth war darüber niemand glücklich in Anbetracht der Umstände, die den Franz Altemeier ins Zuchthaus gebracht hatten. Und die Mutter war natürlich glücklich darüber, dass die Flucht gelungen war. Schließlich hatten Mutter und Altemeier in den letzten beiden Jahren Gefallen aneinander gefunden. Es hatte den Anschein gehabt, als würde Mutter in Bälde aus ihrem Witwen-Dasein ausbrechen können. Wo war ihr Franz jetzt? Vielleicht in der Nähe der kürzlich wieder getroffenen Freundin aus Kindheitstagen?
Ernst spürte, wie Wut in ihm aufstieg. Er war versucht, das Tagebuch an die Wand zu schleudern. Es zu vernichten. Zu zerstören, was diese unselige Wahrheit barg. Er warf es mit voller Wucht - gottlob nur in den Wäschekorb. Dabei bebte er vor Zorn. Auch seine Hände zitterten, als er das Buch noch einmal ergriff und es erneut auf die Wäsche schmetterte. Eine einzige dicke Träne rann ihm die Wange hinunter, während er sich auf die Oberlippe biss.
Es war das erste Mal, dass ein hitziges Temperament hervortrat, fast mit einer Spur Jähzorn versetzt. Ein Zustand, der in seinem Leben noch wenige Male Bedeutung erlangen sollte, während er im Übrigen Ärger oder Unzufriedenheit hinter einem nichtssagenden Gesichtsausdruck zu verbergen suchte. Aber wenn seine Gemütslage diese neue bisher unbekannte Form der Reaktion hervorrief, wenn es ihn überkam, dann eruptiv. Kurz und heftig. Aber leider auch unkontrolliert und folgenreich.
Es dauerte eine kleine Weile, bis sich Ernst etwas beruhigt hatte. Nunmehr nahm er das Tagebuch kopfschüttelnd und behutsam an sich und nahm sich fest vor, bei passender Gelegenheit mit Lehrer Buchbinder darüber zu sprechen. Sollte er auch Elsbeth und Agnes davon berichten? Denn wenn es stimmte, was da geschrieben stand, dann waren Elsbeth, Agnes und Ludwig ja Geschwister. Sollte er Friedrich Wilhelm um Rat fragen? Nein, die Sertürners würde er damit in diesen Tagen nicht behelligen wollen, entschied er. Friedrich Wilhelms Vater war sehr krank. Da hieß es, zusätzliche Aufregung zu vermeiden. Erst einmal galt es, Vorkehrungen zu treffen, damit die Entdeckung geheim gehalten werden konnte. Ernst erwartete seine Mutter bald zurück. Er könnte sie zur Rede stellen. Aber welche Lügen würde sie ihm dann auftischen? Er fühlte sich unglücklich. Es war sehr traurig. Er glaubte ihr nicht mehr.
»Unser Vater hatte mich beauftragt, Johanna zu suchen und ihr ein Erbe zukommen zu lassen. Nun habe ich sie gefunden. Aber ich kann ihr nicht mehr aushändigen, was ihr zusteht«, sprach Adalbert zu den Buchbinders, als sie in ihr Heim zurückgekehrt waren.
Agnes bekam noch einige Wortfetzen von dem Gespräch mit, das dieser Fremde mit Clemens und Elisabeth in der Stube führte, als sie die Küche verließ, um eine Flasche Wein aus dem Keller zu holen. Demnach sollte also der kleine Ludwig reich sein, da dieser ein großes Erbe erhalten würde, wunderte sich Agnes. Dass Ludwig das Kind der toten Johanna war, das hatten Ernst und Friedrich Wilhelm ihr und ihrer Schwester einmal erzählt. Es war ihr auch bekannt, dass Ludwig noch nichts darüber wusste. Aber wie soll er denn nun von dem Erbe erfahren, wenn er die Hintergründe nicht kennt, überlegte Agnes. Sicher muss man Ludwig nun erklären, dass er nur ein Adoptivkind der Buchbinders ist. Wann man es ihm wohl sagen wird? Ausgerechnet heute ist Ludwig mit anderen Ministrantenanwärtern beim Kaplan Crux, dachte sie. Da konnten sich die Adoptiveltern ungestört unterhalten. Es war aber auch zu dumm, dass sie das Gespräch nicht weiter belauschen konnte. Leider war auch Ferdinand nicht in der Nähe. Der war in diesen Tagen zusammen mit dem Hofgärtner mit dem Ausputzen von Buchsbaumtrieben im Schlossgarten beschäftigt. Sie musste unbedingt mit Elsbeth und Ernst darüber sprechen. Doch dazu musste sie die Wohnung von Irmtraud Grave im Marstall aufsuchen. Obwohl sie wusste, dass sie ihren Vater dort nicht mehr anträfe, ging sie diesen Weg noch immer ungern.
Da schleppte Altemeier nun das Wasser, das vom Donoper Teich mit Fuhrwerken herangeschafft worden war. Wasserknappheit war immer schon ein großes Problem in Lopshorn, wo sich das Fürstliche Jagdschloss befand. Am Zeughaus, gerade unterhalb zweier barocker Wappensteine, setzte er die Wasserkübel ab. Er bewunderte einige gräfliche Wappensteine. Aber mehr noch begeisterte ihn das Pferdehaus, die Gebäude des Senner Gestüts Lopshorn, das sich im lippischen Wald am Rande der Senne befand. Graf Simon Heinrich hatte vor über hundert Jahren die Gestütsgebäude aus dem höher gelegenen Waldgelände, dem ständigen Weidegebiet der Pferde im Sommer, nach Lopshorn verlegt, wo er ein Jagdschloss hatte erbauen lassen. Hier waren nun die Pferde des lippischen Fürstenhauses untergebracht, Senner Pferde, die über Jahrhunderte in der Sandlandschaft gelebt hatten. Die frei in den großen Herden umherschweiften, bis man sie eingefangen, gezähmt und ihre Züchtung begonnen hatte.
An diesem Ort fühlte sich Franz Altemeier erst mal sicher. Er war auf dem Weg nach Minden in der Residenzstadt Detmold abgestiegen und hatte einen Amtmann getroffen, mit dem er früher gelegentlich korrespondiert hatte. Dieser hatte ihm eine vorläufige Unterkunft in der Meierei vermittelt, die für die Versorgung der Jagdschloss-Bewohner mit Lebensmitteln zuständig war. Altemeier wusste, dass die Paderbornischen ihm hier nichts anhaben konnten, denn das calvinistisch geprägte Fürstentum Lippe hielt sich eng an die protestantischen Preußen.
Außerdem bot ihm die Örtlichkeit Gelegenheit, sich ohne Bedenken mit seiner Irmtraud treffen zu können. Wenn ihnen auch leider immer nur kurze Begegnungen vergönnt waren. Das war bedauerlich, aber man musste vorsichtig sein. Beim nächsten Mal wollten sie sich im Kreutz Krug treffen. Leider musste er dazu immer auf Karl, diesen ungehobelten und unsympathischen Klotz zurückgreifen, der als sein ständiger Begleiter seit der Flucht aus Paderborn den Kontakt zu Irmtraud aufrecht hielt und als Bote dienlich war. Längst war diesem Karl anzumerken, dass er der Aufgabe überdrüssig war und sich lieber heute als morgen weiter nach Minden begeben wollte. Doch das war Altemeiers Bestreben derzeit noch nicht, denn bis nach Minden würde Irmtraud in absehbarer Zeit nicht reisen können.
»Ludwig ist jetzt steinreich!«, rief Agnes ihrer Schwester Elsbeth zu, die im Begriff war, einige Gepäckstücke vom Wagen des Kramers Hensler zu laden. Er hatte Irmtraud Grave zurückgebracht.
»Was sagt du da?«, erwiderte Irmtraud ungläubig. Die Neuigkeit, die Agnes übermittelt hatte, war nicht zu überhören gewesen. »Wer hat dir denn diesen Floh ins Ohr gesetzt?«
Na ja, dieser Monsieur Schmidt, der mit Ernst zusammen in der Druckerei arbeitet, ist doch der Bruder von der toten Johanna. Und der hat zum Lehrer Buchbinder gesagt, dass der Ludwig nun alles erben soll, weil er der Sohn der Johanna ist!«, berichtete Agnes aufgeregt.
»Und weiß Ludwig schon davon?«, fragte Ernst, der inzwischen zu den Anwesenden hinzugekommen war.
»Nein, das geht doch nicht«, gab Agnes zurück, der weiß doch noch nicht einmal, dass die Johanna seine Mutter war.
»Hat Ludwig denn nichts von dem Gespräch zwischen Adalbert und den Buchbinders mitbekommen?«, bohrte Ernst weiter.
»Der ist einige Tage beim Kaplan Crux zum Ministranten-Treffen!«
»Und wie viel wird der Ludwig erben?«, wollte Elsbeth wissen.
»Na, das wird er uns wohl kaum erzählen«, meinte Irmtraud.
»Oh, es wird ein riesiger Batzen sein, wurde gesagt. Aber Einzelheiten konnte ich leider nicht verstehen«, gab Agnes etwas kleinlaut zu.
»Ach, unser Problem ist das nicht«, sprach Irmtraud nun. Und wer genau hinhörte, konnte schon ein klein wenig Neid aus ihren Worten vernehmen und aus dem Mienenspiel ihrer Gesichtszüge lesen. »Außerdem werden die Buchbinders das Vermögen doch sicher noch einige Jahre verwalten, bis Ludwig erwachsen ist und darüber selbst verfügen darf.«
Zu gönnen ist es ihm, dachte Ernst, wobei er misstrauisch eine Braue hochzog, als er seine Mutter so reden hörte. Sie wusste doch ganz genau, dass Altemeier der Vater des kleinen Ludwig war. Und wenn auch er davon Kenntnis hatte, würde er wegen des Erbes doch gewiss Forderungen stellen. Aber vielleicht war dem Franz Altemeier ja nichts davon bekannt. Schließlich lebte Ludwig nicht bei ihm, sondern war von den Buchbinders adoptiert.
So in seinen Gedanken versunken ging er in seine Kammer. Er starrte nachdenklich auf den Ort, wo er das Tagebuch gegenwärtig versteckt hielt. Ernst wusste nicht, was er denken sollte. Es war alles so verworren. Er nahm sich vor, insgeheim seine Mutter zu beobachten.
Im sonntäglichen Staat gekleidet flanierten Irmtraud Grave und Elsbeth Altemeier am Kabinettsgärtchen von Schloss Neuhaus vorbei und machten sich auf den Weg zur Pfarrkirche St. Heinrich und Kunigunde. Dort wurde Elsbeth in die Obhut der Buchbinders übergeben, die zusammen mit Zwillingsschwester Agnes den Gottesdienst besuchten. Derweil nahm Ludwig am vorletzten Tag des Ministranten-Treffs teil. Ferdinand war heute am Rande des Schlossgartens im Einsatz. Im Bereich des Wasserturms am Mündungsdreieck von Alme und Lippe wurden die Wege erneuert. Mit Kieselsteinen wurden sie begehbar gemacht.
Heimlich folgte Ernst seiner Mutter, als sie sich von der Pfarrkirche zurück zur Residenzstraße begab. Auffallend häufig drehte sie sich um, als spürte sie eine Verfolgung. Dann schlich sie überwiegend im Schatten daher. Den Kopf hielt sie meistens gesenkt. Östlich an der Schlosswache vorbei eilte sie zur Mündung von Pader und Lippe, wo sie sich mit einem hässlichen Muskelprotz traf. Es war der Mann mit der auffälligen Gesichtsnarbe, der Fluchthelfer von Franz Altemeier. Es war der Unhold, dem Ferdinand einst zum Opfer gefallen war und der nun von Irmtraud mit Karl angesprochen wurde. Geschützt durch einige Bäume und das dichte Buschwerk am Ufer konnte Ernst sich bis zu einem Pylon der Lippebrücke vorwagen. Auch wenn er beide nicht immer im Blick hatte, konnte er das Gespräch seiner Mutter mit Karl belauschen. Er presste die Hände auf seinen Brustkorb. Fast schien es, als wollte er auf sein pochendes Herz beruhigend einwirken.
Mit Entsetzen musste Ernst vernehmen, wie seine Mutter eine Intrige spann – boshaft, ohne mit einer Wimper zu zucken. Für Ferdinand war es unglaublich, wie seine Mutter sich verhielt – und das in Anbetracht ihres früheren Fehlverhaltens. Warum war man ihr gegenüber damals nur so wohlgesonnen gewesen. Es durchzuckte ihn. Das also war seine Mutter; so gefühlskalt und gehässig. Die Mutter berichtete dem Narbengesicht davon, dass Ludwig ein beachtliches Erbe erhalten habe.
»Franz Altemeier wird meine Informationen sofort benötigen«, insistierte Irmtraud. »Er ist der Vater von Ludwig und sollte sich des Erbes schnellstens annehmen und es verwalten, bis Ludwig selbständig darüber verfügen kann«, drängte sie. »Ich kann in diesen Tagen nicht schon wieder verreisen, um Franz die Dringlichkeit deutlich zu machen, dass nun zügiges Handeln angesagt ist. Noch wird das Erbe bei den Buchbinders zu finden sein. Aber gewiss wird man es schon bald einem Notar anheimgeben. Mit meinen Beweisen für Altemeiers Vaterschaft werden wir die Buchbinders überrumpeln und sie zur Herausgabe des Vermögens auffordern können. Machen Sie sich auf den Weg, Karl – es wird Ihr Schaden nicht sein!«
Zuletzt konnte Ernst noch aufschnappen, dass seine Mutter verriet, wo sich Ludwig gegenwärtig aufhielt. In Kürze würde er vom Treffen der Ministranten bei der Loretokapelle in Marienloh zurückkehren.
Ernst fühlte sich elend. Die gesunde Farbe der Haut war aus seinem Gesicht gewichen. Die Blässe ließ ihn kränkelnd erscheinen. Das Gesehene und Gehörte setzte ihm arg zu. Er litt an einem seelischen Schmerz. Als er sich davonstahl, wurde er angerempelt und musste eine Schimpfkanonade über sich ergehen lassen. Er sah in das feiste Gesicht einer Kanaille und schwieg. Er wusste nicht zu sagen, ob das Maulen des Passanten berechtigt war. Er war in Gedanken. Und stolperte schon wieder.
Endlich konnte Karl durchschnaufen. Soeben hatte er den kleinen Ludwig in ein Loch bei der Burgruine Kohlstädt eingesperrt, das einem Verlies ähnelte. Die Entführung war mit Leichtigkeit vonstattengegangen – fast wie ein Kinderspiel. Ein Griff, ein Knebel, ein Strick, ein Sack. Und dann hatte er sein Opfer auf den mit Stroh beladenen Karren gepackt. Ja, man hatte Karl gesehen, aber sorgfältig vermummt hatte ihn gewiss niemand erkennen können. Ein wenig musste er die Stimme verstellen und mit seinem Messer drohen, als er an diesen Kaplan die Forderungen gerichtet hatte, die jener Ludwigs Adoptiveltern übermitteln sollte. Dann hatte er eiligst Marienloh verlassen und war die kurze Strecke über Lippspringe gefahren. Als er den Grenzposten kurz vor der Ortschaft Schlangen passiert hatte, war nur noch eine kurze Strecke bis zur Strothe zurückzulegen – bis zu dem Bach, der unmittelbar an der Burgruine vorbeiführte. Der erste Teil seines Vorhabens war geschafft.
Es behagte ihm ganz und gar nicht, für Franz Altemeier weiterhin nur als Bote tätig zu sein. Schon längst hatte er in Minden sein wollen. Und er hatte mehrfach vor der Entscheidung gestanden, alleine weiterzureisen. Aber da war zum einen der Anweisung des Kommandanten der Demarkationsarmee Folge zu leisten. Er hatte den Auftrag Altemeier zu begleiten, für den man einen Posten vorgesehen hatte. Andererseits konnte er der Versuchung nicht widerstehen, sich selbst die Erbschaft des Ludwig anzueignen. Er hatte es so satt, immer nur unter Druck irgendwelchen Anweisungen zu folgen. Schließlich hatte er sich dazu entschieden, diesmal auf eigene Faust zu handeln. Warum sollte er sich nicht selbst die Rosinen aus dem Kuchen picken, wenn sich schon so unverhofft die Gelegenheit dazu bot. Leider hatte er sehr spontan handeln und improvisieren müssen. Da war ihm die Burgruine eingefallen. Über die hatte er während eines kürzlichen Aufenthaltes im Kreutz Krug von Waldarbeitern gehört, dass in der ehemaligen Zoll- und Versorgungsstation am Pass zur Kleinen Egge schon Schatzgräber gesichtet worden seien. Er hatte sich sofort hier umgesehen. Die dicken Mauern, in die lange Schlitze zu Verteidigungszwecke ausgespart waren, beeindruckten ihn – ebenso wie die Überreste des Wehrturms, in dem man über eine Wendeltreppe in die Höhe gelangen konnte. Seitlich des Turms hatte er ein verfallenes Nebengebäude mit einem Kellerraum entdeckt, der sich verriegeln ließ. Hier hatte er Ludwig vorübergehend eingesperrt – vorübergehend, ja, denn ideal war der momentane Aufenthaltsort sicher nicht. Zwar war die Burgruine von dichtem Buschwerk umgeben und kaum einsehbar. Dennoch musste man jederzeit damit rechnen, dass irgendwelches Gesindel aufkreuzte, womöglich die Schatzgräber, oder auch Bewohner des nahen Ortes Kohlstädt. Es gab eine Mühle in der Nähe, und sogar eine Glashütte war nicht weit entfernt. Karl entschied sich, den Ludwig mit dem Nötigsten zu versorgen und dann eine kleine Strecke weiter östlich das Gebiet des Hohlesteins zu erkunden. Da war angeblich vor gar nicht allzu langer Zeit westlich des Berggipfels die Hohlsteinhöhle entdeckt worden – vielleicht ein viel geeigneterer Unterschlupf für den Entführer und sein Opfer.
»Geld macht nicht glücklich«, jammerte Elisabeth Buchbinder, als sich überraschenderweise noch am späten Sonntagabend Kaplan Crux eingefunden und von der Entführung des kleinen Ludwig berichtet hatte. Er hatte die Lösegeldforderung des Entführers übermittelt, der verlangte, dass Clemens Buchbinder bis zum Mittwochmittag mit einer Anzahlung von 1000 Talern alleine beim Kreutz Krug zu erscheinen habe. Dort würde er weitere Informationen zur Geldübergabe erhalten.
»Es war bestimmt dieses Narbengesicht«, vermutete Ernst, der erst kurz zuvor die Gelegenheit wahrnehmen konnte, sich – von seiner Mutter unbemerkt – aus dem Haus zu stehlen und die Buchbinders darüber zu informieren, was er am Morgen beobachtet hatte. Auch war es längst überfällig, über die Neuigkeiten zu berichten, die Ernst aus dem geheimen Tagebuch erfahren hatte. Dass Franz Altemeier der Vater des Ludwig sein sollte, war für die Adoptiveltern eine schockierende Neuigkeit.
»Dann sind Ludwig, Elsbeth und ich also Geschwister«, kombinierte Agnes interessiert.
»Und wieder ist es dieser Schurke Karl, der seine Finger im Spiel hat«, entrüstete sich Ferdinand. »Es wäre schön, wenn wir dem das Handwerk legen könnten.«
»Und meine Mutter spielt uns allen schon lange eine entsetzliche Komödie vor«, klagte Ernst verbittert.
Erregt und verständnislos schüttelte Clemens Buchbinder den Kopf: »Das passt doch alles nicht zusammen! Einerseits lässt Madame Grave über diesen Verbrecher ausrichten, dass sich der Altemeier auf seine Vaterschaft besinnen soll ...« Das Wort ging dem Lehrer nur schwer über die Lippen. »Nur weil sie nach dem Erbe giert. Andererseits wird unser Ludwig von diesem Halunken ent ...« Clemens mochte seine Sätze nicht zu Ende formulieren. Dass sich sein Adoptivsohn nun in der Gewalt dieses Kriminellen befand, ging ihm sichtlich an die Nerven. Es war unglaublich und entsetzlich. Der Lehrer spürte, dass auch seiner Frau zum Heulen zumute war. Er sah in ihren Augen, dass sie zunehmend mutloser wurde. Beide hatten sie Angst davor, Ludwig zu verlieren. Vielleicht hätten sie ihn damals doch lieber nicht adoptieren ... Es war ja zu befürchten, dass sie solchen Situationen nicht gewachsen sein würden. Aber nein! Clemens verbat sich weitere derartige Gedanken. Es war eben nicht leicht, einen kühlen Kopf zu bewahren.
»Es sei denn ... So wie ich diesen Triebtäter damals erlebt habe ...« Ferdinand stockte. Oh je, ging es ihm durch den Kopf. Sollte sich der nun womöglich ebenfalls an Ludwig vergehen wollen ... Es war nicht auszudenken. Da korrigierte Ferdinand seine Einlassung und murmelte nunmehr: »Vielleicht will der Entführer sein eigenes Ding durchziehen.«
»Wie dem auch sei ...« Auch der Kaplan war nachdenklich ob der Mutmaßungen. »Wir müssen uns überlegen, wie wir nun weiter vorgehen wollen. Über die Behörden unseres Hochstifts wird man auf das Geschehen jenseits der Grenze kaum Einfluss nehmen können. Wir sind auf uns selbst angewiesen. Natürlich müssen wir alles dafür tun, dass Ludwig nicht zu Schaden kommt. Das Geld haben wir nicht. Also müssen wir unsere weiteren Überlegungen zusammen mit Monsieur Schmidt abstimmen. Wer weiß, inwieweit er überhaupt die Möglichkeit hat, so schnell das Bargeld aus der Erbschaft zur Verfügung zu stellen.«
»Heute Abend werden wir ihn kaum mehr aufsuchen können. Ich weiß auch gar nicht genau, wo er sein Quartier bezogen hat. Ich könnte morgen mit ihm während der Arbeit über alles sprechen«, schlug Ernst vor. »Und wir sollten das Verhalten meiner Mutter beobachten, wenn sie von dem vielleicht eigenmächtigen Handeln dieses Narben-Karl erfährt. Eventuell kann sie uns weiterhelfen und in Erfahrung bringen, wo Ludwig versteckt ist – womöglich weiß sie es sogar.«
»Ich kann mich am ehesten bereithalten und ihr unauffällig folgen, falls sie sich dazu verleiten lässt, ihren Franz aufzusuchen«, brachte Ferdinand seine Überlegungen ein. »Sie wird eine Reisegelegenheit suchen, möglicherweise sogar wieder mit dem Kramer Hensler – der uns vielleicht auch noch wertvolle Informationen geben kann. Aber von Vorteil wäre es sicher, wenn mich noch jemand begleiten würde, damit wir einander informieren können.«
Der Lehrer sah zum Kaplan auf. In ihren Blicken lag Zustimmung.
Schließlich planten sie das weitere Vorgehen im Detail, soweit dies bereits jetzt möglich war. Dabei wurden auch die Zwillinge Agnes und Elsbeth eingebunden.
Fünf
Im Süden des Fürstentums Lippe
Elsbeth war noch in der Nacht von Ernst über die Vorfälle des Sonntags informiert worden und wusste, was zu tun war, als Agnes am folgenden Morgen die Nachricht von der Entführung des Ludwig in der Unterkunft der Graves kundgetan hatte. Um den Schein zu wahren, hatte Ernst ohne Zögern den Abmarsch zu seiner Lehrstelle fortgesetzt. »Die Buchbinders werden schon wissen, was zu tun ist«, hatte er kurz angebunden und halblaut auf die Nachricht reagiert, die Agnes überbracht hatte. Nur durch einen kurzen Blick hatten sich Ernst und Elsbeth noch einmal verständigt, denn die Reaktion der Mutter war unübersehbar gewesen. Sie schien etwas zu wissen, auch wenn sie überrascht tat. Als deutlich geworden war, dass Irmtraud einen Aufbruch vorbereitete, war Ferdinand durch Elsbeth informiert worden. Er hatte sich schon eine Weile in der Nähe des Marstalls aufgehalten. Ein gesatteltes Pferd war griffbereit gewesen; Proviant war eingepackt. Dann hatte es gar nicht lange gedauert, bis die Grave reisefertig erschienen war und sich zur Poststation begeben hatte.
Irmtraud Grave hatte die Postlinie nach Detmold benutzt. Zwar war sie unterwegs im Wagen ordentlich durchgeschüttelt worden. Aber sie wusste nun einen besonderen Vorteil dieser Reisemöglichkeit zu schätzen: Die Route führte über den Alten Postweg unmittelbar am Kreutz Krug vorbei, der seinem Namen alle Ehre machte, denn er war am Kreuzungspunkt von alten Handelswegen gelegen und bot nicht nur für Waldarbeiter eine Einkehrmöglichkeit.
Nach ihrem kurz entschlossenen Aufbruch war sie am Ziel ihrer Reise. Sie dachte daran zurück, dass ihr Sohn im Begriff gewesen war, sich auf den Weg zur Lehrstelle zu begeben, als Agnes am Morgen mit der Botschaft ins Haus gestürzt war, ein Mann mit einem ziemlich entstellen Gesicht habe den Ludwig entführt. Natürlich hatte Irmtraud sogleich an Karl gedacht. Aber das konnte, das durfte nicht sein. Karl hatte Franz über das Erbe des Ludwig informieren sollen. Und was sollte nun diese neue Entwicklung? War sie womöglich eine Idee vom Franz gewesen? Kaum zu glauben!
Die Grave suchte ein Nebengebäude des Kreutz Kruges auf, wo auch Waldarbeiter wohnten. Natürlich waren sie um diese Tageszeit bei der Forstarbeit. Aber Irmtraud traf eine Magd des Pächters an. Sie kannte Lina schon von ihren früheren Besuchen. Auch den Pächter, den Holzknecht Limberg, hatte sie bereits einmal kennengelernt. Nach ihm ließ sie schicken. Schon wenig später begab sich Limberg auf den Weg nach Lopshorn, um Franz Altemeier über die Ankunft von Irmtraud zu informieren und um Franz zum Kreutz Krug zu begleiten – umgehend. So hatte die Order der Dame aus dem Paderbornischen geheißen.
Franz Altemeier hatte inzwischen zu beachten gelernt, was umgehend aus dem Munde von Irmtraud Grave bedeutete, aus diesem süßen Mund seiner zukünftigen … Einmal mehr wanderten seine Gedanken in die Zukunft.
Derweil harrte inzwischen auch Ferdinand der Dinge beim Kreutz Krug, den er mit gebührendem Abstand eine kleine Weile später als Irmtraud erreicht hatte. Hinter den Stallungen hatte er sein Pferd versorgen können. Dann hatte er die Schankwirtschaft betreten und sich eine Kammer für die Nacht zeigen lassen. Anschließend erkundete er die Umgebung in der Hoffnung, unentdeckt bleiben zu können.
Am späten Nachmittag wurde es unruhig, als zwei Reiter den Kreutz Krug erreichten. Ferdinand fand heraus, dass es sich bei einem der Reiter um den Pächter handelte. Und dann vernahm er die bekannte Stimme von Irmtraud Grave. Wenig später beobachtete er, wie die Grave und Altemeier einander Zärtlichkeiten austauschten, von denen Altemeier nicht genug zu bekommen schien. Da wirkte Irmtraud deutlich ungeduldiger und forderte eine Erklärung zu dem unsäglichen Entführungsfall. Schnell wurde deutlich, dass Altemeier vom Alleingang seines Begleiters Karl nichts ahnte. Ebenso war ihm unbekannt, dass Irmtraud ihm eine Nachricht über die Erbschaft des kleinen Ludwig hatte zukommen lassen wollen.
»Karl hat sich schon mehrere Tage nicht mehr blicken lassen«, hieß es. Und natürlich wusste Franz auch nicht, wo der kleine Ludwig festgehalten wurde. Man könne eigentlich nur warten, bis Karl zurückkehre. Dann wolle er ihn zur Rede stellen, stellte Altemeier seinen Standpunkt dar. Denn wenn es zu einer Lösegeld-Übergabe kommen sollte, müsste sich Karl früher oder später zum Kreutz Krug zurückbegeben. Nur so würde Clemens Buchbinder die Einzelheiten zu den weiteren Modalitäten der Lösegeld-Übergabe erhalten können, sinniert Altemeier.
Man beschloss abzuwarten. Franz Altemeier drängte Irmtraud zu ihrer Kammer und erhoffte sich ein schönes Stündchen zu Zweit. Später wollte man auf ein Bier oder einen Branntwein in die Schankwirtschaft einkehren, erfuhr Ferdinand.
Ferdinand wäre froh gewesen, wenn er nun einen Verbündeten an seiner Seite gewusst hätte, den die Beiden nicht kannten. Gutes Beobachten und Erlauschen des Gesagten war angesagt. Man müsste sich in unmittelbare Nähe von Franz Altemeier und Irmtraud begeben können ohne aufzufallen, dachte er. Und dabei könnte das Personal des Kreutz Krugs von unschätzbarem Wert sein. Noch zögerte Ferdinand. Doch dann entschied er sich, die Magd Lina ins Vertrauen zu ziehen. Es sollte eine sehr gute Entscheidung sein.
»Ach, der Kartenkönig Karl! Da hat Er uns doch tüchtig ausgenommen im Kreutz Krug! Was treibt’s Ihn denn nach Kohlstädt?«
»Müller Martin«, grüßte Karl – etwas verlegen und überrascht, denn den Stammgast vom Kreutz Krug hatte er nun gewiss nicht erwartet, »will mal nach dem Rechten schauen und mich überzeugen, ob Ihre Mühle mehr abwirft als das Kartenspiel«, ergänzte er schlagfertig. »Aber Spaß beiseite, Sie können mir sicher einen Rat geben, wie ich die Hohlsteinhöhle finde.«
»Die Hohlsteinhöhle, hm, war noch nie dort, soll auf ein paar Schritte erforscht worden sein. Da gibt’s nur Fledermäuse und Höhlenkäfer. Traut sich niemand hin, ist nämlich nicht ganz ungefährlich da drinnen. Gab wohl schon etliche Verschüttungen. Deshalb wurde der Zugang mit einem Gitter versperrt, sagt man. Aber was will denn der Kartenkönig da? Neuer Treffpunkt fürs Kartenspielen gefällig?«
»Sie scherzen, Müller. Später heißt’s noch, die Fledermäuse hätten Ihr Kartenblatt verraten«, erwiderte Karl. »Nein, ich hörte vom Pächter der Glashütte beim Nassen Sande, dass aus den Geschäften längerfristig kaum mehr gute Erlöse zu erzielen sein werden. Es mangele an Holz, heißt es. Kaum vorstellbar, in diesem großen Waldgebiet.«
»Das habe ich auch mal aus der Kohlstädter Glashütte gehört«, bestätigte der Müller. »Sand und Kalk gibt’s zuhauf. Und jetzt haben wir noch enorme Holzvorräte, aber wie lange noch?«, zeigte sich Müller Martin skeptisch.
»Sehen Sie. Und da will ich im Auftrag von einem Interessenten aus Minden mal die Lage inspizieren und die Umgebung erkunden«, fand Karl gerade noch eine Erklärung, die die Neugier des Müllers vorerst befriedigte.
»Na, dann wünsch ich viel Erfolg!«, sprach der Müller. »Der Weg führt erst mal an der Strothe entlang. Rechter Hand gehen drei Wege zum Egge Berg hinauf. Der Mittlere, der noch vor der nächsten Mühle abzweigt, führt über den Gipfel des Hohlesteins. Aber: Keine Ahnung, wo sich der Höhleneingang befindet«, zog der Müller ratlos und bedauernd die Schultern hoch. »Und nehmen Sie sich vor dem Höhlenbären in Acht«, ulkte der Müller. »Nicht, dass der andere Kartenspieler, wie heißt er noch? – ah, Ihr Partner Franz – nicht, dass der die Rückreise nach Minden alleine antreten muss. Wann soll’s eigentlich zurückgehen?«
»Erst das Geschäft, dann das Vergnügen«, verabschiedete sich Karl. »Vielleicht sieht man sich ja noch mal im Kreutz Krug!«
»Hoffentlich!«, rief der Müller, als sich die Herren schon einige Schritte voneinander entfernt hatten. »Sie schulden uns noch eine Revanche!«
Welch ein Vorteil, dass ich bei dem Hofbuchdrucker Junkermann einen guten Stand habe, dachte Adalbert Schmidt, als er mit seinem Pferd die Grenze zum Fürstentum Lippe passiert hatte. Wo sonst hätte ich die Arbeit so kurzfristig niederlegen dürfen. Nun gut. Das, was heute noch zu tun ist, kann auch der Ernst erledigen. Der ist ein pfiffiges Bürschchen. Der hat während der bisherigen Lehrzeit eine Menge gelernt, arbeitet sauber, schnell und zuverlässig. Der hat ein gutes handwerkliches Geschick. Dem kann man schon schwierige Aufträge anvertrauen. Auch bei den Überlegungen zu Ludwigs Entführung ist er nicht auf dem Kopf gefallen, zollte ihm Adalbert gedanklich Respekt, als er sich alles noch einmal durch den Kopf gehen ließ, was er erfahren hatte.
Von den Buchbinders hatte Adalbert sich die Einzelheiten schildern lassen, nachdem ihm Ernst die größeren Zusammenhänge dargelegt hatte. Von Elsbeth und Agnes hatte er erfahren, dass Ferdinand der Grave gefolgt war, als diese am Morgen so überstürzt aufgebrochen war. Der Kreutz Krug musste das Ziel sein, davon war auch Adalbert überzeugt, nachdem er den Kramer Hensler aufgesucht hatte. Der hatte ihn darüber in Kenntnis gesetzt, dass dieser einige Male die Grave bis nach Lippspringe mitgenommen hatte. Natürlich hatte der Kramer Hilfe zugesagt und angeboten, mit einem Fuhrwerk den Clemens Buchbinder zu begleiten, wenn dieser sich auf den Weg zum Kreutz Krug zu begeben hätte. Aber eine Lösegeld-Übergabe, die wird es sicher nicht geben. Das Geld liegt beim Notar. Das wird einige Zeit dauern, bis ich darauf zugreifen kann, vergegenwärtigte sich Adalbert die Lage. Jetzt wird es Zeit, dass ich den Kreutz Krug erreiche. Es dunkelt schon. Hoffentlich treffe ich Ferdinand dort mit einigen guten Nachrichten an, sinnierte er, als er über die Fürsten-Allee ritt – die vierreihig mit Eichen und Buchen begrenzte Straße jenseits von Schlangen, eine standesgemäße Zufahrt zum ehemaligen Jagdschloss Oesterholz.
»Wer hätte das gedacht, dass ich Sie schon heute wiedertreffe, Franz!«, rief Müller Martin begeistert aus, als er die Schankwirtschaft betrat. »Heute in Begleitung einer Dame, da wird man natürlich unseren Kartenkönig Karl kaum vermissen! Darf ich mich dazusetzen?«, fragte der Müller. »Auch ohne Kartenspiel? Denn ich nehme an, es schickt sich nicht, in Anwesenheit der Dame diesem Laster zu frönen?«, witzelte der Müller.
»Darf ich dem Herrn auch einen Trunk oder etwas zum Verzehr bringen?«, erkundigte sich Lina, die – durch Ferdinand gut instruiert – die Bedienung übernommen hatte.
»Ein Bier wäre nicht schlecht«, sagte der Müller. »Oder kann die Dame etwas empfehlen?«, fragte er mit der ihm eigenen Rhetorik, nicht ganz ernst gemeint und etwas plump. »Und von den köstlichen Bratkartoffeln. Eine nicht zu kleine Portion, wenn ich bitten darf.«
So nahm die Unterhaltung ihren Lauf, zuerst recht oberflächlich und dann doch interessant – zumindest für Irmtraud, Franz und die Magd Lina, die sich ungewöhnlich häufig in der Nähe des Gästetisches aufhielt und den wartenden Ferdinand später mit wichtigen Informationen nützlich sein konnte. Aber nicht nur Ferdinand interessierte sich dafür, sondern auch der inzwischen eingetroffene Adalbert, den Ferdinand bei seiner Ankunft beobachtet, schnell beiseite gezogen und über die bisher wenigen Neuigkeiten in Kenntnis gesetzt hatte.
»Der Müller Martin, der Monsieur Franz und sein Bekannter, dieser etwas grimmig aussehende Herr Karl, kennen sich wohl schon eine Weile. Sie haben hier im Kreutz Krug immer mal wieder Karten gespielt«, fasste die Magd zusammen. »Und der Müller erwähnte, dass er erst heute den Karl in der Nähe der Burgruine bei Kohlstädt angetroffen habe. Interessiert hat er sich für die Hohlstein-Höhle unterhalb des Hohlestein-Gipfels. Dahin soll man wohl gelangen, wenn man von Kohlstädt einen Hohlweg nimmt, der über einen Hügelkamm führt. Kurz nach einer Wegegabelung, an der man sich rechts halten muss, führt ein Weg auf der linken Seite zu der Höhle. So sagt es der Müller. Ich hoffe nur, ich habe jetzt nichts durcheinander gebracht«, wurde die Magd etwas unsicher und schlug mit zunehmend zweifelndem und fragendem Gesichtsausdruck die Hände vor den Mund. »Bei der Höhle wollen sie morgen den Herrn Karl überraschen, hat der andere Mann noch zu der Dame gesagt.«
»Na, dann wollen wir morgen mal dem Altemeier und der Grave folgen«, entschied Adalbert und dankte der Magd, während er ihr eine Münze in die Hand drückte.
Am Tag darauf trieb sich der Halunke Karl wieder bei der Kohlstädter Burgruine herum. Es war eine glückliche Fügung, dass Franz Altemeier und Irmtraud Grave ihn dort entdeckten und sein Hantieren aus der Ferne beschatten konnten. Derweil beobachteten Ferdinand und Adalbert ebenfalls unbemerkt das merkwürdige Treiben, als Ludwig von seinem Entführer aus dem Versteck bei der Burgruine geholt und über unwegsame Stellen geleitet wurde. Der Junge konnte nicht sehen, wohin er trat. Denn ihm war wieder ein Sack über den Kopf gestülpt. Hinter dem Rücken waren seine Hände zusammengebunden. So war es mühsam, Ludwig auf den Karren zu verfrachten, mit dem er vor zwei Tagen hierher gebracht worden war. Außerdem sträubte sich der Junge und gab merkwürdige Laute von sich, was den Menschenschinder dazu bewog, sein Opfer mit einigen brutalen Tritten gefügig zu machen.
Als sich das Gefährt in Bewegung setzte, übergab Franz Altemeier sein Pferd an Irmtraud Grave. Ferdinand tat es ihm aus sicherer Entfernung gleich und gab seinen Braunen in Adalberts Obhut. Wie die Grave, so blieb auch Adalbert mit den Tieren zurück. Ferdinand hingegen, der aus Linas Hinweisen das nächste Ziel zu kennen glaubte, blieb dem Entführer und seinem Verfolger auf der Spur. Er beobachtete, wie der Karren der von ihm so verhassten Gestalt zunächst über den leicht steigenden Hohlweg holperte. Stellenweise blieben die Räder in tiefem Sand stecken. Dann war ein lautes Fluchen zu vernehmen, denn das Gefährt musste geschoben werden. An anderen Stellen war das über den Weg ragende Buschwerk noch intensiver zu beschneiden, als dies schon bei der ersten Erkundung am Vortag vorbereitet worden war.
Etliche Dachsbauten, für die Meister Grimbart unglaubliche Mengen an Sand aus der Erde gebuddelt hatte, säumten den Weg. Einmal erlaubte ein vermutlich durch einen Sturm entstandener Kahlschlag ein Blick nach Südosten über freies Gelände, wo im leichten Dunst ein halbes Dutzend Rehe zu erkennen war, die tollkühne bis heitere Sprünge absolvierten. Und dann ging es über Stock und Stein. Baumwurzeln, zum Teil mit Moss bedeckt, machten den Weg uneben. Auch Erosionsrinnen zerfurchten den Boden. Zunehmend beschwerlich wurde das Fortkommen, während das Gelände stetig anstieg. Der Untergrund wurde immer felsiger. Bei Regenwetter hätte dieses Unternehmen kaum durchgeführt werden können.
An einer Wegegabelung befand sich ein steinerner Tisch. Hier legte Karl eine Rast ein, während sich Altemeier und Ferdinand in gebührenden Abständen hinter alten knorrigen Bäumen versteckt hielten. Gelegentlich wirkte es etwas gespenstisch, wenn Sonnenstrahlen einige Nebelreste zu durchdringen suchten und ein diffuses Licht schufen. Spinnfäden flogen zeitweise durch die Luft und ließen einen nahenden Altweibersommer erahnen. Luft- und Bodenfeuchtigkeit nahmen stetig zu. Gut vorstellbar, dass sich in dieser Szenerie bald ein Höhleneingang zeigen würde.
Aufmerksam beobachteten die Verfolger, wie Vorkehrungen getroffen wurden, den Karren am Wegrand im Unterholz zu verstecken. Ludwig war hinuntergeklettert, nachdem ihm Sack, Knebel und Strick abgenommen worden waren. Und nun erkannte man auch, warum das Entführungsopfer von den Fesseln befreit worden war. Für Wagen oder Gespanne war der weitere Weg viel zu schmal.
Kaum erkennbar war der Pfad, auf dem der Verbrecher nun den Jungen vor sich hertrieb. Wie durch eine Klamm führte ein enger und steiler Steig mit teilweise überhängenden Felswänden, die an manchen Stellen nur wenige Schritte voneinander entfernt einander gegenüberstanden. Anders, als im Hochgebirge, schoss hier aber kein Wasser hindurch. Der lose Schotter verlangte jedoch etwas Trittsicherheit, und das Gelände forderte ein Höchstmaß an Wachsamkeit. Für die Verfolger war es ein Glück, dass das heftige Rauschen der Blätter die Geräusche der eigenen Schritte übertönte. Der Weg war kurvenreich, sodass meistens ein guter Sichtschutz gegeben war. Schließlich öffnete er sich wie durch einen aufgezogenen Vorhang. Das Dämmerlicht wich. Blendend und grell empfing stattdessen gleißendes Sonnenlicht die Ankömmlinge mit größeren zeitlichen Abständen nacheinander auf der Lichtung eines welligen Hochplateaus.
Im letzten Moment bemerkte Ferdinand, wie Altemeier durch den Höhleneingang einer steil aufragenden im Südosten einer Erdmulde gelegenen Wand schlüpfte. Rechts daneben befand sich ein übermannshohes schmiedeeisernes Gitter. Es war aus den Angeln gehoben, die in den Fels am Höhleneingang getrieben waren. Nicht ganz wohl war ihm dabei, als Ferdinand Schritt für Schritt Ludwigs vermeintlichem Vater folgte. Es dauerte eine Weile, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Zuerst stollenartig, dann in schmalen Spalten verengt, schien der Gang mit erheblicher Neigung in den Berg zu führen. Die ersten Schritte führten durch Morast und faulendes Laub der Bäume, das der Wind seit Urzeiten dorthin geweht hatte. Dann stieß Ferdinand immer wieder an Geröllmassen. Nachdem er einen Felsvorsprung passiert hatte, wurde ein spärlicher rötlich flackernder Fackelschein sichtbar, mit dem sich der Entführer tief im Inneren der Höhle seinen Weg ausleuchtete. Jetzt konnte Ferdinand vage die Silhouette seines direkten Vordermanns erkennen.
Die Wände waren feucht; überall tropfte das Wasser. Kalk hatte sich in bizarren Formen abgelagert. Linker Hand ertastete Ferdinand eine schmale Nische, vielleicht ein Nebengang.
Hier hielt er inne und beobachtete, wie Altemeier sich mühte, durch einen Engpass zu gelangen. Fast verbot sich ein weiteres Vordringen, denn das Gerede des herzlosen Gewalttäters und das Gewimmer des kleinen Ludwig waren jetzt gut zu vernehmen. Vermutlich waren sie nicht mehr allzu weit voneinander entfernt. Oder es lag an dem besonderen Schall in der Höhle, der das Gesagte leicht verzerrt und mit einem Nachhall übertrug. Gerne hätte Ferdinand darauf verzichtet, diese Worte hören zu müssen. Ludwig wurde über die Hintergründe der Entführung aufgeklärt.
Dass die Buchbinders nicht seine Eltern seien, schien den Jungen zu beeindrucken oder zu erschüttern. Denn es war keine Reaktion auszumachen. Als er aber angeschrien wurde, dass er der Bastard einer Hure sei, der es kaum wert sei, dass jemand für ihn ein Lösegeld berappen würde, wurde Ludwig erst weinerlich und dann wütend. Es schien zu einem kleinen Kampf zu kommen, den Ludwig natürlich nicht gewinnen konnte. Und als es Schläge setzte, war es um Ferdinands Vorsicht und Beherrschung geschehen.
Da war es wieder: das nervöse Zucken in seinem Gesicht. Ferdinand spürte es. Lange Zeit war es ausgeblieben – genau seit jenen Tagen, an denen er seinen ehemaligen Peiniger wiedergesehen und seine Sprache im Kreise seiner Freunde wiedergefunden hatte. Er stürzte voran, schürfte sich die Haut auf und zerriss sich die Kleidung, als er durch den engen Spalt drängte. Den wunderschönen Tropfsteinen, die als Stalaktiten von der Decke der geräumigen Hauptgrotte herunterhingen, schenkte er ebenso wenig Beachtung wie den imposanten Stalagmiten, hinter denen sich Altemeier verborgen hatte. Ungestüm attackierte er den Grobian, der für einen Moment überrumpelt schien. Dabei fiel seine letzte brennende Fackel zu Boden.
»Flieh!«, rief Ferdinand seinem jungen Freund zu. Aber Ludwig zögerte. Er tat noch einen letzten ängstlichen Blick, was ihm zum Verhängnis wurde.
»Nun mach schon!«, rief Ferdinand ihm energisch zu. Ludwig drehte sich in die Richtung, in der er den Ausgang vermutete und wollte loslaufen. Er kam jedoch nur wenige Schritte vorwärts, denn er geriet ins Straucheln. Nahezu zeitgleich fing sich Ferdinand einen kräftigen Schlag in den Magen. Er sah noch, wie der fliehende Ludwig stürzte. Karl hatte ihm ein Bein gestellt. Dann wurde Ferdinand mit Hieben malträtiert.
»Oh, wen haben wir denn da? Dieses Bürschchen kennen wir doch! Der hat wohl nicht genug bekommen, damals, als ich’s ihm besorgt habe!« Im Rhythmus seiner Schläge kostete Karl seinen Triumph aus. »Das können wir natürlich gerne sogleich fortsetzen! Schade, dass dieser Käfer nicht dabei zusehen kann«, frohlockte der Widerling, der dem am Boden liegenden scheinbar besinnungslosen Ludwig noch einen kräftigen Tritt verabreichte. »Diesen Tag werden wir alle lange nicht vergessen!«, jubilierte Karl. Auch Ferdinand war inzwischen wehrlos, nachdem er sich der unbändigen Kraft seines Gegenübers geschlagen geben musste. Dieser begann an Ferdinands Kleidung zu zerren. Eine angeschwollene Ader an seiner Schläfe verriet seine innere Erregung, als er sich über sein Opfer beugte.
Ludwig aber blickte noch einmal benommen auf. Das letzte Licht der Fackel spiegelte in Karls Augen etwas Dämonisches wider, das den Jungen erschauern ließ.
»Das will ich meinen! Dieser Tag wird so schnell nicht vergessen!«, schnaubte Franz Altemeier. »Ich hätte es wissen sollen, dass du eine unberechenbare und unzuverlässige Bestie bist, die einzig davon getrieben ist, die Habgier zu befriedigen!«
Er trat aus seinem Versteck und versuchte, sich zwischen die Kontrahenten zu stellen.
»Ach so ist das, der Vater hat auch endlich seinen Auftritt!«, wurde er von Karl mit kaltem Blick empfangen.
Es waren die letzten Worte des Gewalttäters. Überrascht war er aufgesprungen und hatte sich derart heftig an einer Sinterfahne den Kopf gestoßen, dass er taumelte und wieder zu Boden ging. Feine, wie spitze Nadeln geschaffene Sinterröhrchen prasselten von der Decke auf den Unhold nieder. Behände stürzte sich Altemeier auf seinen ehemaligen Gefährten. Er ergriff einen abgebrochenen etwa ellenlangen Stalaktiten. Schlank, spitz und an den Rändern messerscharf wie ein Eiszapfen war dieser Tropfstein geformt, den Franz seinem jetzigen Gegner in die Kehle bohrte. In Strömen quoll das Blut aus der Wunde und übergoss Karls Hände, als er sich an den Hals griff. Röchelnd tat er einige wenige Atemzüge. Ein letztes Mal bäumte sich sein Körper auf, als ihn die Lebensgeister verließen. Dann war Ruhe.
Adalbert hielt sich in der Nähe des Karrens versteckt. Bis dahin hatte er den anderen folgen können. Viel zu langsam, da er zuerst die beiden Pferde versorgt wissen wollte. Schließlich wusste er nicht, was ihn erwartete, Und es war viel zu riskant und verräterisch, die Verfolgung mit den Pferden aufzunehmen. Bei der Mühle vom Müller Martin hatte er sie unterstellen können. Nun harrte er der Dinge und wagte es nicht, sich weiterhin von Linas Beschreibung leiten zu lassen. So verunsichert, wie die Magd gewirkt hatte ... Er wollte lieber kein Risiko eingehen. Gleichzeitig beunruhigte ihn die Ungewissheit sehr.
Längst stand die Sonne im Süden. Etliche Stunden waren vergangen, seitdem man sich kurz vor Kohlstädt getrennt hatte. Irmtraud Grave hatte sich mit ihren Pferden zur Glashütte begeben; vielleicht hatte man dort einen Treffpunkt verabredet. Aber das bedeutete doch, dass Franz Altemeier diesen Hohlweg würde zurückkehren müssen – es sei denn ... Adalbert mochte es sich nicht ausmalen, dass bei dieser Unternehmung etwas schiefgelaufen wäre.
Während er noch darüber grübelte, ob es so schlau gewesen war, den Ferdinand mit der Verfolgung zu betrauen – schließlich war er durch seine persönlichen negativen Erlebnisse mit dem Gewalttäter viel zu befangen und möglicherweise zu beeinträchtigt, wenn es galt, einen kühlen Kopf zu bewahren – regte sich etwas im Unterholz. Adalbert erspähte, an welcher Stelle Altemeier hervorkam und dass er einen sehr benommen wirkenden Ludwig behutsam auf den Karren legte. Also musste die Befreiung aus den Klauen von diesem Karl geglückt sein. Aber ob sich der Entführer weiterhin in der Höhle befand? Und was wird mit Ferdinand geschehen sein? Sollte er nun Altemeier und dem Jungen folgen? Die würden doch gewiss zur Glashütte eilen und dann weiter zum Kreutz Krug reiten, wog Adalbert die Möglichkeiten ab. Er entschied sich dafür, endlich diese Höhle zu suchen.
Dort angekommen sah er den Eingang mit dem Gitter versperrt. Natürlich wagte er nicht zu rufen. »Vielleicht hält Karl den Ferdinand in seiner Gewalt? Aber dann werden beide kaum da drinnen sein. Wo könnten sie sich sonst in dieser Umgebung aufhalten?«, zog er leise murmelnd alle Möglichkeiten in Betracht. Er betrachtete die Verriegelung des Gitters. Von innen würde man sie kaum öffnen können. Der Balken, den man dem Eisen vorgelegt hatte, war zwischen zwei beachtlichen Felsblöcken eingeklemmt. Falls Altemeier diese Vorkehrung getroffen hatte ... »Dann sollte ich doch wohl in der Lage sein, den Eingang freizulegen«, sinnierte Adalbert.
Mühsam war es, aber es gelang. Quietschend bewegte sich das Gitter in den Angeln. Der Lärm durchzuckte ihn. »Und nun? Wie soll ich in dieser Dunkelheit etwas sehen können? Ich habe keine Kerzen. Und ich habe kein Seil, das ich gebrauchen könnte, um aus diesem Loch wieder hinauszufinden. Was weiß ich, welches Labyrinth mich hier erwartet?« Im Stillen fluchte er. Dann rief er endlich. Er wartete, bis der Nachhall verklungen war. Dann rief er erneut. Pause. Schließlich ein drittes Mal. Nach einigen Versuchen gewann Adalbert den Eindruck, eine Antwort vernommen zu haben. Ferdinands Stimme. Oder sollte ihn seine Wahrnehmung trügen? Er beschloss, in regelmäßigen Abständen laut rufend zu zählen und hoffte darauf, dadurch Ferdinand eine Hilfe zur Orientierung bieten zu können. Nicht lange dauerte es, bis sich der Erfolg zeigte. Da schlossen sich die Beiden in die Arme, berichteten einander und begaben sich zügig auf den Rückweg – so schnell dies möglich war, denn die Ereignisse hatten bei Ferdinand unübersehbare Spuren hinterlassen. Während seine seelische Verfassung neuen Auftrieb erlangte, setzte seine körperliche Versehrtheit ihm einige Grenzen. Er fühlte die Rippen geprellt. Und der Kopf schmerzte ihm sehr. Aber er schätzte sich glücklich, dass ihm durch die Gewaltanwendungen keine Gliedmaßen gebrochen worden waren.
Wie durch ein Wunder war es Ferdinand und Adalbert gelungen, dem Altemeier, der Grave und dem Ludwig auf der Spur zu bleiben. Anders als Karl ging Franz Altemeier beinahe liebevoll mit seinem Sohn um. Im Kreutz Krug hatte er eine Nachricht für Clemens Buchbinder hinterlassen, dass dieser ihn bei der Mordskuhle, in der Nähe des Fürstlichen Jagdschlosses Lopshorn, treffen solle.
Man hatte die Mordskuhle erreicht, die ihren Namen einer Volkssage verdankte. So sollte hier einst eine Räuberbande gelebt und ihr Unwesen getrieben haben. An diesem Ort war es für Ferdinand und Adalbert sehr viel einfacher, unbemerkt einen Beobachtungsposten zu beziehen. Und sie wurden Zeugen einer sehr aufschlussreichen Begebenheit.
Franz hatte – recht fürsorglich – dem Ludwig, der sich nun frei bewegen konnte, zu verstehen gegeben, dass er sein Vater sei. So wie Franz die Version von Ludwigs Geburt und die Folgen darstellte, war es für Ludwig erheblich weniger schmerzlich zu verstehen. Lediglich die Absicht seines Vaters, ihn mit nach Minden nehmen zu wollen, behagte Ludwig ganz und gar nicht. Zu sehr hing er seinem gewohnten Umfeld nach, bei den Adoptiveltern – wie sich das anhörte – und bei seinen Freunden. Und bei dem Gedanken an seine Freunde schlug die Stimmung bei Ludwig erneut um: Es machte ihn sehr unglücklich, dass sein Vater den Ferdinand schutzlos in der Höhle zurückgelassen hatte. »Wenn der wieder bei Sinnen ist, kann der sich selbst befreien«, hatte der Vater ihn zu beruhigen versucht.
Franz machte deutlich, dass er – nicht wie Karl – das Lösegeld erpressen wolle. Vielmehr hatte er daran Gefallen gefunden, tatsächlich seiner Vaterrolle gerecht zu werden – zu seinen Bedingungen. Und dazu zählte nun auch die Übergabe der Erbschaft.
»Und welches Druckmittel hast du in der Hand, wenn sich die Buchbinders oder dieser Schmidt nicht darauf einlassen?«, fragte Irmtraud.
»Du hast doch selbst gesagt, dass dieses Tagebuch meine Vaterschaft beweisen kann!«, erwiderte Franz ungehalten. »Du hast mir damit doch lange genug mein Geld abgepresst«, war auf einmal von der Liaison zwischen ihm und Irmtraud nicht mehr viel zu spüren.
»Na, ja«, widersprach Irmtraud, »aber was nützt dir der Beweis? Ich meine, wo willst du ihn einfordern? Im Hochstift? In Detmold? Bei den Preußen? Ich fürchte, man wird dir Vorhaltungen machen, dass du dich in den letzten acht Jahren als Vater rar gemacht hast, oder? Ich verstehe dich ja. Es war ja auch eigentlich meine eigene Idee, als ich dem Karl sagte, du solltest versuchen, deine Vaterrolle gewinnbringend zu nutzen. Aber ich habe eine viel bessere Idee«, machte Irmtraud den Franz neugierig, während sie sich ihm näherte und ihm Liebkosungen ins Ohr flüsterte, um ihn für ihre Überlegungen empfänglich zu machen: »Was hältst du davon, wenn du Elsbeth oder Agnes mit Ludwig verheiratest. Ich meine, nicht sofort, aber in ein paar Jahren? Sie könnten sich jetzt schon einander versprechen, und du würdest Familie und Geld beisammen halten!«
Einen Moment stutzte Altemeier. – Mit Agnes? Wohl kaum! – Mit Elsbeth? Schon eher. – Welch ein verlockender Gedanke! Auf solche Ideen können nur Weiber kommen, musste Altemeier anerkennend feststellen. Doch dann schien ihm eine entscheidende Schwierigkeit bewusst zu werden. Noch einmal überdachte er die Situation und kam zu einem ernüchternden Fazit:
»Wie soll das gehen? Soll ich etwa meinen Sohn und eine meiner Töchter miteinander verheiraten?«, stellte er enttäuscht eine nur mehr rhetorische Frage.
»Hältst du mich wirklich für solch einen Einfallspinsel?«, murmelte Irmtraud, während sie ihm den Backenbart kraulte. »Stell dir doch mal vor, Ludwig wäre gar nicht dein Sohn!«
»Dann wäre alles gut«, antwortete er begriffsstutzig.
»Eben!«
»Was, eben?« Also, das war für ihn jetzt alles etwas zu viel. Verwirrt bemerkte er, dass er ihre körperliche Nähe im Moment kaum ertragen konnte.
»Aber Ludwig ist doch nun mal mein Sohn! Oder sollten Elsbeth oder Agnes etwa nicht meine Töchter sein?«, stellte er fragend fest, während er ihrer Umklammerung zu entkommen suchte. Der Schweiß brach ihm aus. Diese Frau bringt mich völlig durcheinander. Was führt sie im Schilde? Weiß sie etwas, was ich nicht weiß, ging es ihm durch den Kopf.
»Gibt es etwas, das ich wissen sollte?«, fragte er etwas beängstigt, während er eine zunehmende Distanz einnahm.
»Na, ja«, zögerte Irmtraud nun und war sich plötzlich nicht mehr sicher, ob es so ratsam war, nach der langen Zeit nun die Wahrheit zu bekennen. »Elsbeth und Agnes sind schon deine Töchter, aber ... Ludwig ist das Kind meines verstorbenen Mannes Hermann!«
Stille. Absolute Stille. Es war ein Moment, in dem man eine Stecknadel hätte fallen hören können. »Was heißt denn das? Dein Tagebuch besagt doch, ich sei Ludwigs Vater!«
Es war Altemeier, als drohte eine Welt einzustürzen.
»Es ist nicht mein Tagebuch«, antwortete Irmtraud nun etwas gereizt. »Es ist das Tagebuch der Johanna Grünberg. Und darin steht, dass sie mit dir anfangs ein Verhältnis gehabt hat. Aber darin steht auch, dass sie mit Hermann zusammen war. Und ich habe es selbst gehört, als sie ihn an diesem Unglückstag in der Glasbläserei aufgesucht hat, dass das Kind von ihm ist. Ich habe es damals nicht nur gehört, ich habe es gesehen. In flagranti! Auf frischer Tat ertappt habe ich sie an jenem Dienstag, als sie sich mit ihrem dicken Bauch auf seinem Laken räkelte«, erinnerte sich Irmtraud nun und sprach mit zunehmender Erregung.
»Sie haben mit dem Feuer gespielt, ich habe das Feuer gelegt!«, schrie sie. Dann schluchzte sie mit Tränen in den Augen: »Leider konnte Johanna noch entwischen; Hermann ist dabei umgekommen!«
»Also waren die Informationen in dem anonymen Schreiben, das ich damals erhielt, doch richtig«, stellte der Amtmann Franz Altemeier nüchtern fest. »Irgendjemand hatte dich und Johanna damals in der Nähe der Glasbläserei gesehen«, erinnerte er sich. Und dann wurde ihm mit einem Male klar, von wem er die Mitteilung erhalten haben könnte. »Lea«, stöhnte er. Was war er doch für ein Idiot. »Natürlich, das Papier!« Jetzt sah er es wieder. Lauter Reste von Zeitungspapier aus dem Intelligenzblatt. Sie hatte die Scherben des Spiegelglases und des Fürstenberger Porzellans damit entsorgt. Mengen von alten Papierbögen. Sicher hatte sie damals daraus die Buchstaben geschnitten, mit denen sie die Nachricht, eine Warnung an ihn, gestaltet hatte. Er schlug die Hände vors Gesicht. Er war ein Narr. Du bist so verblendet, hatte Lea ihn damals provoziert. Nein, sie hatte mit ihrer Einschätzung den Nagel auf den Kopf getroffen. Und jetzt musste er sich erneut eingestehen, dass er nicht Herr der Lage war.
»Was sollte dann dieser Mummenschanz all die Jahre, in denen du mich in dem Glauben ließest, ich sei Ludwigs Vater?«, redete er sich nun zunehmend jähzornig in Rage. »Das Tagebuch beweist alles, hast du mir mehr als einmal zu verstehen gegeben. Was beweist das Tagebuch denn nun? Was ist denn nun die Wahrheit? Beweist es vielleicht auch die neue Version, mit der du mich einmal mehr überrumpelst? Zeig ihn mir, deinen Beweis!«, brüllte er, indem er auf sie zutrat, sie packte und schüttelte und ihr eine kräftige Maulschelle verpasste.
»Lass mich!«, wehrte sie sich. Vor Wut bebte sie am ganzen Leib, als sie sich von ihm losriss. »Ich zeige dir den Beweis!«, kreischte sie. Sie griff in ihr Mieder und entnahm ihm einige Seiten, die aus dem Tagebuch stammten, warf sie Altemeier vor die Füße und floh hastig von diesem unglückseligen Ort – ein folgenschwerer Schritt.
Während auch Ludwig die Konfusion der Situation nutzte, der Mordskuhle und seiner Gefangenschaft zu entfliehen, beobachteten Ferdinand und Adalbert, für die das Einschreiten unmittelbar bevorgestanden hatte, wie sich ein Fuhrwerk näherte. Der Kramer Hensler, der Clemens Buchbinder herbrachte, hielt mit seinem Gefährt direkt auf Irmtraud Grave zu. Wenngleich Hensler die Zügel seines Pferdes nach links riss und mit dem Karren einen derartigen Schlenker vollführte, dass er die Kontrolle zu verlieren drohte, wurde die im Zustand innerer Erregung befindliche unaufmerksam gewordene Irmtraud von einem Rad erfasst und zur Seite geschleudert. Auch dem Pferdehuf konnte sie nicht mehr ausweichen. Mit weit aufgerissenen Augen schaute der erschrockene Kramer in das fürchterlich entstellte Gesicht der Frau, die ohne einen weiteren Laut von sich zu geben alsbald ihren Verletzungen erlag.
Die Unruhe vor der Mordskuhle hatte Altemeier in die Wirklichkeit zurückgeholt. Sein Handeln erfolgte nahezu instinktiv, kurz entschlossen und zwangsläufig. Er griff sich ein Pferd, schwang sich hinauf und verschwand im Wald. Adalbert konnte ihm noch über die Anhöhe des Bielstein folgen. Doch im Gewirr der Wege auf der Erhebung der Grotenburg, die im Südwesten vor der Stadt Detmold thronte, verlor er zwischen den Wällen des Großen und des Kleinen Hünenrings den Flüchtenden aus den Augen.
Und was nun?, fragte sich Adalbert.
Das fragten sich auch Ernst und die Zwillinge, die Buchbinders und vor allem ihr Adoptivsohn Ludwig. Für den hatte sich kaum etwas geändert – nur, dass die für ihn neue Wahrheit und die Erlebnisse ein noch stärkeres Band der Verbundenheit zu seinen Freunden geschaffen hatten. Mit Ernst hatte er nun sogar einen Bruder, einen Halbbruder, um es genau zu nehmen. Und mit Agnes zusammen fühlte er sich weiterhin bei den Buchbinders zu Haus. Elsbeth und Ernst überredeten Adalbert Schmidt, mit ihnen zusammenzuziehen. Nur den Kramer Hensler verfolgten viele Schuldgefühle. Er bot den Zwillingen eine gute kaufmännische Ausbildung in seinem Handelsgeschäft an. Das Erbe der Johanna aber war für Ludwig endgültig beim Notar angelegt. Nur die Buchbinders und Adalbert hatten Verfügungsgewalt. Bis Ludwig mündig werden würde.
Sechs
Ein Stern in dunkler Nacht – Briefwechsel
Groß war die Überraschung, als Elsbeth Altemeier kurz vor Weihnachten 1798 durch die Kaiserliche Reichspost ein Brief übergeben wurde, der schon eine Weile unterwegs war.
»Ich habe eine Nachricht von Sophie erhalten!«, rief sie freudig auf, als sie im Beisein von Ernst und Adalbert etwas ungeschickt, übermütig und aufgekratzt das Siegel erbrach.
Schnell überflog sie die Zeilen und konnte nicht umhin, die Mitteilungen laut vorzulesen, während Ernst und Adalbert sie neugierig anstarrten:
Liebes Cousinchen,
mehr als zwei Jahre sind nunmehr vergangen. In dieser Zeit ist allerhand geschehen und weitere große Ereignisse stehen unmittelbar bevor:
Kurz nachdem wir im Sommer 96 nach Schwerin abgereist waren, heiratete Mutter nach der Scheidung der Eltern den Tenor Adolph Keilholz, mit dem ich bei der Tyllischen Gesellschaft einige bemerkenswerte Auftritte erleben durfte. Zuerst übernahm ich Kinderrollen und wirkte in einem Stück des Schriftstellers und weitgereisten Juristen August von Kotzebue mit. In seinem Drama ADELHEID VON WULFINGEN spielte ich eine Jungen-Rolle. Es gab Gastspiele in Rostock, Stralsund und Petersburg. Dann lernte ich den Principal des deutschen Theaters in Reval kennen, den ich im Januar geheiratet habe. Es ist Johann Nikolaus Stollmers. Seinen Namen habe ich nicht angenommen, denn – ich verrate es nur Dir, liebes Cousinchen – Stollmers ist nur sein Pseudonym als Schauspieler. Eigentlich heißt er Smets von Ehrenstein. Als ehemaliger Bonner Kriminalrichter war er schon einmal verheiratet. Unter seiner künstlerischen Anleitung erweitere ich nun mein Repertoire für unterschiedlichste Rollen in Singspielen, Opern und klassischen Stücken. Am 15. September habe ich ihm einen Sohn geboren: Philipp Karl Joseph Anton Johann Wilhelm macht uns sehr viel Freude. Aber mit einem Säugling ist es auch besonders anstrengend im Schauspieler-Dasein. Vor allem in nächster Zeit wird es viel Unruhe geben: In Reval habe ich von Kotzebue persönlich kennengelernt. Auf seine Empfehlung hin erhalte ich bald eine Anstellung am Wiener Hoftheater, wo er die Direktion übernehmen wird.
Liebes Cousinchen, während dieser Brief an Dich noch unterwegs ist, werden wir vermutlich schon in Wien unser neues Zuhause beziehen. Ich füge diesem Brief ein Billett mit der neuen Anschrift bei. Ich würde mich freuen, wenn auch Du mir von den Ereignissen in Paderborn berichten würdest. Wurde Dein Vater, mein Onkel Franz, inzwischen aus dem Zuchthaus entlassen? Und wie geht es Dir, interessierst Du Dich immer noch für die Schauspielerei?
Wenn Du die Möglichkeit hast nach Wien zu reisen, bist Du bei uns stets willkommen, gerne auch zusammen mit Zwillingsschwester Agnes!
Ein schönes Weihnachtsfest wünscht Dir Deine Cousine
Sophie Antonie Bürger
Erst Monate später fühlte sich Elsbeth in der angemessenen Stimmung, um einen Antwortbrief zu verfassen. Sie hatte viel darzulegen: über die Flucht ihres Vaters aus dem Zuchthaus, über die Erweiterung ihres Freundeskreises durch Ferdinand, über die Entführung des Ludwig und das tragische Ende der Irmtraud, über die neue Wohngemeinschaft mit Ernst, Adalbert und der Katze und über das große Glück, dass sie zusammen mit Agnes beim Kramer Hensler eine Anstellung gefunden hatte, bei der sich die Schwestern ein umfangreiches Kaufmannswissen aneigneten. Für die Schauspielerei sei hingegen kein Platz und keine Zeit mehr in ihrem gegenwärtigen Leben, so stellte sie fest. Dann berichtete sie von den Ereignissen der letzten Monate. Auch Elsbeth konnte einige interessante Enthüllungen preisgeben:
Dein Brief ist das zweite sehr persönliche Schreiben, das ich jemals erhalten habe. Es hat einen sehr weiten Weg zurückgelegt. Und es beschreibt das große Glück, das Dir beschieden ist. Gerade in der Weihnachtszeit habe ich Deine Nachrichten immer wieder gerne gelesen. Sie waren eine gar freudige Überraschung!
Leider wurden die Gefühle, die Deine Mitteilungen entfachten, einige Tage später vom Tod des Josephus Simon Sertürner überschattet. Vielleicht erinnerst Du Dich: Es ist der Vater von unser aller Freund Friedrich Wilhelm. Er starb nach längerer Krankheit kurz vor dem Jahreswechsel, am 28. Dezember 1798. Da er eine mittellose Ehefrau hinterlässt, kann Friedrich Wilhelm die Ausbildung in seinem angestrebten Beruf nicht mehr fortsetzen. Ab Michaelis wird er in Paderborn als Gehilfe in der Cramerschen Hofapotheke arbeiten.
Ferdinand ist ein gestandenes Mannsbild, das am liebsten im Garten von Schloss Neuhaus arbeitet. Aber er hat auch ein besonderes Talent für viele handwerkliche Tätigkeiten. Daher findet er immerzu Arbeit: als Maler, als Tischler, als Schlosser, aber auch beim Hausbau kann er Schwerstarbeit verrichten.
Der Ernst macht seine Lehre in der Hofbuchdruckerei. Alle sind des Lobes voll, vor allem sein Mentor, der Adalbert. Und der Ludwig geht nun in Paderborn ins Theodorianische Gymnasium.
Wie ich schon geschrieben habe, sind Agnes und ich beim Kramer tätig. Zu Ostern sind wir mit ihm nach Lügde gereist. Vielleicht erinnerst Du Dich: Lügde ist eine Enklave des Hochstifts Paderborn im Fürstentum Lippe. Dort sind im letzten Jahr bei einem riesigen Stadtbrand mehr als die Hälfte der Häuser abgebrannt. Trotz dieser Erfahrungen mit dem Feuer und der jahrelangen Verbote durch die Fürstbischöfe halten die Bürger an einer alten Tradition fest, dem Osterräderlauf. Nachdem wir unseren Handel mit einigen Lügder Bürgern abgeschlossen hatten, sahen wir uns das große, sehr beeindruckende Spektakel an. Große hölzerne Räder, die Tage zuvor im Fluss Emmer gewässert worden waren, wurden mit Stroh umwickelt und jenseits des Oberen Tores – wo sich die Dechenbrüder, die Brauchtumswärter, befanden – auf den südlichen Kirchberg geschafft. Auf der Anhöhe wurde den ganzen Tag über gefeiert. Gegen Abend legte man dann Feuer ans Rad und ließ dieses brennend durch den Schiefen Grund von der Höhe ins angrenzende Tal rollen. Bei diesem bestaunenswerten Schauspiel hätte man meinen können, die Sonne oder der Mond fiele vom Himmel.
Doch nichts ist so außergewöhnlich wie das, was mir auf dem Herzen liegt. Auch ich will Dir etwas sehr Persönliches verraten. Seit einiger Zeit genieße ich das Gefühl großen Glücks. Wenn ich eingangs bemerkt habe, dass Dein Brief das zweite sehr persönliche Schreiben ist, das ich jemals erhalten habe, so muss ich ergänzen: Der erste Brief stammt von Ernst. Auch wenn wir nun schon seit einiger Zeit im gleichen Hausstand leben, so hat er es doch zunächst vorgezogen, mir nicht von Angesicht zu Angesicht seine Gefühle zu offenbaren. Vielmehr hat er zu Feder und Papier gegriffen und gleichsam ausgedrückt, was auch ich für ihn empfinde. Schon seit längerem habe ich mich immer wieder dabei ertappt, seine Nähe zu suchen. Ich mag seine zurückhaltende Art, auch wenn mir sein Gemüt manchmal etwas zu melancholisch ist. Aber es ist unverkennbar, dass er auflebt, wenn er mit seinen Freunden zusammen ist, wenn sich sein Förderer Adalbert um ihn kümmert und wenn wir beisammen sind und er mir aus seiner umfangreichen Gedichtsammlung vorliest.
Uns steht nicht der Sinn nach durchtanzten Nächten; wo auch? Aber ich hänge an seinem süßen Mund, der die wundervollsten Verse preisgibt. Stundenlang. EIN STERN IN DUNKLER NACHT hat er diese gefühlvollen und schwärmerischen Liebesbekundungen betitelt. Ich kann nicht genug davon bekommen, wenn wir gemeinsam unter dem Sternenzelt träumen und er mir kundtut, dass ich einen besonderen Platz in seinem Herzen einnehme.
»Auf Ernst können Sie sich verlassen, Demoiselle«, höre ich Madame Sertürner noch gestern sagen und ihr Sohn Friedrich Wilhelm bestätigt diese Ansicht einer weisen Dame: »Ernst ist wenig abenteuerlustig, aber sehr einfühlsam. Er wird gewiss ein stets treuer Ehemann sein.« – Als wenn ich ein solches Loblied auf meinen Liebsten unbedingt benötigte. Ich weiß selbst, was ich an ihn habe.
Wie Du Dir sicher gut vorstellen kannst, genießen wir nun unsere glückliche Zeit. Uns verbindet eine tiefe Zuneigung. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Heute träume ich davon, dass wir unsere Empfindungen mit hinübernehmen in das neue Jahrhundert – auch wenn uns davon noch einige Monate trennen.
Liebe Cousine Sophie, ich wünsche uns, dass wir diese glückliche Zeit lange festhalten können und dass wir sie auch noch erleben, falls wir uns irgendwann einmal wiedersehen sollten.
Alle guten Wünsche für Dich und Deine Familie!
Elsbeth Altemeier