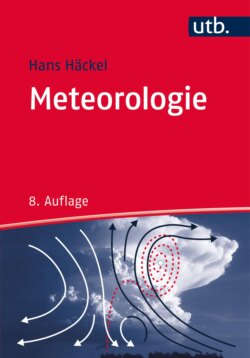Читать книгу Meteorologie - Hans Häckel - Страница 28
Schäden durch troposphärisches Ozon
ОглавлениеWenn hier das troposphärische Ozon so ausführlich behandelt wird, dann liegt das daran, dass dieses Gas als sehr gefährlich eingeschätzt wird:
Trotz seiner geringen Konzentration beträgt sein Anteil am atmosphärischen Glashauseffekt an die 10 %.
Wegen seiner aggressiven Oxidationskraft löst es an allen Oberflächen verstärkt Korrosion aus.
Ozon ist außerdem ein giftiges Gas. Gerade in den letzten Jahren hat man erkennen müssen, dass es eine ganze Reihe von Krankheiten auslösen kann. Sie reichen von Reizungen der Schleimhäute, der Atemwege und des Lungengewebes über Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit bis zu Asthmaanfällen. In Ruhe 35 werden zwar relativ hohe Ozonkonzentrationen toleriert. Bei starker körperlicher Belastung genügen jedoch bereits Konzentrationen von 180 bis 240 µg/m3 Luft, um Körperreaktionen hervorzurufen. Allergische Personen reagieren auf Ozon besonders empfindlich.
An Pflanzen treten ab 80 ppb – das ist ein Wert, der bei strahlungsreichem Sommerwetter in unseren Breiten häufig überschritten wird – offensichtliche Schäden auf, sogenannte „Wetterflecken“. Sie zeigen an, dass Zellkörperchen, die den grünen Pflanzenfarbstoff tragen (Chloroplasten) sowie Zellwände, zerstört sind (Berge und Jaag 1970). Zu versteckten Schäden, die aber zu einer Hemmung der Fotosyntheseleistung führen und sich damit bei landwirtschaftlichen Nutzpflanzen in Ertragsrückgängen bemerkbar machen, kommt es schon bei geringeren Konzentrationen. Heagle (1989) berichtet über Versuche mit einer künstlich auf 40 bis 50 ppb (gegenüber 30 ppb) erhöhten Ozonkonzentration. Dabei musste man bei empfindlichen Winterweizensorten Ertragseinbrüche bis zu einem Drittel hinnehmen. Bei robusteren Sorten fielen die Verluste mit etwa 10 % jedoch nicht so krass aus. Sehr empfindlich sind jedenfalls auch Soja, Baumwolle, Tabak, Bohnen und Kohl.
Offensichtlich ist Ozon auch an der Schädigung der Wälder beteiligt. Seine Rolle stellt man sich dabei folgendermaßen vor: Zunächst werden die Wachsschichten der Nadeln und Blätter von gasförmigem oder in Wasser gelöstem Ozon oder anderen Fotooxidantien aufgebrochen. Durch die dabei entstehenden Risse gelangen die Gase ins Innere und führen zu Schäden an den Membranen und Spaltöffnungen. Dadurch kommt es zu Störungen im Wasserhaushalt. Gleichzeitig dringen auch saure Niederschläge ein und waschen lebenswichtige Calcium- und Magnesiumverbindungen aus (Leaching-Hypothese). Pahl und Winkler (1993) haben festgestellt, dass die Konzentration schädlicher Spurenstoffe im Wasser von Wolken und damit auch von Nebel bis zu 10-mal so hoch sein kann wie im Regenwasser.
Technisch und medizinisch wird Ozon für verschiedene Zwecke eingesetzt:
Zur Beseitigung von unerwünschten Luftbeimengungen wie Geruchstoffe, Bakterien, Viren, Sporen usw. Dabei wird alles zu beseitigende vom Ozon oxidiert.
In Schwimmbädern wird Ozon benutzt, um Krankheitserreger und unerwünschte Substanzen im Wasser durch Oxidation zu beseitigen. Der unangenehme Chlor-Geruch, den man von vielen Schwimmbädern her kennt, lässt sich dadurch vermeiden.
Auch zur Reinigung von Trink-, Prozess-, Kühl- und Abwasser wird es verwendet.
Bei der sogenannten Ozontherapie wird Ozon eingesetzt, um Krankheitserreger zu eliminieren. Die Ozontherapie ist jedoch nach wie vor stark umstritten (nach verschieden Quellen).
Zwar bietet das chemische Milieu der Großstädte die beste Voraussetzung für die Ozonbildung. Man spricht in diesem Zusammenhang gern von Fotosmog und nennt als Musterbeispiel den Los-Angeles-Smog. Da die Sonnenstrahlung eine wesentliche Voraussetzung für die Synthese von Ozon und anderen Fotooxidantien ist, entstehen diese Stoffe aber auch in den strahlungsreichen Reinluftgebieten weit außerhalb der Städte in unerwartet hohen Konzentrationen – selbst dann noch, wenn der Wind die dorthin verfrachtete Großstadtluft schon weitgehend verdünnt hat.
Im Lauf der nächsten Jahre werden sich die Ausgangsstoffe für die Ozonbildung aller Voraussicht nach weiter anreichern. 36 Wir haben deshalb in Zukunft mit noch viel höheren Ozonwerten zu rechnen als heute.
Die Betrachtungen zu den luftchemischen Auswirkungen der Atmosphärengase mussten hier stark pauschaliert werden. Die Zahlenwerte stammen aus verschiedenen Quellen. Ausführliche Informationen zu diesem Thema findet man im Abschnitt „Weiterführende Literatur“ ab Seite 431, dort insbesondere bei Fabian (2002), wo sehr viel zur Vertiefung geeignete Literatur aufgeführt ist.