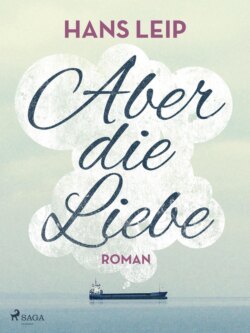Читать книгу Aber die Liebe - Hans Leip - Страница 7
Drittes Kapitel
ОглавлениеIch merke, Mister Bit, Sie horchen nach draußen. Nein? Nur zugleich?
So geht es mir auch. Alles Gesagte ist nur zugleich. Und sollten alle Stricke reißen, die uns mit gehabten Ereignissen zu einem Bündel Vergangenheit machen, sollte unsere eigene Mumie sich jählings auswickeln und unsere Gegenwart beschlagnahmen, was tut’s. Wir sprechen: Guten Tag! Und lassen es hingehen.
Was bleibt uns denn viel als die betagte Funkverbindung zur Ewigkeit, die schon war, bevor sich unser erster höherer Primat auf die Hinterbeine stellte und nicht mehr herunterwollte, weil seine Handteller und Fingerknöchel verweichlichten und er erkannte, wie sehr Selbsterhöhung die Rassegenossen einschüchterte. Bis er in der Olduvaischlucht ins Gras biß. Immerhin ins Gras. Das ist seltener geworden. Und an die sechshunderttausend Generationen her gerechnet vom Miozän, soviel ich noch weiß, bis zur direkten Mondbelästigung. Nur für einen Computer übersehbar.
Ich kannte einen Badewärter, der konnte wie ein Bär auf allen vieren gehen und nicht nur im Paßgang, und er äußerte, es sei viel angenehmer auf die Dauer, und er würde immer nur so sich bewegen, wenn es der Anstand nicht verböte.
Wir haben die alten Antennen, die unsichtbar sind wie bei einem guten Transistor, nur ein bißchen verkalken lassen. Mit Stalagmiten ist schlecht senden und empfangen. Darum hat sich unsere Sprache entwickelt und verkalkt nun auch schon wieder. Wir berieseln und werden berieselt und beachten es noch kaum. Was bleibt, ist ein bißchen Gekrächze. Die Musik ist schon soweit. Der Urwald nimmt uns auf, der Urwald der Hochhäuser und Industrie. Nur das eine hat Bestand, die Neigung, sich in Szene zu setzen, Huldigungen einzuheimsen und jede Schuld von sich abzuschieben.
Als ich in jenen Tagen, wo jedes Tischmesser wie ein Seitengewehr aussah, in der Tafelrunde Zum minnigen Seil – oder war’s am Stammtisch der Duftenden Kompaßrose? – egal, und sodann sogar in der Bürgerschaft meine Ansicht also über einen ernsthaft friedlich gewillten Weltvölkerbund darlegte, da fühlte ich eine törichte Vorstellung aus Angelesenem in mir, als sei ich der von Dante so herzlich begrüßte Heinrich der Siebente, begrüßt vom besten aller Italiener als der Herrscher eines freundlich geeinten, kirchlich unabhängigen Europa. Er kam zu Schiff nach Rom wie später mal Ihr Admiral Horatio Nelson, dem ähnliches vorschwebte, von Great Britain aus. Doch der deutsche Heinrich wollte sich alsbald zum Kaiser krönen lassen. Und weil der Weg zum Petersdom versperrt war, begnügte er sich mit dem Lateran. Das war ein Zugeständnis wie von Ost-Berlin anstatt von Moskau. Der Dante-Traum blieb ein Hirngespinst. Heinrich starb unter dem Turm von Pisa. So schief war es gegangen. Er starb jung.
Wir aber leben noch, Mister Bit. Und es hat sich nichts geändert in siebenhundert Jahren. Die alte Bestie bleckt noch immer die Zähne, so falsch sie auch sind. Wir weinen nicht? Sehr zum Wohl, Mister Bit! Versuchen wir zu lachen, solange unser Zwerchfell nicht gänzlich zum Trommelfell hinauf- und herabgewürdigt ist und, von Doktrinen und Parolen gewalkt, nur noch die paar Begriffe und Zustände weitergibt, die schon lange auf uns lauern und die da lauten: vermummt, verdummt, verstummt.
Als ich die jetzige Firma aufmachte, mit Eintragung ins Handelsregister, versteht sich, und mit Börsenstand, da schrieb ich nach hansischer Sitte auf die erste Seite meines Hauptbuches: Mit Gott! Wir haben trotz aller Eigenständigkeit nie ganz auf Verbündete verzichtet. Ich war mir allerdings klar, welche Verantwortung ich damit einem imaginären Vorgesetzten zuschob, ohne doch geneigt zu sein, mir viel dreinreden zu lassen. Es war ein Verhältnis, wie wir es in Hamburg zum deutschen Reiche pflegten. Wir erwarteten Schutz und Beistand und taten, was allein wir für löblich erachteten. Die weite Welt vor uns, das Vaterland im Rücken, manchmal tiefer.
Kalkül und Macht und Recht,
wer damit handelt frei
und hat noch Glück dabei,
dem geht es niemals schlecht.
Manchmal blieb das Glück aus. Derlei passiert überall mit und ohne Reich. Bei uns vorübergehend. Denn wir liegen günstig an einem Fährweg zwischen gutem Hinterland und allen Kontinenten. Und wir dachten nicht kleinlich, nachdem wir die großen Entdeckungen verpaßt hatten und uns Freie und Hansestadt nannten, wir lernten, in Kontinenten zu denken. Gen West, woher aller Zonen Dunst und Duft wehte, gen West, wo der Abendhimmel sich in Farbspielen gefiel, gemischt aus Polarlicht und Tropenzauber, und so unsere Reichweite spiegelte, dahin ging unser Kalkül und fand sich auf die Dauer gesegnet.
Das menschliche Wohlbefinden als belanglos hinzustellen, mag einer Abendmahlspredigt zum Thema dienen, einem hansischen Kaufmann steht es nicht zu Gesicht. Auch die These, niemand soll mehr haben als der andere, mag für den Mond gelten, wo sowieso keiner etwas hat. Auf Erden regiert der Tüchtige. Und der Tüchtigere löst ihn ab. Und der weniger Tüchtige hat sich anzupassen. Wer klug genug ist, macht auch aus der Anpassung einen schicklichen Unterschlupf. Wer dumm ist, hilft sich auch mit Pöbelei auf keinen grünen Zweig. Er entblättert ihn höchstens. Selbstredend gehn wir an unsern klimamilden Küsten nicht so weit wie unsere südamerikanischen Abnehmer, die da sprechen: Der Kluge lebt von den Dummen. Und die Dummen? Von der Arbeit.
Wir sind fleißig von Natur. Angeheizt vom Atem der alten Midgardschlange, dem Golfstrom. Das sagte ich schon. Insgeheime Treibhausblüten sind wir, aber wir haben gelernt, uns einigermaßen auch im Freiland zu behaupten. Dazu eben bedarf es der ständigen Umsicht und Fürsorge. Das braucht uns niemand beizubringen, immer auf dem Kiwiev zu sein. Das turbint sich unaufhörlich über West herein, kleine dienliche abseitige Wirbelschleife, uns sowenig bewußt wie die sausende Drehung des Erdballs
Wir sitzen auf golfischem Teufelsrad,
wo jeder sich mühsam zu halten hat.
Das hangelt und rangelt zur Mitte juchhe
oder wird abgeschnippt gen Übersee.
Gibt wohl keinen von uns, der einiges geworden ist, ohne mal draußen und drüben gewesen zu sein, quer übern Atlantik, Nord oder Süd, und um Kap Hoorn herum oder um die Gute Hoffnung oder durch den Panama oder – solange euer England noch Grips und Bizeps besaß, die Fellachen in Zügel zu halten, und Rußland noch nicht deren Steigbügelhalter und Raketenlieferant war – durch den Suez in die indische See und übern Pazifik und rund um die Welt.
Heute geht’s einfacher per Avion. Ohne mich. Ich erobere mir die Breiten- und Längengrade noch immer lieber im Seefahrtstempo, wie Sie, Mister Bit. Veraltet sein und Unvernunft ist nicht immer dasselbe. Man muß es sich nur erlauben können.
Traf ich auf Hawaii oberhalb der Region, wo einem Hula-Hula-Kränze um den Hals gehängt werden, einen, der als Stift bei hiesiger Maklerfirma mir nicht sonderlich aufgefallen war. Hallo! sagte er und blickte auf von seiner Ananasplantage.
Hallo! sagte auch ich: Und was machen Sie denn hier?
Er erwiderte sachlich: Ich lege den Grundstock für ein Häuschen an der Elbchaussee. Und Sie?
Ich? So ähnlich.
Tatsächlich war ich damals drauf und dran, in Honolulu eine Art Rummelplatz aufzubauen, nachdem ich außer Restbeständen aus eigner Werkstatt über eine Menge solider Karussellfiguren aus dem Konkurs der Junopark AG verfügte. Mir schwebte eine Alterszuflucht in Blankenese vor. Ich habe sie erreicht. Auch ohne die Südsee mit meinem Ringelspiel zu beglücken.
Lassen Sie mich zurückrutschen ins Jahr 1893. Wir hatten die fürchterliche Cholerakatastrophe hinter uns. Der Ostwind hatte sie begünstigt, der Westwind schließlich zum Teufel geblasen. Das brauche ich Ihnen nicht zu schildern, Mister Bit, dergleichen hat Ihr Robinson-Defoe aus Londoner Erfahrung schon schaurig deutlich berichtet. Aber seitdem wurde in Hamburg das Trinkwasser besser. Und es war ein Landsmann von Ihnen, der uns dazu verhalf. Er lebe!
Also gegen Jahresende kam Professor Lichtwark zu meinem Vater. Alfred Lichtwark, Direktor unserer Kunsthalle, einer der wenigen Weltleute von kulturellem Rang, die Hamburg hervorgebracht. Wer hat sonst auch viel Zeit dafür. Also dieser elegante Herr stand plötzlich wie ein auftraggebender Reeder in unserer Werkstatt, füllig und selbstbewußt.
Ich war erst fünf, aber ich habe die Erscheinung ziemlich klar im Gedächtnis. Seinen Zylinderhut hatte er der »Galatea« aufgesetzt, sah dann meinen betroffenen Blick, nahm ihn herunter und stülpte ihn mir sachte über den struppigen Schädel. Er sackte mir auf Ohren und Nase. Denn mit dem strammen Bauernschädel des Müllersohnes aus den Vierlanden konnte ich mich noch nicht messen. Des weiteren stak der Besucher in einem schwarzen Mantel, darunter sah man eine gestreifte Hose und militärische Offiziersstiefeletten. Es ging auch ein guter Duft von ihm aus, ich nehme an, es war seiner anglophilen Neigung gemäß ein Lavendel von Dobb’s. Sein steifer weißer Kragen hatte die Oberkante dreieckig heruntergebogen. Darunter war ein breites schwarzes Plastron, leicht geblümt, und es stak eine große Perle darin. Ein Gentleman fürwahr. Aber das hab’ ich erst später summieren können.
Damals fiel mir besonders das Spiel seiner Glacéhandschuhe auf. Er begleitete hin und wieder ein Wort damit, unterstrich, strich aus, kreiste ein. Er gab der Galione Galatea einen zärtlichen Klaps auf den wohlgerundeten Arm und strich dann über die holzgewellte Mähne eines Karussellpferdes.
Hier wurden vormals doch nur Galionsfiguren geschnitzt, Meister! sagte er und blickte meinen Vater aus etwas verkniffenen, stets visierenden blaß blitzenden Augen an, als sei der selber ein altes Holzbild. Und in der Tat, mein Vater hatte den Ausdruck eines verwetterten ducknackig vorweg spähenden Meergottes, schwerfällig in Bewegung und Sprache, aber immer zielsicher und von feinster Fähigkeit der Hand. Er, und das fiel mir damals schon auf, trug seinen Schnurrbart dem des Galerieprofessors ähnlich, nur ergraut, an den Ecken gestutzt, sogenannt fußfrei, und nicht wie der des Staatsoberhauptes mit aufgerichteten Bajonettspitzen, sondern mehr auf englische und amerikanische Manier, und erst später den patriarchalischen Vollbart.
Mein Vater fragte so bedächtig, wie es bei erwartbarer Bestellung geraten ist: Wollen der Herr erst bauen oder haben schon?
Aber Lichtwark fragte weiter: Seit wann arbeiten Sie denn für den Jahrmarkt, Meister?
Seit Eisen Holz verdrängt, da braucht die Schiffahrt kein Schnitzwerk mehr, murrte mein Vater: Da muß man sich anderweitig umsehn. Und der Herr wollen trotzdem?
Der Herr, von dem wir, mein Herr und ich, damals keine nähere Ahnung hatten, fuhr in seiner geschmeidigen, doch wie eben aus Urgrund geborenen Sprechweise fort: Bester Meister, in der Kunst kommt keine Auferstehung zu spät. Unser Kaiser hat seine Luxusjacht soweit fertig, die »Hohenzollern«. Was fehlt, ist doch wohl eine zünftige Galione. Reeder Ballin möchte ihm eine stiften, ich soll es fachlich vermitteln, und wer könnte uns da das Rechte fertigen wenn nicht, Meister, Sie, der Letzte aus der ehrwürdigen Dynastie der Abdenas und Toppendralls.
Dabei denn streifte aber sein Handschuh und Blick mich, der ich gespannt mich nicht zu rühren wagte. Und ich hörte, wie ich als womöglicher Erbe eines aussterbenden Gewerbes weniger bedauert als angespornt wurde. Und ich reckte mich, nahm den großen Hut ab, wies auf die vorgebeugt hingelehnte und abgestützte Nymphe und äußerte kühn: Bei der hab’ ich schon mitgeholfen. Sie heißt Galatea, ihr Vater war ein Seekönig, und sie hatte neunundvierzig Schwestern. Und ist nicht abgeholt worden. Die können Sie kriegen.
Mein Vater gebot mir zu schweigen. Indes der Fremde mir übers Haar strich und lächelnd meine Kenntnis lobte und meine handwerkliche Neigung. Jedoch die schöne Galatea sei nicht das, was ihm vorschwebe oder vielmehr der Hohenzollern voranschweben solle. Er denke allerdings auch an eine weibliche Figur, diese hier sei nun freilich zu nackt für die strengen Auffassungen des Monarchen und vor allem seiner Gattin. Darum denke er mehr an ein Porträt Ihrer Majestät höchstselber in gewachsenster Volkskunst und also Volkstümlichkeit. Mein Vater kratzte sich hörbar den sturen Schnurrbart, nickte verhalten und erwog: Machen könnten wir das. Und man sollte preußisch Holz dafür nehmen, das hält aber den Wogenprall nicht lange aus, es müßte schon Pitchpine sein oder Teak, polnische Föhre geht auch, da haben wir unser Rathaus mit unterpfählt wie manches hier, damit wir nicht im Schlick versacken.
Nein, nein, es wird das Heimische zu bevorzugen sein! versetzte Lichtwark: Ulme, Rüster, Ahorn, Linde, Eiche. Eiche natürlich, deutsche Eiche, die zugleich der britische Baum ist, das wird den Beifall des Hofes und dessen prüder Verwandtschaft finden. Aber halt! Die Hapag baut sowieso eine »Auguste Viktoria«. Was machen wir denn da? Eine strotzende Germania an sich? Da könnten wir schließlich sogar diese »Galatea« ...
Ich schlage vor, sagte da mein Vater, wir nehmen Frau Petersen. Wenn Herr Petersen, unser guter Bürgermeister, so scheußlich von einem Berliner gemalt worden ist, dann ist das vielleicht ein Ausgleich.
Ob das nun ernst gemeint war oder nicht, unser eleganter Besuch verfinsterte sich und verabschiedete sich gewinnend, aber kurz. Keine Rede mehr von Auftrag. Zu spät erfuhren wir, daß er es gewesen war, Max Liebermann mit dem lebensgroßen Ölbildnis unseres regierenden Stadtstaatlenkers zu beauftragen und das nun niemand leiden mochte. Es sollte erst viel später zu Ehren gelangen, als man sich selbst in der Hansestadt an die ungewohnt unglatte Art solcher Moderne, genannt Impressionismus, gewöhnt und vor allem davon gehört hatte, welch Geschäft solches sehr bald dem Kunsthandel und dem Liebhaber und Sammler bedeutete.
Der Maler hat’s gemalt,
ein Liebhaber hat’s bezahlt,
er zahlte nicht viel,
weil’s eben nur ihm gefiel.
Als aber der Kunsthandel das Bild entdeckt,
da hat es goldene Eier geheckt.
Ich glaube, die »Hohenzollern« hat sich dann mit einem Reichsadler begnügt, natürlich in Bronze vergoldet. Aus Untertanenschweißgold, nannte es der kleine Maler Fred von Hörschelmann, der aus dem Baltikum stammte und in Bayern lebte und eine spöttische Zunge hatte. Er lachte über die entgangene Wotansgöttin so, wie er später im Old Commercial Room, der Kapitänstaverne an der Hafenrampe, lachte, als er das Horst-Wessel-Lied mit dem, wie er behauptete, eigentlichen, einem alten Räubertext, lauthals sang, obwohl er Gast war des hansischen Landesgerichtspräsidenten R. Johannes Meyer. Dieser war ein Kunstfreund und war kein Freund eines alten oder neuen Potsdamer Geistes. Und ich war dabei, denn der Gnom Hörschelmann sammelte Zirkusplakate, wie sie so plankengroß anscheinend nur in Hamburg hergestellt wurden, mit Indianerschlachten darauf und Bajaderenorgien, die alles in den Vorstellungen Gebotene weit übertrafen. Ich hatte solche Riesenaffichen auch mal gesammelt und gab sie dann gern dem eifrigen Liebhaber, der unter der Rolle von dannen wippte wie ein Eichhörnchen mit dem Ofenrohr.
Ganz recht, Mister Bit, dieser Rotspon stammt aus Gefilden, die noch keinem Vertreter chemischer Spritzmittel zum Opfer gefallen sind und keine Pantscherei kennen. Und ist sicherlich hinreichend wogengeschaukelt, vielleicht sogar noch zu Zeiten des Laeiszdirektors Ganzauge einmal um die Erde gelangt, mit den letzten unvergeßlich malerischen Weizenseglern. Unser Container-Reeder wußte, was er uns an Bord vorzusetzen wagen durfte. Und es müssen Holzgebinde sein, darin solch Tropfen sich lagert und heranreift. Das ist die zweite Traubenreife, die innere, nach der sommerkurzen der ersten, die lange lange Zeit. Bis dann die dritte Reife und die allerfeinste sich gelegentlich vollzieht, die hohe Vergeistigung in jenen, die danach sind.
Sind wir danach, Mister Bit? Wer kennt sich und den Nächsten. Lassen wir es beruhen! Wir müssen einander die Weile ertragen. Wollen nicht von Vergeistigung schwatzen. Wollen den alltäglichen Dingen abgewinnen, was uns die Langeweile verkürzt. Sie nicken mir zu. Uns! bekräftigen Sie. Uns! Ob auch andern, soll uns Mausespeck sein.
Whisky? Ganz recht, Mister Bit, er dämpft das feine Empfinden. Und was auch immer, ein guter Tee ist besser als jedes sonstige Stimulans, und das beste ist und bleibt ein treffliches Wasser. Dennoch, nicht wahr? Zum Wohl denn!
Hoppla! Ihr Glas! Es tänzelt wie so manches, das an uns vorbeiglitt und uns verheißungsvoll gelächelt. Wir hielten es, es war unsere Freude, wir hielten es für unser ein und alles, und es wehte davon wie eine Flocke Gischt, indes das große Orchester der Welt weiterspielte, ungerührt wie die See.
Da fällt mir Kapitän Menck ein, Freund meines Urgroßvaters Justus Toppendrall. Er war zugleich Eigner einer stattlichen Brigg, Großvater hatte ihm die Galione geschnitzt, eine Löwin mit dem hübschen Gesicht von Käptns Braut. Die nämlich hatte eine Löwin gewünscht, er aber das Abbild seiner Felissa. So hatten sie sich auf eine Mischung geeinigt. Die Hochzeitsfeier fand statt auf dem fertig bei den Kajen liegenden Segler.
Felissa war aus gutem Pöseldorfer Hause und hoch musikalisch und für jene Tage ungewöhnlich abenteuerdurstig, sonst wäre sie Jonny Menck wohl kaum gefolgt. Und wollte auch die Jungfernreise seiner Brigg Felissa mitmachen.
Menck, ihr zu gefallen, sorgte auch für ein Instrument. Ein Klavier wäre zu sperrig gewesen in der kleinen Messe. Aber er trieb ein zierliches altes Spinett auf, was damals aus der Mode war und billig, ließ es herrichten und an Bord schaffen.
Um mit seiner Erwählten gehörig tanzen zu können, sah er sich nach einem Tastenkenner um und entdeckte einen solchen bald in einer der Hafenkneipen, einen schmächtigen jungen Menschen mit schlicht herabhängendem, blondem Haar, der dort den Matrosenverkehr mit Gassenhauern für »twee Dollar un duhn« bereicherte und nebenbei seine Schularbeiten zu erledigen schien. Er war noch fast ein Knabe, noch nicht fünfzehn und hatte statt der Noten ein Buch vor sich liegen, bißchen Goethe oder so was, spielte also alles Gewünschte so nebenher und auswendig. Dabei auch manches, was niemand bislang je gehört hatte und das wohl aus der Phantasie stammte.
Dieser tüchtige Jüngling, Sohn eines Hornisten bei der Bürgergarde und Baßgeigers beim Operntheater, wurde nun für Mencks Hochzeitsrummel herbeigezogen und stellte die Geduld der Gäste anfangs höchst eigensinnig auf Kohlen, indem er das Spinett erst mal genau stimmte, bevor er mit der Polonaise begann und zu jedermanns Beifall spielte.
Doch die Messe erwies sich rasch zu eng, zumal für den Walzer, und so wurde das Instrument auf Deck getragen. Der Musikant half bereitwillig mit, dann aber betrachtete er kritisch seine Hände, bewegte sie wie auffliegende Tauben und erklärte, er könne nicht sofort weiterspielen. So denn füllte die bräutliche Schöne die Pause. Es fand sich auch gleich eine ältliche Verwandte für einen Gesangsvortrag. Und es erklang das Lied »Wenn ich ein Vöglein wär und auch zwei Flügel hätt’/flög ich zu dir ...«
Die alte brave Dame sang gern, aber nicht gut. Dem jungen Musiker schmerzten die empfindsamen Ohren. Er flüsterte meinem Großvater zu, der neben ihm auf der Reling saß: Wenn ich ein Kater wär und auch vier Tatzen hätt’, schlich ich zu ihr.
In jenen Tagen war der Hafen noch von keinem Motor und Schneidbrenner und Preßbohrer durchtobt, und die Abende pflegten noch Arbeitsruhe zu kennen. Somit war sogar ein zartes Spinett, vorm Großmast aufgestellt, zum Tanz vernehmlich genug. Der junge Virtuose war auch bald wieder dabei, das Beste herauszuholen an Polka, Schottischem, Hornpipe und Green Sleeves und was alles damals in Mode stand. Zwischendurch flocht er – wie gesagt – Eigenes hinein, ohne daß es auffiel. Er hieß übrigens Johannes Brahms, wohnhaft in der Speckstraße beim Bäckerbreitengang. Heute steht da der Wolkenkratzer eines Margarinekonzerns, nachdem eure Bomben, Mister Bit, die Gegend in Schutt gelegt. Pietät? sagen Sie. Oh, so etwas ist selten, im Kriege wie in Hamburg.
Meinem Großvater, der zu Hause manchmal Flöte blies, war immerhin eines im Gedächtnis geblieben, und ich weiß noch, wie er das Motiv zur Unterstreichung seines Berichtes herzuzaubern versuchte, dieses dodade de dideida ... Es ist aus Opus 119; soviel ich weiß, das zweite Stück; es ist eins seiner rührendsten Einfälle, diese kleine Melodie, ein Stück Westwind mit aller Süße, Wehmut und Sehnsucht. Er kannte die See nur aus den Schnacks und Aufschneidereien, aus dem Seemannsgarn der Tavernen, und das mag ihn früh und gründlich bewahrt haben, seine Seele verledern zu lassen – wie es dem Feinfühligen bei dem härtesten aller Gewerbe, der Seefahrt, wohl geschehen kann.
Aber wir an der Wasserkante sind nun mal nicht frei von der Anfälligkeit, nach dem Glück und dem Unheil der Ferne uns zu verzehren. Er ging gen Ost denn auch davon, sozusagen rückwärts, mit dem Blick zur See. Aber trotz späterem Vollbart mit Zigarre spürt man doch in all seiner Schöpfung dieses sonderbare Ziehen und Säuseln aus West, den ungesättigten Horizont, die unbehauste Dünung, den grauen, spärlich durchsonnten Heimathimmel.
Sie sollten mal eine Reise mitmachen, junger Mann, mal die Nächte im Passat erleben, hatte damals Kapitän Menck gesagt, als er ihm drei blanke Taler Honorar zahlte: Kost und Logis frei, wenn Sie meiner Frau ein bißchen Noten umblättern und mal vierhändig oder wie und sonst hier und da mit anfassen, wie es so hinkömmt ...
Aber der junge Johannes hatte abgelehnt. Er hat ja auch nicht mal die Einladungen zu euch angenommen, Mister Bit, wie sein Landsmann Mendelssohn. Es ging ihm ja auch gut auf dem lieben Festland. Wollen zum Beispiel der Schweiz dankbar sein, wo er in Zürich und Winterthur sein Deutsches Requiem sorglos hat fertig vertonen können, betreut vom Verleger Rieter. Wer wohl in seiner Vaterstadt wäre auf solche Idee gekommen? Man hat ihm ja nicht mal – sogar zweimal nicht – den freigewordenen hiesigen Dirigentenposten gegönnt. Er war eben nicht weit genug her. Erst der dickste Weltruhm mußte ihm bescheinigen, daß ein geborener Hanseat auch etwas Rechtes mit den Musen zu tun haben könne.
Brahms ward hier geboren
und ging uns verloren
und starb in Wien.
Aber dennoch sind wir mächtig stolz auf ihn.
Das gibt es auch bei Ihnen, Mister Bit? Na ja, Cromwell war unmusikalisch. Und Händel und Haydn waren als Ausländer so geschätzt wie gewissermaßen bei uns Rolf Liebermann, der unsere Staatsoper leitete, aus der Schweiz stammt und nach Paris ging.
Johann Sebastian Bach aber ließen wir entgleiten, obwohl er geblieben wäre. An der Wasserkante sagt man übrigens auch so, wenn einer bei der Seefahrt umkommt. Händel hatte es sowieso nicht lange ausgehalten, wohl aber der Magdeburger Telemann. Und warum? Er hatte nicht nur ein breiteres Sitzfleisch, sondern viel inneren Humor und ein dickes Fell. Damit kommt in Hamburg selbst ein Künstler nicht unter die Räder und überzeugt sogar Senatoren, Oberalte nebst allhier geborenen Ehehälften.
Und Theater? Hier gab es immer bedeutende Ansätze. Den Gaukler läßt man sich nach Büroschluß selbst hier gelegentlich gefallen. Sie sagen Lessing, und ich verhülle mein Haupt. Sie sagen Klopstock, und ich gebe zu, er verzehrte hier eine dänische Rente und eine aus Süddeutschland, sonst wäre er nicht an die Achtzig gelangt. Sie sagen Hebbel, und er ging wie Brahms davon. Und Sie kannten sogar Alexander Zinn? Und fragen, ob er wirklich ein Dichter gewesen sei und Senatsdirektor und Pressechef nur als Gnadenbrotnehmer? Er war ein umgänglicher Herr und ein Schriftsteller von Rang wie mancher andere auch. Was wiegt das schon, Mister Bit?
Klopstock und Lessing
hatten Großes mit Hamburg im Sinn,
aber Gold wird hier gern zu Messing
und Silber zu Zinn.
Wollen doch gleich anerkennen: Was Repräsentation ist, das läßt man sich hier nicht entgehen, das ist wie andernorts, nur deutlicher, wie die zwei, drei aufgestauten Alsterbecken, die doch einen enorm teuren Baugrund aus purem Luxus zu Wasser werden lassen. Aber wo sollen die jungen Leute sonst segeln lernen; auf der Elbe ist es mit Flut und Ebbe nicht immer so bequem und nett vor der Tür. Und irgendwas Besonderes wollen die Fremden ja bestaunen, da man Sehenswürdigkeiten, die man in Bremen etwa oder in Lübeck hegt, alte Stadttore und Klostergebäude und so was, in Hamburg schon vor dem großen Brand umgelegt hat oder auch nachher noch. Eure Bomber brauchten in dieser Hinsicht nicht viel nachzuroden.
Die wir mit der großen Schiffahrt zu tun hatten, wo alles rauh, sachlich, grob und unaufhaltsam ist, wir liebten die stillen Alstergewässer wie eine Unwahrscheinlichkeit, die zu hübsch ist, als daß man sich laut zu ihr bekennen dürfte. Es war etwas Insgeheimes, das eigentlich hier nicht zu sein hatte, das womöglich zerrann, wenn man es als Besitz anzusprechen sich getraute.
Längs Gurlittstraße, Alstertwiete und um die Ecke Koppel und die Straße neben der Reihe Linden an der Alster hin, wie war das bedrängend fröhlich in meiner Kindheit. Der gute Butterduft aus den Kellerküchen der Villen war noch von keinem Autodunst überstunken, und die hervortönenden Schmachtlieder der Kökschen und Dienstmädchen wurden durch etwas Hufgetrappel nur herausfordernder. Heute vernimmt man dort keinen Gesang mehr – und nicht nur wegen des Verkehrslärms nicht. Doch damals wie heute gehört zum guten Ton der guten Familie, die ich damals höchstens durch die Hintertür erspähte, sich als musikliebend auszuweisen, wozu ein Dauerplatz bei den behördlichen Konzert- und Opernaufführungen beliebt war. Wenn auch der Gatte von Börse, Büro und Handesgeschäft abends müde war und vor sich hin dämmerte und mehr an die überseeischen Märkte als an die Darbietungen der Bühne dachte, auch das lästige Umziehen nicht so liebte, wie zum Abend bei euch üblich, Mister Bit, damals noch, und seinen Frack oder Smoking jahrelang trug, falls die Statur nicht zu sehr schwoll, so war es den Damen ein Sonderlabsal, das Hauswesen zu vergessen und in festlichem Kreise zu sehen und gesehen zu werden. Und jedesmal möglichst in anderer staunenswerter, wenn auch, wie hier üblich, trotzdem dezenter Aufmachung.
Wenn wir in unserer ständigen Loge sitzen,
sagte Madame Smit,
lassen wir unsere Brillanten glitzen.
Das verdeckt erstens unsere Bildungsritzen,
und zweitens glitzen wir ein büschen mit.
Je klüger, desto verhaltener. Aber das vergißt sich leicht. Lassen Sie mich dessenungeachtet nicht verhehlen, daß Weltruhm ungemeine Summen verschlingt. Um das Niveau über Null zu halten, bewilligt der Senat der Oper wie dem Philharmonischen Orchester jeden gewünschten Auftrieb, natürlich nicht betreffs heimischer Kräfte. Der Dirigent des Ballettmanagers Diaghilew, Ernest Ansermet, leitete hier Debussys Pelléas und Mélisande und dirigierte ein Jahr darauf, er wurde gerade achtzig, die Philharmoniker. Auch den greisen Polen Strawinskij erlebte ich am Pult der Staatsoper, aber seine Kompositionen erschreckten mich teils, teils verschlief ich sie. Es war ein biblischer Stoff, soviel ich mich entsinne.
Ich schäme mich meiner Bildungsritzen keineswegs, so hab’ ich doch Platz, sie mit eigenem Hanf auszufüllen, ohne Rücksicht, ob jemand außer mir sich daran gütlich tut. Was der Österreicher Alban Berg sich an Georg Büchners Woyzeck erklettert oder an Frank Wedekinds Lulu, gefällt mir besser. Das ist handfeste Auslegung und glanzvolle Erleuchtung, das ist beste musikalische Illustration, zu einem Text von Rang und Format, dem Gemüt wie dem Hirn noch faßbar und genehm.
Begehren Sie mehr? Sind wir nicht alt genug, äußern zu dürfen: Krach, elektronischer Geräuschsalat und bemühte Verrenkung entzücken uns nicht? Möge sich die Jugend daran austoben! Wir sind mit unserem altbackenen Geschmack zufrieden. Und glauben denn doch, nicht ganz ohne Maßstab zu sein für das, was gut ist und sein wird immerdar.
Lassen Sie mich meiner Mutter gedenken. Sie besaß keine Brillanten, aber ihre Herzensbildung war lückenlos. Nur ein einziges Mal ist sie im Theater gewesen, zu einem Weihnachtsmärchen im Deutschen Schauspielhaus mit mir und meiner großen Schwester, die es bezahlte, da sie schon etwas verdiente, nämlich als Aufwaschmädchen bei Dabelsteins, Südseeimport. Senator wurde er erst später. Es war die Zeit, als mein Vater einen Unfall gehabt beim Anbringen der reparierten Lady Pontomac an jenem Vollschiff, das gerade umgetauft worden war in Oleandra. Das schien dieser üppigen Figur zu widerstreben, sie löste sich unversehens vom Bug und hätte meinen Vater fast erschlagen. Er war damals schon selbständig, und keine Kasse zahlte ihm etwas und keine Versicherung; man warf ihm eigenes Verschulden vor, ohne Ahnung, welche Fähigkeiten solche Galionen in sich tragen. Man war in der sozialen Fürsorge damals noch nicht soweit wie heute. Und – alas – wäre er angestellt gewesen, und sei es als ungelernter Arbeiter, wäre ihm wohl geholfen worden.
Es ging uns also recht dreckig. Darum war das Weihnachtsmärchen auch nur ein schwacher Trost und dennoch ein kleiner Lichtblick. Bei den eingestreuten Liedern weinte meine Mutter, ich weinte mit, obwohl ich schon zwölf war. Meine Schwester weinte nicht. Sie war so hart gesotten wie mein Vater, war schon konfirmiert und hatte dem Pastor beim vorgeschriebenen Unterricht eines Tages erklärt, sie glaube an das alles nicht. Sie glaube, die Menschen sollten auch ohne all das anständig sein.
Wie sie darauf komme? hatte der Herr Pastor da gefragt.
Mein Vater hat das gesagt, und dem glaube ich! Das war ihre Antwort gewesen. Und der Seelenhirte hatte dann weniger erbost als verächtlich geäußert: Dein Vater ist wohl Sozialdemokrat.
Na ja, das war damals noch als sehr gefährlich erachtet. Aber mein Vater war in gar keiner Partei. Er war nur erfahren und gescheit. Und er hinderte meine Mutter nicht, auf ihre eigene Art fromm zu bleiben und Gefallen zu finden an rührenden Kirchenliedern. Und sie hinwieder suchte ihn nicht zu bekehren. Darum kamen die beiden gut miteinander aus. Und ich mit beiden.
Denn mir war früh klar, man kann das eine wie das andere, kann Glauben und Nichtglauben gut miteinander vereinigen und je nach Bedarf verwenden. Im Täglichen, im Gang der Arbeit und des Geschäftes, da soll man nüchtern und gegenwärtig die Dinge an sich und sich selber einsetzen und damit rechnen. Wird es schwierig, soll man auch nicht gleich nach höherer Polizei rufen, sondern das Seine nach Möglichkeit tun. Aber wenn es verzweifelt wird, da ist eine Hinwendung zur Unerforschlichkeit keine Schwäche, da gibt es sicherlich geheime Kräfte, die dem Flehenden sich nicht verschließen, sofern er nichts Unbescheidenes verlangt und sich seiner Einfalt bewußt bleibt und auch schleunigst sich selber aufrafft und anstrengt, solange es nur eben möglich ist. Dafür denn braucht man keinen Geistlichen, darin muß ich meinem Vater beipflichten und auch meiner Schwester, das macht man mit sich allein ab. Gottes Wort kann als Trost, doch nie als Sprungbrett dienen.
Und ich sehe, Mister Bit, Sie halten es ebenso. Nein? Sie lieben gewisse Zeremonien aus dekorativem Genuß? Bei Trauungen und bei Bestattungen? Gewiß, auch das.
Als Emil Jannings, der saftige Mime, trotz aller Beschwichtigungen seiner Ärzte und seiner lieben Auguste merkte, daß die Stunde des endgültigen Abtretens nicht fern sei, überlegte er, welch magere Vorstellung er als Protestant am Wolfgangsee mit seiner Beerdigung bieten würde, und wurde darum noch schnell katholisch. Und es wurde ein rechtes Gepränge. Sogar der Bischof oder gar Erzbischof aus Salzburg war dabei.
Zum Wohl denn, Mister Bit! Er lebe! Denn er war wirklich ein großer Schauspieler. Ich kannte ihn nicht nur aus seinen Filmen, wo er mir am besten gefallen hatte in The Way of all Flesh, obschon das noch ein Stummfilm war. Und er spielte da in den USA einen deutschblütigen Kassierer und Familienvater, der, unversehens von der Gier nach prächtigem Dasein gepackt, mit einem hohen Betrag von seiner Bank verschwand, aber wie der Mann in Georg Kaisers »Von Morgen bis Mitternacht« und wie in allen ähnlichen tatsächlichen Fällen nicht glücklich wird und im Film schließlich als Landstreicher heimlich ins Fenster des alten Hauses blickt, seine verlassene Familie getröstet und fröhlich unterm Weihnachtsbaum sieht und daraufhin still im Schneetreiben davongeht.
Ich hab’s Jannings hoch angerechnet, den Schluß so entgegen dem von der Hollywood-Produktion gewünschten Happy-End durchgesetzt zu haben. Er erzählte mir davon. Und sollte oder wollte nun eine gewisse Rummelplatzgestalt spielen, wohl einen Luftschaukelbesitzer namens Liliom, und gedachte bei mir Näheres über solchen Typ zu erfahren und die entsprechende Atmosphäre, die meinem Landsmann Hans Albers allerdings eher lag.
Das war, als ich schon mein Karussell auf dem Spielbudenplatz hatte, da kam Jannings vorbei mit seiner zierlichen hübschen blonden Gussy – ich nehme an, sie war geborene Bremerin, indes er bald aus der Schweiz, bald aus Schlesien und bald aus Hoboken zu stammen vorgab, je wie es die geschäftliche Sachlage oder Laune ergab. Denn bei einem Schauspieler von Rang wird das Wandelbare zur Natur, und was er jeweils darstellt ist tatsächlicher als die karge Wirklichkeit.
Mit den beiden damals war auch die noch kleine Tochter Ruth, die ihm sehr ähnlich sah, obschon sie, wie ich hörte, aus anderer Ehe der Mutter herrührte und einen echten Fürsten zum Vater hatte. Die drei setzten sich munter auf meine Karussellviecher, er auf den grauen rotbesattelten Elefanten, seiner Statur gemäß, seine Gattin auf meinen gelben Löwen mit der blauen Schabracke, und saß da im Damensitz wie auf einem Zelter, indes Ruth mein liebstes Pferd wie ein Junge bestieg. Und sie fuhren ein paar Runden zu der Platte, die ich gerade aufgelegt und die ihnen sichtlich behagte.
Und zu Hamburg, da stehn
schon die Mädchen an der Pier,
und was bringst du mit nach Haus,
und was schenkst du mir?
Eine Perle aus Samoa,
eine Muschel aus Balboa,
Gruß und Kuß von allerwärts
und dazu mein Herz.
Und dann sollte ich St. Pauli zeigen, ohne die kleine Ruth natürlich. Denn St. Pauli Reeperbahn, das hatten sie selbst in San Francisco aufgetischt bekommen, das überträfe alle ähnliche Gelegenheit sonstiger Hafenstädte. Sie meinten vor allem Striptease und dergleichen, aber ich zeigte ihnen anderes, das mir besonderer zu sein schien, also Papa Haases Museum für Kolonie und Heimat, wie jener ulkige seemannsbärtige Aufschneider seinen Trödelladen in der Erichstraße benamste. Und auch Woinkes Museum und Schauerkabinett tief im Keller Ecke Kleine Freiheit und die beiden Tätowierer Finke und Wahrlich und was sonst zwischen Panoptikum und Hippodrom sehenswert war und auch die Damenboxkämpfe. Mal durch die Marien- und Petersstraße zu schlendern, verzichteten sie. Die Huren dort hätten wohl auch einigen Tamtam gemacht wegen solcher nicht unauffälligen Zaungäste. Und auch in die Grabgewölbe unter der schönen Barockkirche Große Freiheit, die so weise erhaben sich und unbeachtet in das Gewursel der irdischen Lichtreklamen und Bumsorchester fügt, wollten sie auch nicht, obschon man da den Sargdeckel von der eingetrockneten Hülle eines weiland k.u.k. Gesandten und auch des einstigen Oberpostdirektors zu Thurn und Taxis, Grafen von Kurzrock, zu heben vermochte, und es gab da dreihundert Särge mehr.
Indes hatte Gussy, geborene Holl, schon genug von den gelblichen Kinderleichen bei Woinke, und somit gingen wir ins Alkazar, wo sich das Tanzparkett gerade in eine Eisfläche verwandelte und ein Schlittschuhballett auftrat, das war angenehmer.
Sie erwähnen die Finkenbude, Mister Bit. Aber dahin hätten wir ohne kriminalbeamtlichen Schutz die Füße kaum lenken dürfen.
Ich hatte diese wenig romantische Umwelt mit der vorsorglich zwei Meter breiten Theke und dem griffbereiten Gummiknüppel des Wirtes und wo man billig übernachten konnte (mit einem tiefgespannten Schiffstau als Kopfkissen oder vielmehr Nackenstütze, was beim Wecken einfach gelockert wurde) nicht in bester Erinnerung. Nicht daß ich belästigt wurde, als ich wegen einer vom Werftgelände verschwundenen Galione dort vorsprach. Von den unterschiedlichsten Anwesenden dort wurde mir mit ehrbarstem Grinsen ein solches Bündel von Fingerzeigen unterbreitet – und manche Gesichter hätten in jedes Pastorat gepaßt –, daß ich wohl einsehen mußte, durch den Kakao gezogen zu sein. Ich zahlte dann in gemessener Dankbarkeit eine große Runde kleiner Gläser, an der ich mich beteiligte, und achtete auf mein Portemonnaie, mußte aber, wieder an der frischen Luft, feststellen, daß es dennoch nicht mehr in meiner Hosentasche stak.
Ich zog dann vor, keinen Lärm zu schlagen, ging auch wegen der gemopsten Figur nicht auf die Davidswache und entdeckte dann immerhin anderntags unser schon abgebuchtes Bildwerk unbeschädigt auf der Werft, und die Arbeiter waren schon dabei, es vor den Bug der Brigantine Tondelaia zu hissen. Und es stellte eine Südsee-Insulanerin vor, die wir noch von meines Vaters Hand auf Lager gehabt. Und war eine der letzten Bestellungen dieser Art, die uns erreichten.
Wir hatten uns schon auf Belieferung von Jahrmärkten, sei es Karussell, sei es Orgeldekor, umgestellt. Ohne die väterliche Hilfe kam ich damals noch sowieso nicht gebührend mit der menschlichen Figur zurecht, zumal die gehörige Lieblichkeit der Nymphengesichter wollte mir nicht gelingen. So verlegte ich mich erstmals mehr aufs Tierreich, und die Kirmesbelieferung machte mir Spaß, und wir konnten manchmal drei Gesellen mitbeschäftigen.
Besonders die Löwen gerieten mir furchterregend, waren sie doch auch früher an Schiffssteven beliebt gewesen, und schon als ich eben zwölf war, hatte ich mein erstes Leuenhaupt nach Vorlage sauber gefertigt. Ich hab’ wohl an die vier Dutzend auf Meerfahrt geschickt. Sollten von diesen fletschenden Mähnenträgern noch heute welche im Antikenhandel auftauchen, so tut der erwerbende Liebhaber gut daran, mit schmeckender Zunge den Salzgehalt zu erkunden, damit die ozeanische Getränktheit nicht nur in der Phantasie des Sammlers... aber nein, er unterlasse die mißtrauische Probe und bleibe lieber unenttäuscht, falls es sich zufällig doch um den abgesägten Kopf eines Karussellöwen handeln sollte.
Was heißt denn echt,
was heißt denn schlecht?
Wenn man’s nur lieb hat,
ist es recht.
Besagtes Unternehmen blühte eine Weile ganz erträglich. Und das trotz der niederländischen Konkurrenz, wo ähnliche Zimmereien wie meine von der Seebelieferung aufs Trockene geraten waren. Namentlich die Drehorgeln der dortigen Hafenstädte übertrafen einander an Ausschmückung, und auch mich erreichten solche Aufträge, und wir lieferten manchen Satz bemalter Najaden und Odalisken kleineren Formats, an das ich mich eher getraute und wobei ich schließlich auch an Fertigkeit gewann, hatte zudem meine Lust, etwas Beweglichkeit in die Püppchen zu bringen, so daß solch starre Schöne einen nackten Arm zu schwingen wußte und der zierliche Klöppel in ihrer Hand im Takte, gekoppelt mit der metallischen Lochscheibe der Musik, zur Unterstreichung besonderer Stellen gegen einen Triangel, ein Tamburin oder ein Glöckchen schlug. Das geschah oft zittrig genug im Geschepper der Mechanik und sah wenig vollkommen aus, mich aber rührte es, als stiege da eine bängliche Lebendigkeit aus meinem Schnitzwerk. Von dort zur Marionette wäre nur ein Sprung gewesen. Doch bald scheute ich mich, den Puppen ihr feierliches Insichberuhen zu stören und ihnen eine Nachäffung der menschlichen Tragikomödie aufzuzwingen.
Und ich gab mir desto mehr Mühe, meine Sache reizvoll abzuliefern, blieb aber immer im Gesitteten bis auf jenen umfangreichen Aufbau für ein Bordell in Antwerpen. Ich konnte es nicht ablehnen, es wurde blendend bezahlt und machte mir naturgemäß auch Vergnügen, eine Art Bacchanal paradiesischer Gestalten, bevor der Sündenfall die Modesalons begründete, alle an die vierzig Zentimeter hoch. Es war jedoch wie zur Strafe die letzte große Summe, die mir das Handwerk einbrachte.
Die Karussels alten Stils hatten sich überlebt. Selbst Kinder zogen sachlich nüchterne Auto- oder Flugzeugattrappen aller noch so ansprechend gestalteten Naturromantik vor. Die großen Achterbahnen insbesondere bedurften keines Schmucks. Der größere Kitzel abenteuerlicher Kurven und Geschwindigkeit genügte. Man war seiner Augen überdrüssig geworden. Und seines Vergnügens an stillen Reizen. Man suchte das immer Aufregendere, das Tempo, den raschen Schwindel, den kreisenden Wirbel, das sausende Tanzrad. Selbst die sogenannten amerikanischen Schiffsschaukeln, die sich bis über den Halbkreis hinaus zu schleudern wußten, verloren an Kundschaft, da es kaum noch jemanden gab, der sich vor oder nach der Bekanntschaft mit orkanbedrängten Segelschiffsrahen seiner Seefestigkeit versichern wollte und es nötig hatte.
Hier nun, auf diesem sicheren Metallbau unseres Containerfrachters, scheint mir bei diesem Wetter die Erinnerung an die bunten dürftigen Blechkähne vormaliger Jahrmarktsherrlichkeit nicht zufällig, Mister Bit. Und die Geräusche vor den dicken Bordfenstern wecken in mir das Gebrüll, das ich in meine stummen Bestien mit hineinschnitzte.
Woher ich überhaupt die Beziehung dazu hatte? Ich sah in meiner Kindheit aus dem vierten Stock eines Mietshauses, wo wir vorübergehend wohnten – tief unten eine verlotterte Ansammlung von Gebüsch, und darin versteckten sich einige Käfige, die angeblich Hagenbeck gehörten und zur Unterbringung von allerlei Exoten dienten, die von seiner Tierhandlung in St. Pauli nicht alsbald abgesetzt werden konnten.
Dieses geheimnisvolle Gartenstück hatte es mir angetan und beschäftigte meine Träume. Gärten, in Großstädten eingeklemmt, gemahnen wohl mehr als alle menschlichen Schandtaten an das verlorene Paradies, das allerdings nie verloren war, sondern immer nur erfunden und selten gefunden wurde.
Ihr John Milton, Mister Bit, dem wir immerhin den ersten Anstoß zur Pressefreiheit verdanken, erblindete, ehe er’s zu schauen vermeinte. Ich nun gelangte niemals in jenes aus der Vogelperspektive betrachtete Eden meiner Kindheit. Hingegen drang mit dem Wind oft ein scharfer Geruch bis in unsere Zimmer.
Es sind Hyänen, sagte mein Vater und krauste die Nase.
Mich bedrängte es nicht, sondern malte mir Tropenwälder und Gedschungel auf die blaßgeblümten Tapeten der Schlafkammer, und was ich in einem Bilderbuch an Löwen und fremdem Getier gesehn, ging darin aus und ein.
Auf Safari? War ich nie, Mister Bit, aber der Zoo und ab 1907 Hagenbecks Park in Stellingen, das war mein Studiengefilde, hab’ aber nie gezeichnet, um nicht der vereinfachenden und gesteigerten Schnitzform, die sich aus Vorstellung und Handarbeit zusammenknüppelt, Hemmungen zu bieten.
So ist’s mit der inneren Figur, sie ist da, sie muß nur äußerlich Gestalt erringen. Das Wie war mir vordem niemals klar, es ergab sich mit dem Schaffen. Und gewiß will ich mich mit meinen Gebrauchserzeugnissen, dem Karussellbestiarium und den Drehorgelengeln und späterem Terrakotta und den grausigen Kriegserinnerungen nicht den rechten Künstlern an die Seite wagen. Das war nur vorübergehend mein Ehrgeiz. Aber der Vorgang zwischen Idee und Ausführung ist überall ähnlich.
Der nordischen Sehnsucht nach südlichen Breiten bin ich später ohne Hast gefolgt und bin immer gern wieder heimgekehrt in unsere gemäßigten Verhältnisse aller Sparten vom Klima bis zur Postbeförderung. Und die Gärten von Rio oder Portofino, von Weltevreden oder Auckland oder die botanische Anlage oberhalb Algier wird bei Ihnen, Mister Bit, von Kew Gardens ersetzt oder so und bei mir durch mein bescheidenes Rosarium oder selbst durch das Gedenken an die Geranienstöcke auf dem Fensterbrett, die mal unser ganzer Hausgarten waren. Sie ergaben in ihren Ablegern billige Geschenke, wenn meine Mutter, was selten vorkam, zu Kaffee und Kuchen bei einer alten Krankenpflegerin eingeladen war, die früher bei uns gewohnt, weil wir die Zimmermiete nötig gebrauchten.
Wer fragt, was Blumen denken,
die Menschen einander schenken?
Das Rot jener Geranienblüten finde ich wieder in den Knospen der Super Star, und in deren Himbeerduft meine ich den staubig erdigen der Vergangenheit mitzuriechen. Und fand es auch im Katastrophenschutt anno 43 (davon später, Mister Bit!). Meine Schwester lächelte über die wohlfeilen Angebinde, und sie fügte eine Schachtel Konfekt hinzu; sie konnte es sich wegen Dabelsteins leisten und sollte mit und erklärte mit gepreßtem Atem, bei Tante Maria gebe es immer nur eine einzige Schnecke aus Hefeteig mit Zuckerguß, und die läge da in sechs Teile zerschnitten, für jeden zwei armselige Happen, darum das Konfekt.
Meine Mutter schnürte ihr die Wespentaille, daher der gepreßte Atem. Und das Korsett war grüner Damast, so nannte sie es, und mit Fischbeinstäben. Und ihre weiße Leinenhose reichte bis unters Knie und hatte um jedes Bein eine Spitzenkrause, und darunter waren wollene schwarze Strümpfe.
Es müßten seidene sein, seufzte sie; sie hieß Ella und wollte lieber Elfriede heißen. Und ihre hohen Schnürstiefel hatten weiße Senkel, und ihr Sonntagskleid hatte schinkengroße Puffärmel, es war rot wie die Geranien, doch mit schwarzen Punkten und reichte bis auf den Boden.
Ich bewunderte alles stillschweigend, auch die langen schwarzen Handschuhe. Und Ella nahm ein aufgerolltes Meterband aus dem Nähkasten, und dann maß sie ihre dünnste Stelle über den Hüften und rief beglückt: Ich bin so schlank wie die Guilbert. Denn die Pariser Chansonette war damals ein Idol wie später mal Marlene Dietrich oder die Bardot oder so.
Wer ist denn das? fragte ich. Nichts für dich, Bojer, kicherte sie: Sie kann sechzigtausend unanständige französische Lieder und kriegt dafür pro Abend tausend Frank.