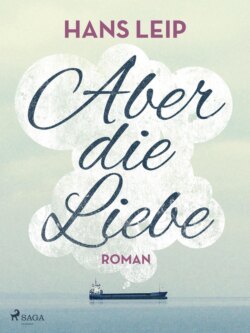Читать книгу Aber die Liebe - Hans Leip - Страница 8
Viertes Kapitel
ОглавлениеWie kommen Sie grad darauf, Mister Bit? Keine Galione? Nein, dieses Boot hat keine Galione, keinen magischen Voranreiter, keine malerische Bugzier. Die Galionsfiguren verschwanden, als Holz zu Eisen wurde. Sie wurden allemal geschnitzt. Sie zu gießen war man kaum gewillt. So starben die bunten Götter der See.
Ich aber, Mister Bit, ich wuchs noch mit ihnen auf, mit den Najaden und Neptunen, den Abbildern von Admiralen, Heroen und Olympiern. Mein Vater war Schiffszimmermann. Die Schiffszimmerer aller guten Künste waren bis fast in die Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts fähig und gewohnt, unterschiedlichste Werkstücke, Kielschwein, Spanten, Stringer und Stevenholz nach »Mul un Snut«, also rein nach Augenmaß, zuzuhauen, oft ohne Rißzeichnung, und so ein ganzes hölzernes Schiff. Meister und Gesellen solchen Ranges erwiesen sich durchweg auch geschickt, gewünschte Dekorationen zu fertigen, die Ornamentik an Rauten, Medaillons, Heckvoluten und Ruderknäufen.
So nebenbei nutzte die Werft auch das Talent meines Vaters, Poppen to snieden, Puppen zu schnitzen und sich auf große Maße zu versuchen und also nach Bestellung oder Schiffsnamen den Schutzgeist zu fertigen, der sich in hölzerner Gestalt verbirgt. Das wurde als Tara mit in Kauf genommen, das wurde nach Feierabend nebenbei erledigt und mit etwas Brot und Wurst belohnt und mit ’ner Buddel Braunbier. Es war meines Vaters Lust und Spaß, bis er sich selbständig machte. Und da wuchs ich hinein und half ihm nach Kräften und stieg auf vom Spänesammeln bis zur Handhabung von Knüppel, Gutsche, Flacheisen, Beißer, Kröpfel und Geißfuß.
Tat mich aber auch hervor mit Pinsel und Anstrich. Da bedurfte es keiner anderen Unterweisung, Lehrzeit oder Akademie, da war vorhanden, was bei den Toppendralls seit Jahrhunderten im Erbgut lag, den Heiligen aller Grade bis hinab zu Kapitäns Hausfrau oder Liebchen Gestalt und Antlitz zu geben und ein bißchen Geringel und Gekrulle dazu, den Übergang zu finden und den nahtlosen Ansatz auf der mehr oder weniger geschweiften Wölbung und Schneide des Schiffsbugs unterm Klüverbaum, diesem Spieß in die Unsäglichkeit der Horizonte. Darunter denn geborgen und segnend die gestaltgewordene Seele des Schiffes die Augen in die Ferne richtete, dahin man sollte, sein Glück zu machen.
Meine Gedanken schwalkten oft mit, und ich starrte ihnen nach, die schon vom Achtersteven und Aufbau der Briggs und Barks verdeckt waren, wenn sie ausreisten gen See. Dann traf mich die dröhnige Vaterstimme: Holl die fuchtig! Denn die Arbeit mußte Tempo haben, da gab’s nichts zu träumen.
Und keine Hoffärtigkeit wollte bei uns höher hinaus, als schlecht und recht ein gutes Handwerk auszuüben. Uns kam nicht in den Sinn, nach dem Ruhm derer zu schielen, die als Steinmetz oder Gießer sich emporgerangelt zum sogenannten freien Künstlertum und sich Bildhauer nannten und Kriegerdenkmäler machten, auch Karyatiden an üppigen Bürgermietshäusern und plastischen Giebelschmuck an Kirchen, Rathäusern und wo immer sich ein prangendes Bedürfnis regte und Mittel dazu aufbrachte. Manches in Marmor, Granit oder Bronze gelangt wohl in Parks und Grünanlagen und steht herum, vom Publikum flüchtig begafft, unwichtig wie die Nippes auf der Kommode, oder schiebt sich in die Museen und Galerien, gestiftet für teures Geld oder angekauft aus staatlichem Zufluß.
Wer aber konnte ahnen, daß eines Tages unsere hölzernen knallbemalten Galionsfiguren ebenfalls museumsreif würden, wenn auch nur, weil sie selten geworden waren? Oder war von Anfang an mehr dahinter?
Sie verziehen den rechten Mundwinkel nach oben, Mister Bit, Ihr Schägbrösel aus Rosenholz beschreibt eine Kurve, die das Zeichen Unendlichkeit bedeuten könnte. Und Sie verstehen so viel Deutsch, um hervorzukauen: Das Meer war dahinter.
Sie sah der Meere Wunder,
sah aller Küsten Plunder.
Nordkap bis Feuerland
ist alles ihr bekannt.
Und da reihen sie sich nun an den Wänden der Museen unter Dach und starren mit aufgerissenem Blick ins Namenlose, abgesalzen, gischtgeschunden und aufgefrischt, eng beieinander, enger als je im engsten Hafenrevier, Göttinnen und Insulaner, Putten, Helden und Getier. Aufgereckt, vorgebogen, verlangend, aus dieser Windstille heraus und wieder in Fahrt zu kommen, erschrocken erstarrt, verharrend, lauernd, unverstandene Unheimlichkeit.
Wie kamen die an Land? Von gescheiterten Betreuungen angetrieben? Abgewrackt? Nicht abgenommen und desto schlimmer ohne Erfahrung hier gestrandet? Nächtens von den weitgereisten Nachbarn verlacht?
Nur auf Zehenspitzen wage ich an ihren erzwungenen Versammlungen vorbeizugehen.
Anno 1663 – obgleich Zahlen hier weniger bedeuten als die in unseren Kontokorrenten – gab es unter den Hamburger Schiffszimmerern einen der Toppendralls, der Bojer Abdena als seinen Vorfahren erachtete. Abdena? Der war Besitzer einer Schnitzerwerkstatt noch hundert Jahre zuvor. Der Fischeraltar zu St. Jakobi ist ihm vielleicht zuzuschreiben. Aber der Meister blieb ohne Signum, blieb namenlos, verwehte, verging. Daß er außer seiner Tochter Gisela, genannt Gischt, ein paar Kinder abseits hinterlassen, wer will dem heute nachforschen? Mein Urahn Alf Toppendrall mochte sich beglaubigt finden, und mir soll’s recht sein, obschon er es zu keinen Altären brachte.
Er lebte, als noch purer Wald sich zu Seefahrtsgehäusen verwandelte. Und er leistete viel in der Ausschmückung jener schwimmenden Paläste des Barock, dieser dickbauchigen Ungetüme, deren Flanken, mit Kanonen gespickt, sich nach oben zu birnenförmig verjüngten, deren Hinterteil, wie ein Wappenschild geformt, mit Fensterreihen und Galerien prahlte und reich besetzt war mit statuarem Schnitzwerk und Emblem, Gesimse, Rauten, Rosetten, Girlanden und knaufigem Geländer. Von dem Verfertiger wurde wenig Aufhebens gemacht, an unserer Küste schon gar nicht. Diese Kunst setzte sich mit unbenannten Meistern fort, großartig im Schweigen und nicht wie in Frankreich, wo mit Königsgunst geschmeichelt sich die Namen von Schiffsschnitzern gelegentlich hervorhoben und sich fast in die Gilde der Dombaumeister gehimmelt fanden.
Eine der Ausnahmen bei uns ist der Schnitzer Christian Precht. Er stattete die beiden Orlogschiffe »Wappen von Hamburg« von 1668 und 1686 zu großer Zufriedenheit des Rates aus und auch das dritte 1688, das aber den Namen des Kaisers erhielt, »Leopold Primus«. Denn man hatte trotz des gewaltigen Festungswalls, der im Dreißigjährigen Krieg sich wohlbewährt, nunmehr die Hilfe des Reiches gegen dänische Gelüste und Tätlichkeiten nicht entbehren mögen. Auch sonst war der genußfrohe und kunstliebende Potentat zu Wien den Hanseaten recht genehm, obschon er wegen der protestantischen Bilderstürmer sich mächtig katholisch gab und die Reformation in Ungarn vernichtete, aber auch den hereinschwärmenden Türken Stopp gebot und sie weit zurückwarf und die sarazenische Piraterie ins Magere traf und somit dem hansischen Levantehandel sich nützlich erzeigte. Sein barock-bombastisches Abbild zierte das Heck der kräftig bestückten Fregatte und wird heute im Museum für Hamburgische Geschichte aufbewahrt.
Im allgemeinen aber überlieferte sich nur der Name des Schiffes, und es war zumeist der Name, der sich aus der Galionsfigur ablesen lassen konnte, solange nicht ein neuer Eigner eine Umtaufe verfügte. Da konnte geschehen, daß ein Schiff, dem eine vollbusige Ariadne den Weg über die Ozeane vorausdeutete, später der Reihe nach Orion, Herkules, Elefant und Esperanza hieß.
Dennoch sind mir einige Kollegen dieses verwehten Kunsthandwerks zu Ohren gekommen: Johann Christoffer von der Heyde in Hamburg, Hein Köster in Neuenfelde, Robert Rüsch in Cuxhaven, auch Willem Wittland in Bremerhaven, der unter andern die Galionen für die beiden großen Flying-P-Liner des Hamburger Reeders Laeisz, die Fünfmaster »Potosi« und »Preußen« geliefert hat. Das war schon nach 1900, und nichts ist davon nachgeblieben.
Und was ist das, was der Däne Magnus Petersen geleistet und Schnitzer Chapman in Stockholm oder der Holländer Gibbons für die britische Flotte (und nicht nur für die Königsschlösser und die St.-Pauls-Kathedrale) und Vater Thorwaldsen, dessen berühmter Sohn Bertel in der Galionswerkstatt begann, und die beiden Anderson, Jakob und James zu New York und Boston? Diese allein sollen an die zweihundert prächtige Wind- und Wogenpirscher aus harzigem Mainer Föhrenholz herausgeholt haben, und wie wenig ist davon geblieben und ziert heute etwa einen verfallenen Seemannsfriedhof, einen Wirtshausgarten, einen Liebhaberpark oder hat pflegliche Aufnahme gefunden in einem Museumssaal, dem Seemansaltenheim der Galionen.
Der Australier Alan Villiers, dieser vielleicht letzte große See-Abenteurer aus Leidenschaft, erstand 1934 in Kopenhagen das Dreimastvollschiff George Stage, das seit 1882 als Schulschiff gedient. Er taufte es um in Joseph Conrad, und der amerikanische Illustrator Bruce Rogers, als Freund und Gast mit an Bord, beschaffte sich von der Witwe des verehrten Paten einige Kaltnadelporträts, die noch zu Lebzeiten entstanden waren. In einem New Yorker Hotelzimmer schnitzte er danach den Kopf des unsterblichen Erzählers und überreichte ihn Kapitän Villiers, als der mit dem Schiff bei der Freiheitsstatue eintraf, befestigte das gelungene Werk auch eigenhändig trotz ekligen Dezemberwetters, auf einer Schwebeplanke balancierend, unter dem Bugspriet. So denn segelte Conrads Bildnis und Geist noch einmal um die Welt, barhäuptig vorauf, dem unruhigen Element näher denn je, bis diese vielleicht als Sonderfall erhabenste aller Galionen ihre Ruhe fand im Seaman’s Church Institute zu New York. Ob sie sogar seine Bücher überdauern wird?
Der Segler diente später wieder als Schulschiff vor Florida und im Seehafen Mystik, Connecticut. Und dort findet sich auch die Galione eines deutschen Schulschiffes der Neuzeit, der Bark Horst Wessel, ein riesiger Adler in Mahagoni und Kiefer, entstanden auf der Werft von Blohm & Voss in Hamburg 1937, restauriert und vergoldet 1960 als ein Wahrzeichen der nordamerikanischen Küstenwache auf einen hohen Sockel gesetzt, und man hat ihm sogar das Hakenkreuz in seinen Klauen belassen.
Symbol und Banner welken hin.
Trotz aller Müh des Ruhms
bleibt nur der wandelbare Sinn
jeglichen Heiligtums.
Ganz meine Meinung, Mister Bit. Ihr Thornton Wilder hat sich in seinen Dreiminutenspielen, die so schaurig übersetzt sind, auch mal mit einer Galione beschäftigt. Drei auf einem treibenden Seglerwrack halb Verdurstende, darunter die Frau des Kapitäns, die ihren Mann hat verrecken lassen, lösen die Engelsfigur vom Bug und stellen sie so auf, daß sie angebetet werden kann. Sie wird zum neuen Gott des Atlantiks ernannt und Lilli getauft. Tatsächlich naht die Rettung. Aber man schämt sich und bringt die Galione an ihren gehörigen Platz zurück.
Als ein Schweizer Kaufmann seinem jugendlichen Sohne die West- und Ostindia-Hafenbecken Londons zeigte, wurde es ihm etwas peinlich, es war anno 1830, weil das Schiff »Die schöne Katharina« und andere an der Spitze (wie er es nannte) eine große weibliche Figur von Holz trugen mit natürlichen Farben angestrichen, »mit frechem Gesicht und ganz entblößtem vollen Busen, was ich (sagte er), da die Nacktheit des Körpers bei uns nicht üblich ist und für höchst unanständig gehalten wird, mit dem Zart- und Sittlichkeitsgefühl des Engländers eben nicht wohl vereinigen konnte und daher vermute, diese schamlosen Figuren von frechen nackten Weibsbildern seien vielleicht berechnet, den Matrosen, die auf ihren Seereisen oft lange kein weißes weibliches Wesen zu Gesicht bekommen, Stoff zur Unterhaltung und zu ihren Matrosenscherzen zu geben«.
Dieser Herr Dalwig aus St. Gallen wußte nicht, wie verpönt jede unlautere Bemerkung über die Schutzgöttin an Bord war. Und daß die den Meerdämonen preisgegebene Entblößtheit schon seit der Antike zur Beschwichtigung der Stürme diente. Weshalb sich Tine Bockelhanft aus Twielenfleth, als sie in jungen Jahren manche Reise mit ihrem angeheirateten Kapitän gemacht, wenn’s nottat, an den Bug schlich, natürlich nur im Dustern, so erzählte sie, und dann schnell den Mantel mal öffnete und dem Taifun gezeigt, wie hübsch sie gebaut – damals noch – war. Und dann war der Taifun so dankbar oder erschrocken, daß er das fürchterliche Gepuste bald unterließ. Sie hatten nämlich als Galione nur einen dicken muschelblasenden Triton vorn an ihrem Rahsegelschoner. Der nützte in solchem Fall nichts.
Ich denke, Mister Bit, wir sind den Luftströmungen aller Breiten verwandt genug, um das zu verstehen. Zum Wohl denn!
Als ich so um zehn herum war, verkehrten noch eine Menge Rahsegler im Hamburger Hafen, und wir hatten in meines Vaters Werkstatt, die er sich eingerichtet, noch immer Aufträge für Galionsfiguren. Langweilt es Sie? Nein? Es ist eins Ihrer Lieblingsthemen? Dann lassen Sie mich weiter erzählen, begleitet von der Orgelmusik, die Wind und See uns kostenlos spendieren.
Einmal hatten wir eine kräftig gebaute Nixe für die Brigg »Meermaid« gefertigt, auf der Willy Molten als Vollmatrose fuhr. Und als sein Schiff nach Jahresfrist wieder mal Hamburg anlief, besuchte er uns. Und da hörte ich wieder einmal all die fernen Ziele nennen, die er schon kannte, abseitige Orte, die damals noch kein Dampfer des Anlaufens für wert hielt, Namen, klangvoll, fremd, von Seewind und Düften durchfiebert: Baranquilla, Paysandu, Swan River, Samarang, Surabaya, Torterallillo, Yalapa ...
Willy Molten zählte das alles auf wie die Gerichte einer Speisekarte, die man einer Freundin zur Auswahl vorliest ohne Rücksicht auf die Preise. Plötzlich sagte er: Jetzt aber los! Er zog seinen Hosenriemen strammer, schulterte den Seesack, den er im Flur abgesetzt, gab meinem Vater die Hand, lächelte meiner Mutter zu, als sei sie jung wie er, und dann begleitete ich ihn zum Baumwall, wo die Jollenführer ihrer Kunden warteten.
Und Muggi Wimp ging auch mit, weil er grad von mir eine Rechenaufgabe abschreiben wollte.
Wollen die auch mit auf See und so lütt all? griente der Schiffer. Ich sprang ins Boot.
Ja, ich! versetzte ich. Die Kehle war mir eng wie die Welt weit war.
Nur bis ans Fallreep! knurrte Willy.
Der Jollenführer pullte uns, Motor gab’s damals noch nicht, zum Jonashafen. Da lag die Brigg »Meermaid«. Ihr scharfer Steven ragte hinter den Pfahlbündeln hervor, daran sie noch vertäut lag. Ich konnte die hellen Buchstaben auf dem schwarzen Rumpf schon von weitem lesen. Und unter dem schrägen Bugspriet da sah ich sie wieder, die schöne Meerfee, und es war, als wolle sie grad ins Wasser jumpen.
Will die baden? fragte Muggi.
Dösbattel! entgegnete Willy: Das ist doch uns Galjon!
Und ich fügte stolz hinzu: Und mein Vater hat die geschnitzt, und ich hab’ sie angemalt.
Muggi war ahnungslos und von Haus aus völlig unbekannt mit solchem Bildwerk, für das wir Lindenholz genommen hatten, was sich weich und glatt verarbeiten läßt und auch die Farben schön hält, himmelblau mit goldener Krone und um die Mitte einen Kranz grüner Blätter, wo aber keine richtigen Beine anfingen, sondern lange Fischschwänze, und die waren fest an die Stevenwand hingeringelt; damit hielt sich die hübsche Dame. Sie blickte aber gar nicht ins Wasser und dachte an keinen Kopfsprung, obschon die Flut noch auflief und der übliche Hafendreck sich in Grenzen hielt. Sie blickte starr vorweg gen West, wo hinter Blankenese irgendwo die See liegt und die Unsäglichkeit und all das, wovon Willy so geheimnisvoll zu berichten wußte, obschon er tat, als sei das bloß für fünf Pfennig in der Tüte.
Und ihrer Augen Sterne
sind blauer als die Ferne,
und ihre Brüstelein
berauschen wie Branntwein.
Jene schöne Nixe war noch nicht die letzte gewesen, die mein Vater in Auftrag gemacht hatte, und dennoch bald eine der letzten der unzählbaren Heerschar, die in Jahrhunderten den Seglern aller Sorte voraufgeeilt, Sinnbild und Talismann, kristallisiertes »Gode Reis!« und »Kiek mol wedder in!«, zugleich auch Dämonenschreck und Windbeschmeichler, Wetterbeschwörer, Heros und Heilige, Herold und unberührtes Matrosenliebchen und was alles sonst.
Alter Zauber, ich weiß, Mister Bit. Ich sah wie Sie noch die Nachklänge in Londons Südhäfen, wie sie in der leisen Wasserregung vor den Trossen zu atmen schienen, und sah sie noch im alten Hafen zu Kopenhagen von Finnland hereingleiten. Sie haben recht, es war nicht Ihre, es war die weit nüchternere amerikanische Marineleitung, die bald nach der Jahrhundertwende anno 1906 in ihrem Befehlsbereich derlei »Schmuck ohne praktischen Wert« verbot.
Indes, als der geniale Zeichner Rockwell Kent 1914 auf Neufundland wohnte, fischte er eine Galione aus dem Abfallhaufen einer Schiffshandlung. Er wusch ihr den Schmutz herunter, schabte sie sauber und glättete sie mit Sandpapier. Den letzten Hauch ihrer Farbreste beachtend, malte er ihre Haut weiß, ihre Wangen rosa, ihr Haar glänzend schwarz, ihre Ohrringe und ihr Halsband golden. Und gab ihr einen Platz zu Schmuck und Wachsamkeit seines Häuschens am Türpfosten. Als er die Insel verließ, wollte er sie mitnehmen. Der Schiffshändler aber, der kaum wußte, wie und wann sie in seinen Schrott gelangte, verlangte nun, da sie so schön geworden, eine Bezahlung, und die war dem Künstler unerschwinglich.
Zehn Jahre später sah er sie wieder, in New York in einem teuren Antiquitätenladen. Sie war unverändert. Inmitten der hochfeinen Möbel, Uhren und anderer Überreste vermotteter Vornehmheiten blickte sie verloren durchs Ladenfenster, als sei draußen die Stadt und die Welt nichts als ein Stück der weiten See, für die sie geboren war. Er fragte den Verkäufer beinah flüsternd nach ihrer Herkunft.
Von Boston, antwortete der ebenso verhalten.
Und der Preis? flüsterte Kent.
Es war ein Vielfaches dessen, was der Schiffshändler gefordert, unerschwinglicher denn je für ihn, der sie gefunden, aufgefrischt und eine Weile besessen hatte.
Wenn wir nach den alten Tagen fragen,
wollen wir Verlornes nicht beklagen.
Bleibt es doch, wie’s war, in uns bestehn,
braucht nicht morsch und abgewrackt vergehn.
Je seltener, desto wertvoller, so heutzutage die Galionsfiguren, die da in ihren musealen Versorgungsstätten gelandet sind zu Greenwich, Karlskrona, Amsterdam, Helsingör, Paris, Annapolis, Berlin, zu Lübeck, Stralsund, Flensburg, Husum, Eiderstedt, Insel Föhr, Insel Juist, Vegesack, Bremerhaven, Cuxhaven, Stockholm, Toulon, Boston, Salem, Newport, New Haven, Mystik Seaport und vor allem bei uns zu Hamburg-Altona. Sie sind manchmal höher versichert als vormals das gesamte Schiff.
Wer aber will auch heute leugnen, daß, was wir schon immer gewußt, es sich um unwägbare Köstlichkeiten handelt? Diese durchgesalzenen Allegorien, alle diese Götter und Göttinnen, Könige, Königinnen, Helden, Najaden, Poeten, Staatsmänner, Kapitänsgattinnen, Marien, Erzväter, Muschelhornbläser, Blumenmädchen, Exoten, Einhörner, Drachen, Greifen, Löwen und Delphine? Die gesamte Kreatur, Mythologie und Gesellschaftsliste ward beliehen, Sage, Legende, Geschichte und lokalste Gewärtigkeit. Sogar ein Pierrot war dabei. Aber den Teufel malten sich selbst die Freibeuter nicht an die Schiffswand. Auch sie trauten mehr den rechtschaffenen Genien. Sogar die gekrönte Aufgeschwemmtheit der Potentatenbüste am Bug vor Nelsons »Victory« war ehrfurchtheischend gemeint samt den Huldinnen, Kolonialsklaven und Amoretten drum herum. Wie dieses Spektakulum Trafalgar hat überstehen können, ist schleierhaft. Die Tatsache scheint hundertundneun Jahre danach einen Draufgänger wie den alten Lanzenreiter und Reporter Churchill allzusehr überzeugt zu haben, auch er werde, mit Zeige- und Mittelfinger im Zeichen V gleich »Victory«, den Sieg beschwören und, mehr als das, dem Empire die Weltgeltung erhalten und mehren.
Wann wird das Schicksal geruhn,
uns wieder so günstig zu sein
wie damals: Ein Meter Kattun
gegen ein Meter Elfenbein?
Noch auf der gloriosen Empire Exhibition zu Wembley konnte man glauben, er habe recht behalten. Und wenn auch weitere drei Jahrzehnte nach 1914 das V der V-Waffen sein V nicht auslöschen konnte, so bedeutete es hier wie dort keineswegs Sieg, sondern nur noch Verderben, Vernichtung und Verlust.
Wohl wurde dem Riesendampfer »Imperator« noch eben vorm Ersten Weltkrieg ein mächtiger Adler vor den Bug gesetzt, aus Bronze, versteht sich. Die See zerschlug ihm auf der Jungfernfahrt einen Flügel. Der Kaiser grollte. Mußte ein Hamburger Schiff des Reiches Sinnbild so schnöde verletzen? Sein als freundschaftlich bezeichnetes Verhältnis zum Reeder Albert Ballin soll seitdem getrübt gewesen sein. Man hielt in der Hapag für geraten, das ahnungsvolle Galionsgeschöpf zu entfernen.
Anno 39 sah ich in Kiel das Artillerieschiff Aviso »Grille« mit einer Expression des Namens in Gold als Galione. Und immerhin haben die Segelschulschiffe als letzte Windjammer noch durchweg ihre Amulettfigur vorgeschnallt. Aber metallische Galionen? Wahrscheinlich sind sie stofflich zu gewichtig und mystisch zu unergiebig. Magnetismus ist eine allzu einsehbare Magie. Sowieso müßte bei modernen Überseern die Galione ein gigantisches Gebilde sein, um zu wirken. Holz würde nicht reichen.
Aber Holz muß es sein, Holz ist in sich nicht tot wie Metall, es lebt, bis zum letzten Wurm, es lebt wie das hölzerne Schiff lebte. Und die Baumgeister darin, ich weiß nicht, Mister Bit, wieweit Sie abergläubisch sind und ob Sie mitunter an Holz klopfen – es braucht nicht die Stirn und Hirnholz zu sein – und ob Sie wissen, damit die Dryaden und Elfen zu Hilfe zu rufen, die auch im gehauenen Holz unsterblich sind.
Mit Eisen geht das nicht. Birgt nicht alles, was mit Holz zu tun hat, einen Hang zur Zärtlichkeit? Und sei es unter rauher Rinde. Noch die ungeschlachteste Galione in Holz besitzt die anmutige Sicherheit, die jeder Baum aufweist und die auch dem Zimmermann eignet, der in schwindelnder Höhe sich über ein Balkengerüst bewegt, wie eben auch dem Seemann, der noch ganz anders in den stürmischen Wipfeln der Masten zu balancieren hat.
Gegossene Galionen? Hephästos war nie ein Gott der See, es sei denn, er wurde es bei Gründung der Stettiner Werft. Gewiß, seine vulkanische Gattin war Aphrodite, die Schaumgeborene. So entstand aus Feuer und Wasser das Zeitalter der Dampfschiffe. Und so vermochte man der Natur unnatürlich entgegenzutreten. Man überwand Wind und Wetter mit geringerer Anstrengung. Man bedurfte der übersinnlichen Hilfe nicht mehr so sehr.
Die karg sich äußernde Gefühlsbindung des Seemannes – so tatsächlich drückte sich ein Hamburger Senator aus – besaß in der Galione sozusagen einen Knotenpunkt, eine geradezu kultische Verstrickung, so wenig je darüber gesprochen wurde. In jener hölzernen Armadaschar ballte sich alles, was im Seemannsgarn spinnt und in den Shanties sich tarnt und was noch in kitschigsten Ahoi-Schlagern knistert: Der Abglanz der ewig fliehenden Kimm, die Gottverlassenheit in gnadenloser Beengung, die Unausweichlichkeit inmitten elementarer Gewalten und das scheue Vertrauen in die Barmherzigkeit unerforschlicher Mächte und selbstverständlich auch Abenteuerlust, das übliche Ungenügen, pralle Sehnsucht, brennende Erotik, gedämpft durch Mühsal und Entbehrung, Fernweh, Wagemut, Verbissenheit, Brutalität, Angst, Überdruß, Trotz, Heimweh und würgende Ergebung ins Schicksal.
Man blickt aufmerksam in die seegebeizten Puppengesichter! Das ozeanische Konzert ist in sie eingespielt, die Harfe der Riggen, die Orgel der Böen, die Donner der Brecher, die ganze unerbittliche Partitur der Weltmeere mitsamt dem heiseren Schrei der Möwen, dem Abschlag der Glasen, dem Gebelfer der Nebelsignale, dem Geknatter der Segel, dem Ächzen der Blöcke, dem Singsang vom Atoll, den Gangspillshanties, dem prickelnden Wimmern des Matrosenklaviers, dem Knall der Notraketen, dem Gebrüll der Schlachten und der Sphärenmusik der Sterne.
Uns Galjon! hatte Willy gesagt. Nicht nur des Kapitäns ungeküßte Braut zur Linken oder sein Blutsbruder, sondern Liebchen, Genius und für jeden an Bord bis zum Moses, der französisch viel netter mousse heißt, das Schaumflöckchen, das bißchen Nichts, und daher kommt die deutsche Bezeichnung. Eine Galione, die das robuste Teerjackengemüt ansprach, vermochte das Betriebsklima auf und unter Deck, die notgedrungene Kameradschaft selbst bei dürftiger Unterkunft und kläglicher Verpflegung freundlich zu beeinflussen, wachte sie doch unweit des im Vorschiff gelegenen Mannschaftslogis. Es ging eine geheime Verpflichtung von ihr aus, zumal wenn sie sich als Glücksbringer erwies zu raschen Reisen bei zügigem Wetter und wenn sich auch Achterdeck und Kombüse, Schiffsleitung und Koch ihrer gerechten Strahlung einordneten.
Hoch von den Planken dringen
Matrosenfluch und Singen.
Ihr folgt bei Tag und Nacht
der Bau voll Mensch und Fracht.
Wo es am gröbsten hergeht, ist das Sentimentale nicht fern. Besonders schöne Galionen besaßen darum die Walfänger. Dieser barbarischste aller Berufszweige zur See, abgesehen von dem der Sklavenjäger, bedurfte eines sanften Ausgleichs. Oft zierten den Bug Bildnisse der Kommandeursfrauen. Denen ein Miterlebnis der Eismeerstrapazen und das grausige Gemetzel der Wal- und Robbenjagd zuzumuten, war eine hilflose Roheit. Aber man bedurfte ihrer wie der Pflegerinnen im Lazarett.
Der Einwand, männliche Galionen seien nur den Uberquerern des Äquators gestattet gewesen und sei deren Ausweis, ist nicht stichhaltig. Der Dampfsegler »Saxonia« der Hapag 1875 wie auch die Laeisz-Segler noch nach 1900 besaßen weibliche Galionen. Sie sind mit ihren Schiffen dahin. Aber der Schutzengel des holländischen Grönlandfahrers »De Flora« von 1753 blieb erhalten, eine nördliche Blumenfee von handfestem Liebreiz, die ein paar Centifolien ans Herz drückt. Es könnte ein Hochzeitskonterfei sein von Marrien Hayen, der zweiten Frau des Föhrer Kommandeurs Nahmen Arfsten. Sie schenkte ihm zehn Kinder. Er verstand sich selber aufs Schnitzen und hat dem flandrischen Meister seiner Galione wohl zur Seite gestanden. Nicht alle Talente sind auf Ruhm erpicht.
Im Städtchen Buxtehude gegenüber Blankenese fand sich als Kapitänsvermächtnis eine »Leda«, geschnitzt als ein Bauernmädchen, das, den Rock raffend, entschlossen dem Andrang der Wogen und des Schwanes entgegensieht.
Die Nymphe des berühmten britischen Teeklippers »Cutty Sark«, also die des zu kurzen Hemdes, anno 1869 auf schottischer Werft geboren, die Urahne des Minirocks, stammte aus einem Hexengedicht des im Rausche jung gestorbenen Dichters Eures weiteren Heimatlandes, Robert Burns.
Eine ähnliche Ehrung aus deutscher Literatur, Mister Bit, ist mir nicht geläufig.
Aus dem Reigen der Meerfrauen hat sich meine Vaterstadt die schöne »Kybele« übereignet, die der Besteller nicht abgeholt. Wahrscheinlich hat niemals ein Spritzer Gischt sie bereift, und vielleicht stammt sie aus der Hand meines Urgroßvaters eben nach anno 1800. Ihre Patin ist die kleinasiatische Frühlingsmutter, eine Waldnymphe, dem Holze hold. Als Galione war sie bei puritanischen Reedern beliebt, hatte sie doch dem Jüngling Attis Keuschheit auferlegt. Er brach das Versprechen. Ihre Vorwürfe trieben ihn zur Selbstentmannung. Welche Warnung für den Seefahrer und – betreffs der Vorwürfe – für die Seemannsfrauen und Bräute!
Besagte Göttin reitet gewöhnlich auf einem Löwen. Diese Hamburgerin trägt ihn als Schoßpudel im Arm. Und ihr phallisches Zepter des Altertums mildert sich ebenfalls und wird zum stützenden Speer. Dem Ausdruck und dem Kostüm nach könnte es eine Erinnerung sein, Mister Bit, an Eure Lady Hamilton, die anno 1800 zu Hamburg im Hotel König von England, wo sie mit Lord Nelson und ihrem Gatten William abgestiegen war, ihre klassischen Attitüden vorführte. Den so schmächtigen als großen Seehelden wie auch den alternden Sir William überragte sie an Höhe und Fülle und hatte aus beiden rechte Korybanten gemacht, wie unser Domherr Meyer andächtig augenzwinkernd notierte.
Den Helden und den Heroinen
wird Lob gezollt, solang sie nicht
sich abseits der Moral bedienen,
obschon es menschlich für sie spricht.
Da wir beim Klassischen waren, will ich doch gleich noch die männliche Galione erwähnen, die auf der Ulrichswerft zu Vegesack der eisernen Bark »Schiller« 1879 vorgeheftet wurde. Der gute Segler gehörte dem Bremer Reeder Wätjen und fuhr sozusagen unter dem geheimen Motto aus dem Gedicht »Der Spaziergang«: Unübersehbar ergißt sich vor meinen Augen die Ferne ... Dabei ist das Meer nicht gemeint, aber in der Originalschreibung »ergißt« statt »ergießt« fließt ungewollt merkwürdig das seemännische »gissen« hinein, die Vokabel für Entfernungsschätzung auf See.
Und schließlich brandet es doch etwas, wenn auch nur im Gemüt des Dichters, der weder Tells Alpen noch den Schauplatz der Taucherballade persönlich gekannt hat und dennoch, eben dennoch mehr davon wußte und aussagen konnte als die meisten der Lokalkenner: Ins Unendliche reißt es ihn hin, die Küste entschwindet ...
Die wackere Bark machte viele flotte Reisen, aber auf Kurs von Tönning gen Melbourne in Charter von Sloman & Co, Hamburg, geriet sie anno 1906 bei schwerem Novembersturm vor Kap Dungeneß auf die Klippen, konnte aber zehn Tage darauf nach London abgeschleppt werden, kam dann an den Norddeutschen Lloyd und wurde 1912 bei Ritscher in Hamburg-Moorburg zum Kohlenleichter umgebaut, der in Bremerhaven bis in die dreißiger Jahre Dienste tat. Die Galione war auf der Umbauwerft verblieben. Der Sportsegler Tietgen kaufte sie 1915 und ließ sie 1919 im Hamburger Jachthafen aufstellen.
Von dort geriet sie in Erbschaft nach Oevelgönne. Das war 1941. Die Farben zur Auffrischung waren knapp, deshalb wurde sie erst mal völlig in Kalkweiß gehüllt und bei sonstigem Platzmangel in dem soweit geräumigen »stillen Örtchen« untergebracht. Als ich dort gelegentlich ahnungslos die Tür öffnete – es war zudem schon dämmerig –, durchfuhr mich ein gelinder Schreck; ich glaubte wahrhaftig an ein Gespenst. Großer Schiller! Dir blieb nichts erspart.
Und die Mithüterin und Lotsentochter, die kühne Seglerin Hanna Meyer, war ungehemmt genug, aus dem »Venuswagen« des Meisters zu zitieren: Wo noch kein Europasegler brauste/kein Kolumb noch steuerte, kein/Kortez siegte, kein Pizarro hauste ...
Gemeint hatte der Poet natürlich das verlorene Paradies, die Insel eines unzerstörbaren Friedens. Und ich meine, es ist diese nie erreichte Küste, nach der alle die tausend Galionen, die je den Salzschaum geschmeckt, auch die, denen ich mit zum Leben verholfen, auf Ausguck standen. Gönnen wir ihnen ein sanftes Verständnis, wo immer wir ihnen noch begegnen in ihren Altersheimen und Snug Harbors. Wir waren betrübt, als der schmucke Rahsegler »Seute Deern« mit seiner Galione von der Hamburger Hafenkante auf anscheinend Nimmerwiedersehen verschwand. Er hatte eine Weile sich als phantastische Jugendherberge bewährt. Aber eines Tages lief er über Holland still in Bremerhaven ein und wird dort bleiben, gehegt und bewundert als ein antiquares Museumsstück.