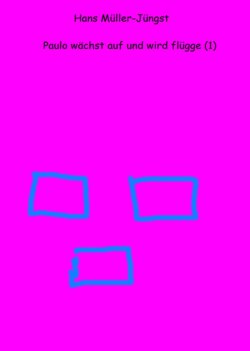Читать книгу Paulo wächst auf und wird flügge (1) - Hans Müller-Jüngst - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EBRO
ОглавлениеVater brachte nach Dienstschluss immer seine Uniform mit nach Hause. Die hing zusammen mit seinem Pistolenhalfter, seinem Gürtel und einem Knebel im Flur an der Garderobe.
Der Knebel war eine Kette, die Verhafteten um die Handgelenke geführt wurde, an deren Ende befanden sich verstärkte Griffe, die man ineinanderlegen konnte, sodass sie nur einen Griff bildeten.
Durch Verdrehen dieses Griffes zog man die Kette um die Handgelenke stramm und machte sich so den Verhafteten gefügig.
Mein Bruder und ich haben mit dem Knebel oft „Abführen“ gespielt, an die Pistole haben wir uns nicht getraut.
Vater hatte immer Schichtdienst beim Verkehrsunfallkommando. Er hatte die Führerscheine aller Klassen und konnte mit dem öffentlichen Personennahverkehr umsonst fahren.
Er fuhr immer mit dem Bus zum Dienst.
Stets trug er – auch im Sommer – lange Unterhosen. Wahrscheinlich hatte sich diese Angewohnheit aus der Kriegszeit erhalten, er war ja Soldat gewesen.
War er mittags zu Hause, so legte er sich unmittelbar nach dem Mittagessen hin und hielt einen zweistündigen Mittagsschlaf. Wir mussten in dieser Zeit leise sein, jedenfalls so leise, dass er nicht gestört wurde.
War er abends zu Hause, so saß er zumeist in der Küche und las Zeitung.
Vor den Fernseher setzte er sich nur zur Tagesschau, zur Wetterkarte und samstags zur Unterhaltungssendung.
Wochentags verließ er das Wohnzimmer unmittelbar nach der Wetterkarte.
Bekam er noch die Programmansagerin zu sehen, machte er oft die Bemerkung:
„Was ist das denn für ein Schmalzküken?“ oder er sagte empört:
„Mein Gott und das für unsere sieben Mark!“
Morgens oder nachmittags war Vater unten.
Unten waren der Hof, die Laube, der Schuppen, der Kaninchenstall und natürlich der Garten.
Er trug unten meistens seine Holzschuhe, die er Klotschen nannte.
Unten gab es jede Menge zu tun, nicht nur mussten die Kaninchen versorgt werden, es musste auch Holz gehackt, es mussten die Schuhe geputzt, es mussten die Hühner gefüttert und der Garten umgegraben werden.
Die Gartenarbeit variierte je nach Jahreszeit, war in der Regel aber immer anstrengend, jedenfalls für uns Kinder bzw. Jugendliche.
Mutter war immer dominant, was Vater aber akzeptierte, ohne als Pantoffelheld dazustehen.
Er sprach Mutter oft ein Lob für ihre Hausarbeit aus, besonders lobte er ihre Kochkunst.
Jedes Jahr ließ er sich wegen eines Ischiasleidens eine Kur verschreiben, sodass er bald alle Kurorte kannte. Später fuhr Mutter oft mit zur Kur, beide machten sie einen schönen Urlaub.
Von der Sanitätsstelle der Polizei brachte er jede Menge kostenloser Medikamente mit, so zum Beispiel gezuckerte Hustenpastillen, die wir „Knüsselchen“ nannten.
Er war ein schwer zu beschreibender Mensch, insgesamt war er eher ruhig (nicht still), lachte aber gern in Gesellschaft; vermutlich war er ein Kriegsopfer, redete aber nicht so gern darüber.
Seine Arbeit war wohl belastend, seinen Beamtenstatus wusste er aber auszukosten, jedenfalls ließ er gelegentlich seine Beziehungen spielen.
Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde wählte ihn später zum Kirchmeister.
Von da an spielte sich ein großer Teil der Gemeindepolitik bei uns zu Hause ab.
Die jeweiligen Pastoren gaben sich die Klinke in die Hand, mussten doch alle finanziellen Kirchenentscheidungen den Segen meines Vaters tragen.
Im Laufe der Jahre machte sich bei ihm ein verschlepptes Lungenemphysem bemerkbar, das er sich sicher im Kriege oder bei seiner Raucherei eingehandelt hatte.
Er verstarb im Jahre 1986.
Oma Buchecker wohnte unten im Hause, ihre Wohnung lag zur Hofseite hin. Sie stammte aus Ostpreußen, was man unschwer hören konnte, hängte sie doch an alles, was sie sagte, ein typisches „näch“ an.
Theo Kolb, dessen Schwiegermutter Oma Buchecker war, hatte die Wohnung nebenan. Er wohnte da mit seiner Familie, unter anderem mit seinem Sohn Theo, der etwa so alt war wie mein Bruder und ich, mit dem wir aber nicht so viel zu tun hatten.
Theo Kolb besaß einen Opel Kadett A, heute ein legendäres Modell, den er am Wochenende immer auf den Hof fuhr und dort wusch.
Wir schauten dann neidisch auf den weißen Wagen, denn wir hatten nie ein Auto besessen.
Mein Vater pflegte beim Thema Auto die Bemerkung zu machen:
„Auto fängt mit Au an und hört mit o auf!“
Sicher hatte er während seines Dienstes bei der Polizei schlechte Erfahrungen mit Autos gemacht, aber in erster Linie spielten wohl die Kosten eine Rolle.
Onkel Bruno und Tante Thea wohnten in der Stolbergstraße, ungefähr zehn Minuten Richtung Borbeck zu Fuß. Deren VW Käfer stand unten vor der Tür, war dunkelgrün und hatte das Kennzeichen E-A 971.
Tante Thea war oft leidend, sie sprach meistens so, als wollte sie gleich zu heulen anfangen.
Ich glaube, dass sie von Mutter missachtet wurde.
Mutter verstand es sehr gut, Menschen zu verstehen zu geben, ob sie sie mochte oder nicht, wenn nicht subtil, dann durchaus auch offen und direkt, was manchmal peinliche Züge annahm, wenn man dabei war.
An Weihnachten wurde die Tür zum Wohnzimmer mit einem stabilen Band an der Klinke verschlossen, abschließen konnte man die nicht.
Vor der Bescherung wurde dann in der Küche ausgiebig gegessen.
Das kleinste Geräusch wurde den Engelchen zugeschrieben, die im Wohnzimmer dabei wären, die Geschenke unter den Tannenbaum zu legen.
Das traditionelle Heiligabendessen war bei uns Kartoffelsalat, selbstverständlich mit selbst gemachter Majonäse, warmer Fleischwurst, Tatar und allerlei Wurst und Käse.
Für uns Kinder war die Spannung bis zur Bescherung kaum auszuhalten.
Wenn es dann soweit war, betraten wir mit großen Augen das Wohnzimmer und betrachteten zuerst den Tannenbaum.
Er stand in der Zimmerecke auf der Fernsehtruhe. Er war relativ spärlich geschmückt mit Lametta und Wunderkerzen.
Auf dem Zimmerboden davor lagen die Geschenkpakete.
Man erahnte schon an der Paketform das obligatorische SOS-Geschenk, Schlips, Oberhemd, Socken, oft auch noch Unterhosen.
Meine Aufgabe bestand darin, die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium vorzulesen.
Erst danach durften wir an unsere Geschenke.
Die mit Abstand besten Geschenke gab es für uns von Onkel Bruno und Tante Thea.
Beide kamen regelmäßig zu Heiligabend, um mit uns gemeinsam zu feiern.
Einmal schenkten sie uns ein Epidiaskop, das allerdings schon recht bald daran glauben musste. Wir stellten das kostbare Gerät unter das Bett, dachten nicht mehr daran und als wir auf dem Bett tobten, ging unser schönes Geschenk zu Bruch, unrettbar.
Ein anderes mal gab es eine Dampfmaschine, so wie sie heute noch zu kaufen ist.
Man erhitzte in einem kleinen Kessel mittels Esbittabletten Wasser und trieb mit dem unter Druck stehenden Wasserdampf alle möglichen Geräte an, das war eine richtig ausgeklügelte Technik, und wir freuten uns sehr.
Irgendwann verloren wir aber auch daran unseren Spaß.
Schließlich schenkten Onkel Bruno und Tante Thea uns Gewehre.
Man schob hölzerne Pfeile, die an der Spitze Gummisauger hatten, in den Lauf, wo sie eine Feder spannten.
Beim Betätigen des Hahnes flogen sie ziemlich weit. Später entfernten wir die Gummis und spitzten die Holzpfeile mit unseren Messern an.
Dann waren sie richtig gefährlich.
Nach dem Sichten der Geschenke und dem ersten Kosten der Süßigkeiten, die auf dem Weihnachtsteller lagen, nach dem ersten Anstoßen der Erwachsenen mit Wein und Bier, auch mit Schnaps, wurden Weihnachtslieder gesungen.
Zum Teil gab es unübliche Lieder, deren Text ich heute nicht mehr kenne.
Ich denke, die gehen auf meine Oma mütterlicherseits zurück, denn die war neuapostolisch.
Oma war natürlich immer dabei, sie wohnte später auch bei uns im Anbau.
Meine Oma Köhler, Vaters Mutter also, lebte in einem Altenheim in der Stadt.
Sie war erzkatholisch und es hieß immer, dass ihr die Schwestern das Geld aus der Tasche zögen.
Wir besuchten sie manchmal sonntags.
Gesungen wurde bei uns gern, nicht nur an Weihnachten.
Onkel Bruno sang immer Kopfstimme, sehr hoch und sehr schön.
Vater hatte keine gute Singstimme, er grölte immer ein bassähnliches Geräusch dagegen, oft falsch.
Die anderen hielten sich zurück, man konnte sie aber gut vernehmen.
Wenn auf der stark befahrenen Bottroper Str., auf der wir wohnten, ein Bus oder LKW vorbeifuhr, wackelte das ganze Haus.
Die Bottroper Str. war eine Hauptverkehrsstraße. Ein Großteil unserer Katzen, von denen später noch die Rede sein wird, war auf dieser Straße überfahren worden.
Wir beerdigten sie alle bei unserer Bude hinten im Garten.
Sie bekamen sogar ein Holzkreuz.
Die Bude hatten wir gebaut, indem wir ein großes Loch aushoben, dieses mit einem Türblatt abdeckten und darauf wiederum Mutterboden schaufelten, sodass man außer einer kleinen Bodenerhebung nichts von unserer Bude wahrnehmen konnte.
Wenn wir uns in der Bude aufhielten, rauchten wir oft Zigaretten, die wir aus alten Teeblättern gedreht hatten oder wir fuhren mit unserer Karre zur Bushaltestelle am Sulterkamp, sammelten weggeworfene Kippen, fuhren zurück zur Bude und pulten den Tabak aus den Zigarettenstummeln heraus.
Meistens drehten wir daraus Zigaretten mit Zeitungspapier.
Einer guckte immer aus der kleinen Luke, die wir gelassen hatten und beobachtete den Garten, ob Vater oder Mutter in der Nähe waren.
Vor der Bude gab es an der Gartenabschlussmauer eine Kochstelle. Das war ein Geviert aus Ziegelsteinen, über welche ein alter Backofenrost gelegt wurde. Mutter hatte uns einen ihrer Töpfe überlassen und wir machten oft Feuer und kochten zum Beispiel Suppe aus Maggiwürfeln.
Die Karre, die schon erwähnt wurde, war für uns ein wichtiges Transportmittel.
Sie war eine Konstruktion aus einem langen Brett, unter dessen Enden alte Kinderwagenachsen montiert wurden.
Bevor die Räder darauf geschoben wurden, kam eine Portion Staufferfett auf die Achsenden, damit die Räder leicht liefen.
Die vordere Achse wurde drehbar montiert und mit Seilen versehen, die wie Zügel benutzt wurden, und mit denen man somit die Karre lenken konnte.
Einer setzte sich darauf, während der andere mit einem alten Schüppen- oder Besenstiel anschob.
Bergab lief die Sache natürlich von selbst, sofern man die Karre vorher bergauf geschoben hatte.
Wir haben unsere Karre viele Jahre benutzt und ein ähnliches Modell in einem Schwarzwaldurlaub gebaut – davon später mehr.
Im Herbst bauten wir uns Drachen oder Windvögel, wie wir sagten.
Dazu besorgten wir uns schmale Tapezierleisten, die es in den entsprechenden Geschäften zu kaufen gab.
Aus den Leisten wurde ein großes Kreuz gebaut.
Rund um das Kreuz wurde ein an den Enden der Leisten befestigtes Band gespannt.
Die Querleiste wurde leicht nach innen gebogen und die Spannung mit einem kurzen Stück Band, das an deren Enden befestigt war, gehalten.
Das Band wiederum wurde durch eine ganz kurzes Stückchen Leiste, welches in der Mitte der Querleiste aufgestellt wurde, gespannt.
Legte man dieses Stückchen Leiste um, war die Spannung aus dem Drachen genommen.
Jetzt wurde das Leistenkreuz mit großen Papierbögen verklebt.
Zeitung eignete sich dazu nicht, weil sie zu leicht einriss.
Es gab zu diesem Zweck eigens verstärktes Drachenpapier, das man bei uns im Zeitschriftenhandel bei Frau "Ulbricht" erstehen konnte.
War der Drachen soweit gediehen, wurde an das Kreuzende ein langes Band befestigt, aus dem dann der Drachenschwanz, meist aus Grasbüscheln, entstand.
Es war schon eine gehörige Windstärke nötig, um die recht schwere Drachenkonstruktion in die Luft zu erheben.
Es klappte aber jedes mal recht gut, war der Drachen einmal in der Luft, musste man nur darauf achten, dass er nicht zu tief absank.
Es waren immer zwei Leute nötig, um den Drachen steigen zu lassen.
Einer musste den Drachen startbereit hochhalten, der andere lief mit gespannter Leine los, bis sich der Windvogel weit genug in die Höhe begeben hatte, um dann Leine nachzulassen.
Die große Wiese, die sich hinter dem uns gegenüberliegenden Jugendheim anschloss, war der geeignete Ort, um die Windvögel steigen zu lassen.
Auf der anderen Seite des Hauses wohnte Ferdinand Pilz.
Er war alt und hatte einen unglaublichen Buckel. Immer, wenn man ihn sah, bat er:
„Kratz mich doch mal am Rücken!“
Er selbst konnte das aus verständlichen Gründen nicht.
Herr Pilz hatte auf der Seite des Gartens, die der unsrigen gegenüber lag, eine große Voliere, in der er unzählige Kanarienvögel und Wellensittiche hielt.
Er lebte mit seiner Schwester Friedchen zusammen (ich weiß nicht, wie deren korrekter Name war).
Über den beiden wohnte Herr Prinz mit Frau. Er hatte eine Steinstaublunge und werkelte oft in seinem Schuppen auf dem Hof.
Ich ging immer dorthin, um zu rauchen.
Neben dem Gang zum Hof wohnte Herr Lukaj mit seiner Schwester in einem sehr alten kleinen Häuschen.
Wir wussten nicht viel über die beiden, sicher waren sie Flüchtlinge. Sie hatten einen großen Garten wie wir und einen Hund, der hieß Blacky.
Immer, wenn man den Gang entlang auf den Hof ging oder wenn eine unserer Katzen zum Hof lief, rannte er laut kläffend den Zaun entlang.
Er war eine kleine schwarz-weiße Promenadenmischung. Herr Lukaj hielt auch Tauben, ich glaube, um sie zu essen.
Frau Lukaj sah man kaum.
Vater oder Mutter unterhielten sich manchmal über den Zaun hinweg mit einem von beiden.
Sie sprachen dann einen kaum zu verstehenden westfälischen Dialekt, jedenfalls glaube ich, dass es einer war.