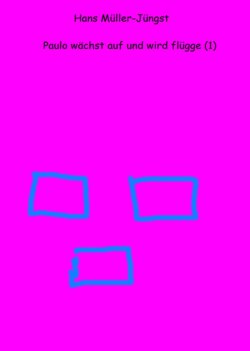Читать книгу Paulo wächst auf und wird flügge (1) - Hans Müller-Jüngst - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Tajo
ОглавлениеZu Haus gab es zu Mittag Dinge zu essen, die man heute nicht mehr auftischt, zumindest wird man Verwunderung auslösen, wenn man Pilzgulasch, Nierchen, Stielmus, Himmel und Erde (gebratene billige Blutwurst mit Apfelmus und Kartoffelpüree) Panhas (das kennt heute kaum noch jemand) oder Hühnersuppe mit Magen und Herz serviert.
Als gymnasiales Großmaul hatte ich natürlich immer was zu meckern, Mutter war dann oft ganz fertig, ich rückte auch nach mehrmaligem Nachfragen nicht mit der Sprache heraus.
Ziemlich regelmäßig kam gegen vierzehn Uhr Oma hoch.
Sie wohnte im Anbau und hatte mit den Treppen zu kämpfen, die zu uns hoch führten.
Oma war neuapostolisch.
Ich denke, damit hing zusammen, dass sie statt eines Arztes einen Homöopathen aufsuchte, wenn sie gesundheitliche Probleme wie ihre Herzschmerzen therapiert haben musste.
Sie klagte, besonders wenn sie zu uns hereinkam, über Herzschmerzen und ließ sich in den Küchensessel fallen, um auszuruhen.
Wenn dann aber die Skatkarten auf dem Küchentisch lagen und wir zu spielen anfangen wollten, waren alle Herzschmerzen schnell vergessen.
Oma spielte gut Skat und freute sich immer, wenn sie ein Spiel gewonnen hatte („Da haben wir das Ferkel wieder geschlachtet!“).
Wir spielten fast jeden Mittag.
Nach jedem Spiel wurde gezahlt, es ging um einen Zehntel Pfennig, es wurde aufgerundet, ein einfacher Kreuz Solo kostete somit drei Pfennige, ein Grand mit Dreien – der Grand zählte bei uns zwanzig – acht Pfennige.
Kontra und Re verdoppelten jeweils, bei verlorenem Kontra, bei Re, bei einem Spiel ab hundert – zum Beispiel bei einem Grand mit Vierer, bei einem sechziger Spiel („der Arsch hat sich gespalten“) oder bei Schwarz - wurde Bock gespielt. Ramschen gab es bei uns nicht.
Viel Geld gewann oder verlor man so nicht!
Wenn Vater da war, das heißt, wenn er Spätschicht hatte, spielte er kurz auch mit.
Oder wir würfelten, wenn Oma mal nicht da war, das konnte man auch zu zweit.
Entweder wir spielten ein Spiel, das wir „tausend“ nannten oder wir „kniffelten“, dabei musste man immer zuerst die Kniffeltabelle aufzeichnen. Oft gab es einen Einsatz, zum Beispiel zwanzig Pfennige, den der Gewinner bekam.
Mutter trank beim Spielen immer Kaffee, Oma auch, das war das „Näppchen“.
Zum Kaffee wurden „Bärenmarke“ und Zucker genommen.
„Glücksklee“ war verpönt, es musste „Bärenmarke“ sein, der Kaffee war immer „Tschibo“-Kaffee.
Dienstags und freitags war in Borbeck Wochenmarkt (mercado).
Das war eine uralte Einrichtung.
Der Wochenmarkt fand natürlich immer auf dem Marktplatz statt.
Ich erinnere mich an den „billigen Jakob“, der Heftpflaster meterweise verkaufte, der Fischhändler hatte ein Heringsfass, Kieler Sprotten gab es in Spankörben.
Rogen und Milchner wurden verkauft und zu Hause in der Pfanne gebraten, Mutter kannte man schon auf dem Markt, sie ging immer zu denselben Händlern. Oft gab man ihr ein Extra, wie zum Beispiel ein Stück Fleischwurst oder ein paar Äpfel.
Sie fuhr mit ihrem Rad zum Markt, den gleichen Weg, den wir zur Schule nahmen.
Schwer bepackt rollte sie bergab nach Hause.
Sie war stolz darauf, dass sie den Weg bis ins hohe Alter mit dem Rad bewältigte, während andere Frauen den Bus benutzten.
Mutter hatte einen Riecher für Sonderangebote.
Manchmal fuhr sie außer der Reihe mit dem Rad los, um ein Sonderangebot zu kaufen, von dem sie in der Zeitung gelesen hatte.
Sie war äußerst sparsam, sie war nicht geizig.
Auf dem Markt wurde auch die Wurst gekauft, die wir zu Hause vertilgten.
Ich erinnere mich an Zungenwurst, Schwartemagen, grobe geräucherte Leberwurst und an Corned Beef, Fleischwurst gab es immer.
Es ging nichts über ein frisches, noch leicht warmes Brötchen mit guter Butter und Fleischwurst oder frischer Zungenwurst.
Der Begriff gute Butter stammt noch aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, als es keine Butter gab.
Wie ja überhaupt Nahrungsmittelknappheit herrschte.
Ein Stück gutes Fleisch wurde als Delikatesse angesehen.
Verschiedene Wurstsorten galten fast als Luxus.
Ich hatte aber nie Hunger gelitten und konnte mir die Situation, in der viele nach dem Kriege Hunger litten, kaum vorstellen.
Es wurde aber von meinen Eltern manchmal an die Hungerzeit erinnert, wenn wir den Teller nicht leer aßen, wurde gesagt:
„Wir waren früher froh, wenn wir eine Scheibe trockenes Brot hatten“.
Käse war eigentlich auch immer im Kühlschrank. Meist gab es Holländer, das war junger Gouda.
Vater aß aber auch Stinkkäse („Limburger“) und Camembert.
Der Kühlschrank war abschließbar, ich weiß aber nicht, ob wir überhaupt einen Schlüssel hatten.
Wir kauften eigentlich nur ganz selten in der Nachbarschaft ein, so bei „Prenting“, bei „EKU“ schon gar nicht, höchstens, wenn man mal etwas vergessen hatte.
Oder wir Jungen kauften für zehn Pfennig rohes Sauerkraut, das wir mit den Fingern verdrückten. Für Sauerkraut fuhren wir mit unserer Karre auch bis zum Metzger Dicke.
Früher gab es in den Lebensmittelläden Rabattmarken, die man in Markenbücher klebte.
Für ein volles Markenbuch gab es Geld.
Die Rabattmarken entsprachen in ihrem Wert drei Prozent Skonto.
Früh am Morgen brachte Bäcker Goworrek mittwochs und samstags das Brot.
Mutter nahm immer ein Kassler, manchmal einen Stuten, ein Schwarzbrot (Pumpernickel) und samstags ein paar Brötchen.
Die gekaufte Menge wurde in ein Heft eingetragen und am Samstag bezahlt.
Dieser Brauch war sicher aus der Zeit übrig geblieben, als es noch Wochenlöhne gab.
Manchmal stand ich noch beim Anziehen in der Unterhose, wenn Herr Goworrek klopfte und unmittelbar darauf eintrat.
Er trug einen stabilen Karton auf dem Arm, in dem er die Backwaren hatte.
Milch wurde von Willi Winn gebracht.
Er hatte hinter der Gaststätte „Buchmöller“ eine Milchstube. Herr Winn kam mit Pferd und Wagen, er verkaufte in der Anfangszeit die Milch lose.
Dazu hatte er auf seinem Wagen einen Pumpmechanismus, mit dem er die Milch in die mitgebrachten Milchkannen füllte.
Später gab es Glasflaschen mit Aluminiumkappe. Auch Kakao wurde so verkauft.
Man bekam Liter- und Halbliterflaschen. Die Schulen hatten auch Viertelliterflaschen. Der Milchof war „Kutel“, dort wurde die Milch abgefüllt.
Ich habe da mal drei Wochen lang gearbeitet.
Meine Aufgabe bestand darin, hinter den Flaschenkästen, die auf einem Transportband zur Spülmaschine bewegt wurden, herzulaufen und die Reste der Alukappen zu entfernen, bevor die Flaschen in der Spülmaschine verschwanden.
Dazu bekam ich morgens ein Paar Gummihandschuhe, das am Nachmittag bei Feierabend aufgebraucht war, weil die scharfen Alureste das Gummi zerschnitten hatten.
Alureste blieben deshalb auf den Flaschen, weil die Alukappe meist mit dem Daumen eingedrückt wurde und danach ein Ring übrig blieb.
Das war eine der vielen Ferienarbeiten, die ich ausübte, bei denen ich permanent auf die große Uhr schaute, die in der Halle hing.
Ich dachte, wie gut, dass Du so eine Arbeit später nicht wirst machen müssen.
Mutter erzählte immer, dass wir manchmal sieben Liter Milch am Tage tranken.
Oben auf der Milch schwamm oft eine zwei Zentimeter dicke Rahmschicht. Nach dem Spielturnen stand ich oft am Kühlschrank, aß mit einem Teelöffel den Rahm ab und trank dann aus der Flasche große Mengen, gelegentlich trank ich einen Liter leer.
Im Alter von ungefähr sechzehn Jahren arbeitete ich in Borbeck in einer Brotfabrik.
Ich glaube, Vater hat mir den Job besorgt.
Die Arbeit als solche war gar nicht schwer, ich musste mit jemand anderem Rohteig von einem Wagen in die Backkörbe legen.
Oder lange Schwarzbrotstränge mussten zerschnitten werden.
Am Anfang freute ich mich immer über die Teilchen, die es für die Beschäftigten kostenlos zu essen gab. Sehr schnell hingen die einem aber zum Halse hinaus. Ich lernte hier Bäckermeister kennen, die ihren Betrieb aufgeben mussten und jetzt in der Brotfabrik niedere Tätigkeiten verrichteten.
Das Anstrengendste war der ungewohnte Tagesrhythmus.
Die Arbeit begann um vier Uhr morgens und endete um zwölf Uhr dreißig. Das bedeutete: drei Uhr aufstehen, Mutter weckte mich immer, ein bisschen frühstücken und dann mit dem Fahrrad nach Altendorf, das lag noch hinter Borbeck.
Einmal hielt mich mitten in der Nacht die Polizei an und machte mich darauf aufmerksam, dass mein Licht nicht funktionierte.
Ich durfte aber weiterfahren.
Um circa ein Uhr mittags war ich wieder zu Hause, aß mein Mittagessen und ging ins Bett.
Kurz stand ich abends zum Intermezzo (Fernsehen am Vorabend) auf und legte mich dann sofort wieder hin.
Um drei Uhr wurde ich wieder geweckt.
Ich hätte mich wohl nie an so einen Tagesablauf gewöhnen können.
Nach drei Wochen war diese Ferienarbeit beendet.
Es war nach den Ferienjobs immer ein gutes Gefühl, Geld verdient zu haben, obgleich die Tariflöhne für Aushilfskräfte damals lächerlich niedrig lagen.
Ich arbeitete auch bei „Baustoffe Sommer“, wo ich Tonrohre verladen musste und mich hinterher bestens im Bereich Tonrohre auskannte, auch bei der Tankstelle „Erich Warm“, wo ich statt zu tanken erst einmal den Aufenthaltsraum aufräumen musste.
Meine besten Ferienjobs waren aber beim Straßenbau.
Man assoziiert bei Straßenbau sofort schwere körperliche Arbeit.
Die gab es zum Teil sicher auch, wenn ich an die schweren Bordsteine denke, die verlegt wurden oder an Gehwegplatten, die dem Fliesenleger angereicht werden mussten, da tat einem schon das Kreuz weh.
Auch einen Sack Zement schleppte man nicht so ohne weiteres, er wog schließlich fünfzig Kilogramm. Aber die Arbeit war abwechslungsreich und wurde an der frischen Luft verrichtet.
Ich weiß heute noch, wie wir in Bottrop mit unserer Bautruppe einen Kanal verlegen mussten.
Mitten auf der Straße wurde ein großer Graben gezogen, das wurde mit unserem Bagger gemacht, einem alten riesigen Seilzugbagger.
Die Grabenwände wurden mit Spunddielen abgestützt.
Auf den Grabenboden kam ein Kiesbett, auf welches die Kanalrohre aus Beton gesetzt wurden. Die einzelnen Rohre wurden ineinander geschoben und mit einem Gummidichtring gegen einander abgedichtet. Der Polier war dafür zuständig, dass die Rohre in der Flucht lagen.
Die Rohre wurden mit dem Bagger in den Graben gehoben.
Um die Spunddielen zu setzen, wurde eine Dampframme benutzt, die offensichtlich gerade in Betrieb genommen und auf unserer Baustelle ausprobiert wurde.
Die funktionierte eigentlich prima.
Wenn die Rohre lagen, wurden die Spunddielen wieder entfernt und der Graben wurde zugeschüttet.
Oft kamen die Hausbesitzer heraus und bestachen uns mit einem Kasten Bier, um als erste an den Kanal angeschlossen zu werden.
Für das Entfernen der Spunddielen konnte die Dampframme auch in der umgekehrten Richtung arbeiten.
Da das aber zu lange dauerte, befestigte man ein Drahtseil mit einem Haken an der Baggerschaufel und zog die Dielen aus dem Erdboden.
Das ging so lange gut, bis eines Tages eine Spunddiele so fest saß, dass beim Ziehen der Haken geradebog, aus dem Spunddielenloch rutschte und sich die volle Zugspannung auf den Baggerausleger übertrug.
Der schlug zurück, zerriss dabei eine Telefonleitung und drückte den Führerstand des Baggerfühers ein.
Der Baggerführer blieb Gott sei Dank unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.
Meine Güte, war das ein Schock! Wir mussten alle tief durchatmen.
Was aus dieser Sache geworden ist, ob die Bauaufsicht eingeschaltet wurde, das kann ich heute nicht mehr sagen.
Auf einer anderen Baustelle mussten entlang einer reparierten Straße Bordsteine gesetzt werden.
Dazu wurde für die einhundertacht Kilogramm schweren Steine ein Stuhl aus Beton gegossen, auf den sie gesetzt wurden.
Den frischen Asphalt walzte ein Arbeiter schön aus. Natürlich gab es zu meiner Zeit keine Dampfwalze mehr, der Begriff wurde aber übernommen.
Bemerkenswert an unserem Walzenfahrer war, dass er während eines Arbeitstages einen ganzen Kasten Bier trank, ohne bei Feierabend völlig besoffen von seiner Walze zu kippen!
Das war unglaublich.
Es wurde überhaupt früher während der Arbeit viel gesoffen.
Ich erinnere mich, dass ich einmal im Hochbau beschäftigt war.
Wir wurden morgens alle mit einem Ford Transit zur Baustelle gefahren.
Zuerst hielt der Wagen aber an einer Bude, wo sich die Arbeiter mit Alkohol versorgten.
Morgens um sechs Uhr wurden schon diverse Fläschchen „Doornkaat“ vertilgt.
Das Bier wurde dann mitgenommen und wenn es nicht reichte, noch einmal aufgefrischt.
Heute ist die Berufsgenossenschaft da hinterher. Gesoffen wird wohl heute nicht mehr auf dem Bau, jedenfalls nicht mehr so viel wie früher.
Auch bei meinem Bruder, der in Holland ein Baugeschäft betrieb, war das so.
Da habe ich auch einmal gearbeitet, allerdings war ich da schon Student.
Auch eine abweschlungsreiche Beschäftigung.
Der sogenannte „Aannemingsbedrijf“ macht alle Arbeiten, die am Bau zu verrichten waren, zum Beispiel auch das Dachdecken.
In Deutschland gab es dafür verschiedene Betriebe. Der Lotgieter (Bleigießer) war bei uns der Klempner.
Ich hatte in Holland zehn Gulden netto die Stunde verdient, das war ein guter Verdienst.
Während meines Studiums hatte ich auch in einer Flanschenfabrik gearbeitet.
Flanschen sind stählerne Verbindungsringe zwischen zum Beispiel Röhren. Sie werden aus großen Eisenplatten gebrannt, anschließend werden mit einer Bohrmaschine Löcher in den Ring gebohrt und mit einem Winkelschleifer Grate entfernt.
Das war meine Tätigkeit.
Auch eine Beschäftigung, die man sich nicht für ein Leben lang wünschte.
Ganz früher hatten mein Bruder und ich mal bei Schuhhaus Korsch in Borbeck den Keller aufgeräumt. Eine sehr stumpfsinnige Arbeit.
Morgens aß ich vor der Schule immer einen Teller Haferflockensuppe.
Ich streute einen Kaffeelöffel Zucker darüber.
Ich glaube, heute hätte ich das nicht mehr so gern.
In letzter Minute verließ ich dann das Haus, um noch den Bus zu kriegen.
Oft verließ ich das Haus und sah ihn am Sulterkamp losfahren, dann rannte ich los, um ihn an der Heegstraße noch zu bekommen.
Ein Essenshighlight war bei uns Kotelette (chuleta) mit Kartoffeln und Salat.
Außer dem Kotelette war alles Eigenproduktion.
Wenn Mutter mir beim Essen zusah, nahm sie oft die Gabel und lud mir noch ein Kotelette auf, obwohl ich mit dem einen noch gar nicht fertig war.
Einmal war ich bei Oma zum Koteletteessen eingeladen.
Sie war ganz offensichtlich stolz, mal wieder jemanden bewirten zu können.
Opa war schon seit 1958 tot.
Ich erinnere mich noch, wie wir alle in die Wertstraße nach Dellwig gefahren sind, Opa lag tot im Bett, Mutter weinte.
Ganz in der Nähe wohnten Tante Anna und Onkel Gustav, Verwandte von Oma.
Opa war ein netter Typ, er mochte uns Kinder sehr. Er bastelte uns tolles Spielzeug, wie einen großen Holz – LKW, auf den man sich setzen konnte.
Er konnte sehr gut malen und kopierte Postkarten oder sonstige Vorlagen in Öl.
Ölfarben waren sündhaft teuer.
Auch schuf er barock anmutende Bilderrahmen, dazu mischte er einen gipsähnlichen Brei nach Geheimrezeptur an, den er dann modellierte.
Im fertigen Zustand überzog er ihn mit Goldbronze.
Zwischenzeitlich war er Busfahrer bei der Stadt.
Es ging in das Gerücht, dass er mittags zu Hause hielt, um zu essen, während die Fahrgäste im Bus auf ihn warten mussten.
Das war, als Oma und Opa noch in der Heegstraße wohnten, im letzten Haus vor der Eisenbahnbrücke.
In der Heegstraße, aber auch bei uns in der Bottroper Straße, gab es ganz früher noch Gaslaternen.
Bei Dunkelheit ging ein Mann, den wir Gasmann nannten, von Laterne zu Laterne und zog mit einer langen Stange an einer Öse, die sich ganz oben im Laternenkopf befand, kurze Zeit später leuchtete die Laterne.
Einmal wurde auf dem Schlachthof ein halbes Schwein gekauft, das Opa fachgerecht zerlegen musste.
Viele konnten früher schlachten, Opa auch.
Der Küchentisch wurde längs gestellt, ein Wachstuch war schon darauf.
Ich setzte mich auf das Küchensofa und schaute zu.
Irgendwo wurde das Fleisch eingefroren, ich weiß nicht, wer schon eine Gefriertruhe besaß.
Das Wursten war im wesentlichen Kochen.
Es wurde Leberwurst mit viel Majoran gemacht,
Blutwurst wurde mit Speck gekocht und zum Schluss wurde auch noch Panhas zubereitet, der wurde mit Grütze versehen.
Was ich bis heute nicht vergessen hatte, war, wie Opa plötzlich eine Tasse voll Blut nahm und diese austrank. Mir wurde beinahe schlecht, als ich das sah.
Die Wurst wurde in Einweckgläser gefüllt und dann in den Keller gebracht.
Opa rauchte immer Stumpen von der Bude, meistens Handelsgold, das Stück zu zehn Pfennige. Stumpen waren im Querschnitt quadratisch und insgesamt dünner als Zigarren.
Beim Malen mit schlechtem Licht hatte er sich die Augen verdorben und war fast blind.
Ich glaube, er trug sogar das Blindenzeichen am Mantel.
Er starb an Lungenkrebs.
Dr. Rachner hatte ihn regelmäßig behandelt, er hatte da aber keine Chance.
Dr. Rachner fuhr immer mit dem Fahrrad zu den Patienten und drehte Zigaretten.
Er hatte seine Praxisräume am Leimgardsfeld/Ecke Stolbergstraße über dem Kruppschen Konsum und war unser Hausarzt. Ich weiß noch, wie ich als Kleinkind eine Edelstahlmurmel verschluckt hatte und Mutter daraufhin mit mir zu Dr. Rachner ging. Ich musste so lange Sauerkraut essen, bis die Murmel meinen Körper wieder auf natürlichem Wege verlassen hatte.
Das klappte tatsächlich, ich saß auf einem Emailletöpfchen und konnte hören, wie die Murmel hinunter fiel.
Ich werde jetzt die Geschichte von „Peter und Fips“ wiedergeben, die uns Opa als Kinder erzählt hatte und der wir vollkommen gebannt zuhörten: