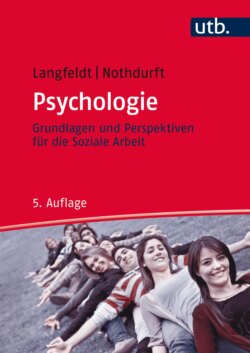Читать книгу Psychologie - Hans P. Langfeldt - Страница 8
Оглавление2. Psychologie als Wissenschaft
In diesem Kapitel erläutern wir, was es bedeutet, psychologische Erkenntnisse als wissenschaftliche Erkenntnisse zu betrachten.
Zu diesem Zweck berichten wir zunächst, wie Psychologie als Wissenschaft zustande kam und sich entwickelt hat (2.1.). Im Verlauf dieser Geschichte hat sich die Psychologie in Spezialgebiete ausdifferenziert, die wir anschließend vorstellen (2.2.). Den Prozess der Erkenntnis psychologischen Wissens beschreiben wir in allgemeiner Weise (2.3.). Darüber, wie der Wissenschaftscharakter der Psychologie zu bestimmen ist, gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen. Die wichtigsten stellen wir in Abschnitt 2.4. vor. Psychologische Erkenntnis unterscheidet sich vom »gesunden Menschenverstand« u. a. durch das transparente, nachvollziehbare methodische Vorgehen. Zwei Methoden psychologischer Erkenntnisgewinnung stellen wir in Abschnitt 2.5. vor: Experiment und Feldforschung. Durch solche Methoden werden Daten gewonnen, deren Interpretation keineswegs selbstverständlich ist. Innerhalb der Psychologie gibt es eine Reihe von Standards, mit denen Daten interpretiert und verarbeitet werden können, um auf dieser Grundlage zu empirisch gesicherten psychologischen Erkenntnissen kommen zu können (2.6.).
2.1. Psychologie in Europa: Lange Vergangenheit, kurze Geschichte
von Elisabeth Baumgartner
»Die Psychologie hat zwar eine lange Vergangenheit, aber eine kurze Geschichte.« Dieser, von dem Gedächtnisforscher Hermann Ebbinghaus (1850 – 1909) auf dem vierten Internationalen Kongress für Psychologie in Paris im Jahre 1900 vorgetragene Satz ist wohl der meistzitierte in der Geschichtsschreibung der Psychologie.
Was wollte Ebbinghaus damit zum Ausdruck bringen? – Er beschreibt die Situation der akademischen Psychologie um die Jahrhundertwende, die bestrebt war – besser gesagt, einige ihrer Fachvertreter waren es – sich von der Philosophie, innerhalb derer die Psychologie traditionsgemäß angesiedelt war, zu lösen.
Altertum
Die Philosophie war seit ihren Anfängen im Altertum die Wissenschaft, die sich mit psychologischen Fragen auseinander setzte. Beispielsweise befassten sich schon die vorsokratischen Eleaten ebenso wie Heraklit mit dem Problem des Denkens und seiner Übereinstimmung mit der Wirklichkeit. Platons (427 – 347 v. Chr.) Dialoge sind, wie wir heute sagen würden, Meisterwerke »psychologischer Gesprächsführung«. Er postulierte, die wahre Wirklichkeit liege in der Welt der Ideen, nicht in der Welt der Sinne und Empfindungen. Diese Hochschätzung des Begrifflichen hatte und hat großen Einfluss auf die abendländische Tradition (vgl. Müller 1971, S. 1).
Aristoteles
Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) ist die Hauptquelle der Psychologie, teilweise bis in die Neuzeit, geblieben. In seiner Schrift »Über die Seele« beschreibt er die Seele (Psyche), die sich als wirkendes Prinzip auf dreierlei Weise äußere:
als Vitalseele (belebend, ernährend);
als Animalseele (empfindend, fühlend, sinnlich begehrend);
als Geistseele (denkend und wollend).
Diese Einteilung hat die Psychologie lange geprägt. Die Beschreibung der »Seelenkräfte«, des »Seelenvermögens« oder der »psychischen Kräfte und Funktionen« entsprechend der Einteilung des Seelenbegriffs beschäftigte die Philosophen aller folgenden Jahrhunderte.
Bezug zur Gegenwart
Auch die heutige wissenschaftliche Psychologie greift auf dieses Modell zurück: die Allgemeine Psychologie mit ihren Klassifikationen des Psychischen in Emotion, Kognition und Motivation (vgl. Pongratz 1967, S. 70); Richtungen der Persönlichkeitspsychologie, die an Schichttheorien orientiert sind; in besonderer Weise aber die Psychoanalyse. Schönpflug (2000, S. 72) meint gar, dass in der Bestimmung des Aristoteles »eine Vielfalt von Domänen [...] für Forschungsprogramme vorweggenommen« sei.
Die abendländische Beschäftigung mit der Psyche führt also, soweit schriftlich nachgewiesen, ins 3. und 4. Jahrhundert v. Chr. zurück. Auch in Asien, in Indien und China existierten Seelenlehren innerhalb des Buddhismus, des Taoismus und des Konfuzianismus, die im Sinne von praktischer Ethik als Wegweiser der Lebensführung dienten. Sie hatten für die abendländische Psychologie in ihrer wissenschaftlichen Ausrichtung wenig Bedeutung. Als Techniken der Entspannung und Meditation fanden jedoch einige Ansätze Eingang in Therapieformen der Klinischen Psychologie.
Augustinus
Im Zuge der Christianisierung des Abendlandes wird auch die Philosophie »getauft«, ja schließlich als »ancilla theologiae«, als Magd der Theologie aufgefasst. Die altgriechischen Seelenvorstellungen werden im Licht des neuen Glaubens gesehen. Die Seele wird als göttliche Einhauchung verstanden; als nicht dem Körper zugehörig, wohl aber von ihm, seinen Bedürfnissen und Strebungen beeinflusst. Augustinus (354 – 430) beschreibt in seinen »Confessiones«, in »Selbstgespräche« und in »Über die Größe der Seele« die neue Auffassung, die Platonismus und christliche Glaubenslehre zu vereinbaren versucht. Gewissensforschung und Selbstbeschreibung sind seine Methoden. Die seelischen Funktionen sieht er (nach Hehlmann 1982, S. 33) als »wohl verbunden mit den äußeren Sinnen und ihren Organen... Daneben aber stehe der innere Sinn mit den bewahrenden und beziehenden Funktionen des Gedächtnisses, des Denkens, des Wollens. Sie seien spezifisch menschlich. Sie entsprechen der Trinität Gottes und repräsentieren gleichzeitig die Einheit in der Mannigfaltigkeit. Von der niederen Form der Vernunft, die sich an die Sinneserkenntnisse knüpft, unterscheidet Augustin die höheren Seelenvermögen. Mit ihrer Hilfe könne der Mensch zur Schau der ewigen Ideen aufsteigen. Diese seien jedoch nicht, wie Platon meinte, Erinnerungen aus einem früheren Leben im Ideenreiche. Der Mensch habe sie durch ›göttliche Erleuchtung‹ erhalten, und in ihnen besitze er zugleich das Werkzeug, ständig aus dem Leben im Vergänglichen aufzusteigen, um an der unveränderlichen Wahrheit teilzunehmen.«
Mittelalter
Die letzte Erkenntnis wird also nicht aus den Sinneserfahrungen gewonnen, sondern sie ist als Innewerden unveränderlicher Wahrheit göttlichen Ursprungs. Der Gedanke, dass der inneren Erfahrung einzig Gewissheit zukomme, dass ich an allem zweifeln könne, nur nicht daran, dass ich denke, nimmt das »cogito ergo sum« des Descartes (1596 – 1650) vorweg. Im 19. Jahrhundert greift Franz Brentano (1838 – 1917) mit seiner Bestimmung der »Intentionalität« des Psychischen wieder darauf zurück. Die Psychologie des Augustinus war bestimmend für das Mittelalter. Sie wurde weiter ausgeformt von Thomas von Aquin (1225 – 1274), den vor allem das Leib-Seele-Problem interessierte, also die Frage, wie Leib und Seele aufeinander wirken, wie die Verknüpfung vorgestellt werden kann, ob jeder Teil des Körpers beseelt sei.
Gegen Ende des Mittelalters (bzw. der Scholastik) wendet sich das Interesse von der bis dahin vorherrschenden Beschäftigung mit den Möglichkeiten des Erkennens dem Phänomen des Wollens zu. Duns Scotus (vor 1270 – 1308) und Wilhelm von Occam (um 1300 – 1349) betonen: Der Mensch ist in erster Linie ein wollendes Wesen. Wollen ist »radikale Spontaneität« (nach Hehlmann 1982, S. 55).
Neuzeit
Damit ist der Übergang zur Neuzeit eingeleitet, zur Renaissance, in der nun der »ganze Mensch« im Mittelpunkt des Interesses stand. Von psychologischem Interesse sind nun die Individualität, der Einzelmensch, die Charaktererfassung. Die Leidenschaften und Affekte werden nicht mehr als »niedrige Regungen«, die es zu unterdrücken gilt – wie im theologischen Kontext des Mittelalters – aufgefasst, sondern auch sie werden untersucht. Gelehrte Ärzte verfassen Abhandlungen zur Psychologie, so Paracelsus (1493 – 1541), der den Dualismus von Leib und Seele ablehnt und den Menschen als ganzheitliches Wesen, als Mikrokosmos betrachtet. Praktischen Fragestellungen (im heutigen Sinne) widmete sich schon Juan Huarte (um 1520 – 1589). In seinen Untersuchungen über die »Prüfung der Anlagen für die Wissenschaft« findet er humorale, klimatische und zerebrale Bedingungen für die Unterschiede in Begabung und Intelligenz und schließt pädagogische und eugenische Ratschläge an.
Die Zeit der Renaissance kann als Zeit der großen Horizonterweiterung betrachtet werden. Es war eine Zeit geographischer Entdeckungen, der Umwälzungen im Wirtschaftssystem (Einführung der Geldwirtschaft), der (eingeschränkten) sozialen Mobilität, des Aufblühens der Naturwissenschaften (Galilei, Newton), die in die Aufklärung mündete. Hier standen die Rechte des Individuums, vor allem in politischer Hinsicht, im Mittelpunkt des kämpferischen Interesses der Philosophen. Wieder geht es um die Erkenntnisfähigkeiten des Menschen, nun aber nicht mit Blick auf die Erkenntnismöglichkeit Gottes durch den Menschen, sondern auf seine Emanzipation und seine Freiheit. Die englischen Empiristen (Locke, Berkeley, Hume) betonen (im Anschluss an Aristoteles) den Primat der Erfahrung (nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu; nichts findet sich im Intellekt, was nicht vorher in den Sinnen war). Der Intellekt wird als »tabula rasa« beschrieben, der erst durch Sinneserfahrungen, Nachdenken (»Reflexion«) und durch Lernen gebildet wird.
19. Jahrhundert
Der Weg zur Psychologie, wie sie sich heute darstellt, wurde entscheidend geprägt durch das im Jahre 1871 erschienene Buch »Über die Abstammung des Menschen« von Charles Darwin (1809 – 1882). Der Mensch wird nun ganz und gar als Naturwesen gesehen. Damit scheinen auch alle seine Funktionen, Reaktionen und Erlebnisweisen mit den Methoden und Mitteln der Naturwissenschaften grundsätzlich erfassbar. Die »Seele« erweist sich als überflüssige Annahme. Dementsprechend propagiert C. G. Lange (1834 – 1900) eine »Psychologie ohne Seele«, ein mutiges Unterfangen, bedeutet »Psychologie« dem Wortsinne nach doch »Lehre von der Seele«.
experimentalpsychologische Schule
Im 19. Jahrhundert gibt es eine Fülle von psychologischen Ansätzen. An den Universitäten immer noch von Inhabern von Lehrstühlen der Philosophie vertreten, teilen sich die Interessen in traditionell geisteswissenschaftliche und experimentelle Psychologien. Die sich herausbildende experimentalpsychologische Schule lässt sich als physiologisch, evolutionär, atomistisch und quantifizierend beschreiben (vgl. Wertheimer 1970, S. 35). Ihre institutionelle 1879: Leipzig, erstes psychologisches Laboratorium W. Wundt Verankerung erfolgte im Jahre 1879, als Wilhelm Wundt (1832 – 1920) in Leipzig das erste experimentalpsychologische Laboratorium an einer deutschen Universität begründete (im gleichen Jahr wurde an der Harvard University durch William James das erste amerikanische Laboratorium eingerichtet, 1889 folgte die Sorbonne in Paris, 1894 das psychologische Institut in Graz, eingerichtet durch A. Meinong).
Auf diese Daten bezieht sich der eingangs zitierte Satz von Ebbinghaus. Philosophische Fragen wurden damals jedoch nicht ausgeklammert, wofür Wundt wie Brentano als Zeugen dienen können. Franz Brentano hatte 1874 seine Schrift »Psychologie vom empirischen Standpunkte« veröffentlicht, in der er seine These »Die Methode der Psychologie sei die der Naturwissenschaft mit Erfahrung als Grundlage« exemplifizierte. Er versuchte, der Psychologie ihren vollen Zuständigkeitsbereich zu retten, indem er zwei Teildisziplinen vorschlug: deskriptive und genetische Psychologie. Die genetische Psychologie sollte auf experimentellem Wege »das Seelenleben zergliedern«, die deskriptive Psychologie auf deduktivem Wege zu Theorien gelangen und die Ergebnisse allgemeingültig formulieren. Wundt dagegen wollte die experimentelle Methode nur auf elementare psychische Prozesse (etwa Messung von Empfindungsstärken) anwenden, »höhere« psychische Prozesse sind seiner Meinung nach der experimentellen Prüfung nicht zugänglich. Sie bedürften zur Erklärung hermeneutischer (geisteswissenschaftlicher) Verfahren.
Konsequenterweise wandten sich deshalb Wundts Schüler der experimentellen Forschung »einfacher Vorgänge« hauptsächlich aus dem Bereich der Sinnespsychologie zu. Unter Wundts Schülern gab es auch eine Reihe von Amerikanern, wovon der berühmteste E.B. Titchener (1867 – 1927) wurde, der die Wundtsche Psychologie in den USA bekannt machte.
Göttingen
Weitere Zentren entstanden in Göttingen, wo G.E. Müller (1850 – 1935) psychophysische Forschungen betrieb (er vertrat die Ansicht, dass jedem Berlin Psychischen ein Physisches entspreche) und in Berlin, wo H. Ebbinghaus seine bekannten Gedächtnisstudien betrieb. Ebbinghaus versuchte, die Länge der Gedächtnisspanne und die Gesetzmäßigkeiten beim Vergessen zu bestimmen, wozu er sich sinnarmer Silben als Material bediente.
Würzburger Schule
Eine erste große Kontroverse unter den »neuen« Psychologien entstand, als der Wundt-Schüler Oswald Külpe (1862 – 1915) mit seiner »Würzburger Schule« auch das Denken experimenteller Prüfung unterzog. Der herausragende Forscher dort war Karl Bühler (1879 – 1963), der der Frage nachging, »was erleben wir, wenn wir denken?« und seine Versuchspersonen anwies, in Selbstbeobachtung ihre Erlebnisse während der Lösung von Denkaufgaben genau zu beschreiben. Aufgrund der Auswertung der Ergebnisse kam Bühler zu dem Schluss, dass nicht mechanische Assoziationen (Verknüpfungen) von Vorstellungsinhalten das Denken ausmachen, sondern »reine Gedanken«, die unanschaulich sind. Die Problemlösung tritt als spezifisches »Aha-Erlebnis« auf (vgl. Bühler 1907). Wundt und seine Schule hielten diese Vorgehensweise für einen Missbrauch des Experiments (vgl. Ash/Geuter 1985, S. 51).
Am Rande soll noch vermerkt werden, dass es bei den damaligen Kontroversen nicht nur um sachliche oder methodische Fragen ging, sondern dass auch standes- und wissenschaftspolitische Interessen eine Rolle spielten. Die Philosophen fürchteten, dass durch die Zunahme an experimentalpsychologischer Ausrichtung die »eigentlichen« philosophischen Disziplinen wie Metaphysik, Erkenntnistheorie, Logik und Ethik in den Hintergrund gedrängt würden, dass »die großen Lebensfragen, die politischen, religiösen und sozialen Fragen« nicht mit Hilfe von Experimentalpsychologie zu lösen seien (Windelband zit. n. Ash/Geuter 1985, S. 52). Der Einwand war sicher nicht unberechtigt; letztlich förderte der Protest der Philosophen die institutionelle Trennung der Psychologie als eigene Disziplin von der Philiosophie.
Gestaltpsychologie
Als dritte bedeutsame Schule ist die Gestaltpsychologie zu nennen. Ihr Ausgangspunkt waren wahrnehmungspsychologische Untersuchungen und die Untersuchung von »Denkgestalten«. Hauptvertreter waren Ch. von Ehrenfels (1859 – 1932), Max Wertheimer (1880 – 1943), Kurt Koffka (1886 – 1941), Wolfgang Köhler (1887 – 1967) und Kurt Lewin (1890 – 1947). Das kennzeichnende Schlagwort für die Gestaltpsychologie lautet »Das Ganze (oder die Gestalt) ist mehr als die Summe seiner (ihrer) Teile«. Charakterisiert werden die Gestalten durch die Ehrenfels-Kriterien »Transponierbarkeit« und »Übersummativität«. Als Beispiel dient die Melodie: Ich erkenne sie auch in einer anderen Tonart. Ich höre nicht nur einzelne Töne, sondern eine »Gestalt«. In der Wahrnehmungslehre wandten sich die Gestaltpsychologen gegen die Auffassung, Wahrnehmungsgebilde seien aus atomhaften Empfindungen zusammengesetzt, also gegen den Atomismus und die »Elementenpsychologie«. Ebenso lehnten sie eine Vorstellungsmechanik (Gedanken als nur mechanisch-summative Verknüpfung von Vorstellungen) ab und wurden so zu Verbündeten der Würzburger Schule gegen die Assoziationstheorie (vgl. Müller 1971, S. 9).
Bedeutsam ist, dass »Gestalten« in einem »Feld« (einer Umgebung) eingebettet sind, das die Wahrnehmung beeinflusst, wie an einer Vielzahl von optischen Täuschungen nachgewiesen wurde.
Als kleines Beispiel diene die 9-Punkte-Aufgabe von Wertheimer.
| ● ● ● | Diese 9 Punkte sind durch vier gerade Linien so zu verbinden, dass jeder Punkt getroffen wird. Der Bleistift ist nicht abzusetzen. |
| ● ● ● | |
| ● ● ● | |
Die Lösung gelingt, sobald die »Gestalt« des Quadrats durchbrochen wird.
Problemlösen, Denken, und Lernen sind also Produkte einer »Umstrukturierung« des Feldes. Nicht »trial and error«, Versuch und Irrtum im Sinne von Probieren führen zur Lösung, sondern Um-Organisation von Gestalten. Wolfgang Köhler postulierte denn auch ein »Lernen durch Einsicht«, das er den Affen in seinen Tierexperimenten zuschrieb, die Gegenstände ihrer Umgebung als Hilfsmittel benutzten, um an Futter zu gelangen, das Feld also im Sinne einer »guten Gestalt« (der Lösung der Aufgabe) umstrukturierten.
Anwendungen
Neben den mehr akademisch-theoretisch ausgerichteten Schulen etablierten sich in den 20er und 30er Jahren einige Institute, die sich auch praktischen Fragen zuwandten. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang:
William Stern
Hamburg, wo ab 1920 William Stern (1889 – 1953) entwicklungspsychologische Studien betrieb (er gilt als »Erfinder« des Intelligenzquotienten; sein mit seiner Frau Clara herausgegebenes Buch über die Kindersprache, in dem die Beobachtungen an den eigenen Kindern Grundlage waren, war weit verbreitet).
Wilhelm Peters
Jena, wo mit Wilhelm Peters (1880 – 1963) ein Entwicklungspsychologe Lehrstuhlinhaber wurde, der sich besonders der Lehrerausbildung widmete und zusammen mit Lehrern zahlreiche Testverfahren erprobte, und
Charlotte und Karl Bühler
Wien, wo Karl Bühler (1879 – 1963) und besonders seine Frau Charlotte Bühler (1893 – 1974) entwicklungspsychologische Forschung und pädagogische Erprobung in enger Zusammenarbeit mit pädagogischen Institutionen der Stadt praktizierten. Dabei entstand u. a. der noch heute teilweise verwendete Bühler-Hetzer-Entwicklungstest für Kinder.
1933
Für die deutsche Psychologie bedeutete die Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahre 1933 einen verheerenden Einschnitt. Teils mit Berufsverbot belegt, teils verfolgt, mussten die meisten der angesehenen Psychologieprofessoren ihre Lehrstühle räumen. Einige waren Juden, andere in politischer Opposition. Die meisten konnten emigrieren, nach den USA, Schweden oder England. Otto Selz, der letzte Vertreter der Würzburger Schule, ein Külpe-Schüler, entkam zunächst nach Holland und wurde von dort nach Auschwitz deportiert. Wenige der Emigrierten konnten ihre früheren Forschungsarbeiten fortsetzen, sie arbeiteten dort, wo man ihnen eine Stelle anbot. Eine neue Karriere starten konnten Charlotte Bühler, die sich der Therapie widmete und in den USA zu den Mitbegründern der Humanistischen Psychologie wurde, und Kurt Lewin (1890 – 1947), der die später sehr beachteten Experimente zur Wirkung von Erziehungsstilen auf das Gruppenverhalten von Kindern durchführte und sich sozialpsychologischen Fragen zuwandte.
Nach 1933 widmete sich die Psychologie in Deutschland, den gesellschaftlichen Umständen angepasst, vor allem den Feldern Typologie, Erbpsychologie und Rassenpsychologie. Eine Diskussion über diese Zeit hat erst spät begonnen. »Die Debatten an den Universitäten in den 60er Jahren zum Verhältnis der verschiedenen Disziplinen zum Nationalismus gingen an der Psychologie vorbei. Nichts wurde nach dem Krieg diskutiert, klammheimlich steckte man vielmehr Bereiche der Vergangenheit beiseite« (Ash/Geuter 1985, S. 173). In den Kriegsjahren wurden die psychologischen Institute geschlossen, ihre Mitarbeiter teils eingezogen, teils als Wehrmachtspsychologen (für Tauglichkeitsprüfungen und zur Auslese von Offiziersanwärtern) verwendet.
Neuanfang
Die Wiedereröffnung der Universitäten nach Kriegsende zeigte bei der Professorenschaft der Psychologie wenig Veränderung: Die meisten der vor dem Krieg Tätigen wurden übernommen, nur bekannt begeisterte Parteigänger wurden ausgeschlossen. Oswald Kroh (1887 – 1950), Philipp Lersch (1898 – 1972), Wilhelm Arnold (1911 – 1983) waren Vertreter der traditionellen Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie, wie sie bereits vor dem Kriege gelehrt wurde. Nach den Erfahrungen des »kollektiven Massenwahns« scheint es auch verständlich, dass die Pflege des Individuellen und die Würde der Person als Lehr- und Forschungsgegenstände populär wurden.
Rezeption internationaler Forschung
Ab 1950 etwa setzte sich ein neuer Trend durch, den man als die »Amerikanisierung« der Psychologie in der Bundesrepublik bezeichnen kann. Es war eine Zeit der Rezeption von Ideen, Methoden und Ansätzen, von denen die meisten zum Zeitpunkt ihrer Rezeption bereits zwei bis drei Jahrzehnte alt und in den USA längst sozial anerkannt waren. Doch waren diese Forschungen in Deutschland nicht bekannt gewesen. Erst durch jüngere Wissenschaftler, die als Stipendiaten in den USA studieren konnten und durch wenige, zögernd zurückkehrende Emigranten bekam man davon Kenntnis. Zudem sorgten von den Besatzungsmächten zur Verfügung gestellte Quellen (Bücher, Fachzeitschriften) für die Verbreitung vorher hier nicht bekannter Forschungsansätze.
Die Lernpsychologie, die Sozialpsychologie und die Klinische Psychologie (vorher weitgehend den Psychiatern überlassen) wurden übernommen. Die Forschungen wurden teilweise repliziert. Vor allem entstand ein großes Anwendungsfeld, in dem Beratungsstellen, Schulpsychologische Dienste und Therapiezentren eingerichtet wurden.
Obwohl man inzwischen von einer Internationalisierung der psychologischen Forschung sprechen kann, blieb die akademische Psychologie an den USA orientiert. Neben den Inhalten waren es vor allem die Methoden, die anfangs noch gegen den Widerstand der »Alten« übernommen wurden. Zum einen ging es um die Dominanz der Experimentalverfahren. Dass darüber gestritten wurde, so 1956 zwischen Peter R. Hofstätter (1913 – 1994), einem USA-Rückkehrer, und Albert Wellek (1904 – 1972), einem der dienst-ältesten deutschen Professoren damals, der auf »Intuition« als der wahren Methode zur Gewinnung psychologischer Erkenntnisse bestand, muss einen mit der Geschichte Vertrauten eigentlich wundern, waren doch die berühmten deutschen Schulen vor 1933 bereits sehr stark experimentell orientiert gewesen. Zum zweiten ging es in diesem Streit um den Wert statistischer Verfahren.
kognitive Wende
Die Hochschätzung quantitativer Verfahren setzte sich durch, institutionell festzumachen an der ersten Tagung experimentell arbeitender Psychologen 1959 in Marburg. Die Ausklammerung des Subjekts aus der Psychologie, die Vermeidung mentalistischer Begriffe wie beispielsweise »Intentionalität«, konnte allerdings nicht durchgehalten werden. Die kognitive Wende oder gar kognitive Revolution, wie Herzog (1984) sagt, hat eine Neuorientierung bewirkt. Dies soll anhand der Motivationspsychologie illustriert werden.
Begriffe wie Wille oder Wollen waren zu Zeiten behavioristisch orientierter Forschung verpönt, zum einen, weil sie introspektiv zu erfassende Vorgänge darstellten, die mit der Methode der Fremdbeobachtung nicht zugänglich zu machen sind. Zum zweiten, weil der Wille den Aspekt der freien Entscheidung beinhaltet. Der sich frei entscheidende, der »autonome Mensch« war jedoch von Skinner zur Fiktion erklärt worden.
Miller, Galanter und Pribram veröffentlichten 1960 ihr Buch über »Plans and the structure of behavior«, in dem sie den Begriff »intention« als »unvollständige Teile eines Planes, dessen Ausführung gerade begonnen hat« einführten (Miller/Galanter/Pribram 1960, S. 61, Übers. d. Verf.). Handlung entsteht aus dem Zusammenwirken von »plans«, zu deren Bestandteilen »intentions« und »images« gehören, die als interne Repräsentationen charakterisiert werden (S. 7).
Attributionstheorie
Weitere Impulse erhielt die kognitionspsychologische Richtung durch die Attributionstheorie. Ausgangspunkt war 1958 Fritz Heiders Buch »The Psychology of Interpersonal Relations« (deutsch 1977), in dem er den Alltagsmenschen zum Gegenstand der Psychologie machte. Seine Erforschung sogenannter naiver Konzepte und Erklärungsmodelle wies in eine neue Richtung, die sich in Deutschland beispielsweise im »Forschungsprogramm Subjektive Theorien« (Groeben/Wahl/Schlee/Scheele 1988) durchgesetzt hat.
Heider
Heider, der bei Meinong in Graz promoviert hatte, in Berlin bei Stern Assistent gewesen war, dort mit Kurt Lewin und Max Wertheimer, später in den USA wieder mit Lewin zusammengearbeitet hatte, ist den gestalt- und feldtheoretischen Ansätzen verbunden. Sein Ansatzpunkt geht jedoch über Lewin hinaus. Erklärte Lewin Verhalten als Funktion von Person und Umwelt, so verändert Heider den Aspekt. Anders als Lewin bezieht er sich nicht auf die tatsächlichen, auf eine Person einwirkenden psychologischen Kräfte und Verhaltensdeterminanten, sondern auf die wahrgenommenen Ursachen von Verhalten; die wahren und die wahrgenommenen Verhaltensursachen müssen keineswegs identisch sein. Mit der Betonung der »wahrgenommenen« Ursachen spricht Heider nichts anderes an als den Vorgang der »inneren Wahrnehmung« im Sinne von Meinong und Brentano. So lässt sich also für diese Zeit (dem allmählichen Aufkommen der Kognitionspsychologie) mit Pinker (1998, S. 110) feststellen:
»Bevor Newell und Simon sowie die Psychologen George Miller und Donald Broadbent in den fünfziger und sechziger Jahren Ideen aus der Computertechnik aufgriffen, war die Psychologie nur langweilig. Ihr Studiengang bestand aus physiologischer Psychologie (das heißt Reflexe) und Wahrnehmung (das heißt Piepser), Lernen (das heißt Ratten), Gedächtnis (das heißt sinnlose Silben), Intelligenz (das heißt IQ) und Persönlichkeit (das heißt Tests). Seitdem hat die Psychologie viele Fragen der klügsten Denker der Menschheitsgeschichte ins Labor geholt und Tausende von Entdeckungen gemacht, die alle Aspekte des Geistes betreffen.« Kluwe (2001, S. 1) hält diese Einschätzung »bezüglich der Entwicklung nach 1960 auch für den deutschsprachigen Raum für zutreffend.«
Neben der Kognitionspsychologie, die Wissen und Denken, Sprache und Textverarbeitung, Motivation und Handlung untersuchte, etablierten sich die Biologische Psychologie (Pinel/Pauli 2007) und die Neuropsychologie, denn die Kognitionswissenschaft ist mit ihrem Modell vom Menschen als Informationsverarbeiter analog zum Computer wiederum an Grenzen gestoßen (man denke an die Rolle von Emotionen und von genetischen Einflüssen).
Neue technische Geräte und Analyseverfahren bieten in der Hirnforschung bisher unbekannte Zugangsweisen.
Die Forschungs- und Anwendungsbereiche der Psychologie in Deutschland vom Ende des vorletzten Jahrhunderts bis heute lassen sich gut nachvollziehen anhand der Berichte, die die jeweiligen Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Psychologie »Zur Lage der Psychologie« im zweijährigen Turnus anlässlich der Kongresse der Gesellschaft vorlegen. Begonnen hat diese Tradition Carl F. Graumann im Jahre 1970 (Graumann 1973, S. 19 – 37).
Zunächst hat sich die Zahl der Psychologischen Institute deutlich erhöht: von 18 im Jahre 1961 auf 49 im Jahre 2013; die Anzahl der Professoren stieg in diesem Zeitraum von 17 auf 719, die der Studierenden von 2500 auf 44 000.
Bemerkenswert ist die Steigerung des Frauenanteils unter den Studierenden auf 82 % (2010), geschuldet z. T. der NC-Regelung als Zugangsvoraussetzung. Bei Promotionen (68,2 %) und Habilitationen (45,2 %) wird der Effekt wieder nivelliert. (Frensch 2013)
Eine zeitgeschichtliche Besonderheit stellte die Vereinigung Deutschlands dar. In der Psychologie wurde, wie in vielen anderen akademischen Disziplinen, die Forschungs- und Ausbildungsrichtung der Bundesrepublik exportiert. Eigenständige Traditionen der DDR, auf die hier nicht eingegangen werden kann, (Bredenkamp 1993, S. 17f.; Sprung/Sprung 1999, S. 135; Ettrich 2005) wurden abgelöst.
2.2. Was ist eigentlich Psychologie?
2.2.1. Eine Annäherung
Spätestens nach der geschichtlichen Beschreibung der Psychologie wird bei manchem Leser oder mancher Leserin eine Frage (wieder) auftauchen, die bisher zurückgestellt wurde: »Was ist Psychologie eigentlich für eine Wissenschaft?« Leider ist die Antwort nicht so selbstverständlich wie die Frage.
Eine mögliche Antwort könnte aus dem geschichtlichen Rückblick gewonnen werden. Dieser zeigt jedoch, dass der Gegenstand der Psychologie zu keiner Zeit einheitlich war. Das, was Psychologie als Wissenschaft ist, war stets von den vorherrschenden Menschenbildern abhängig. Diese verändern sich im Laufe der gesellschaftlich-geschichtlichen Entwicklung. Die Antwort müsste lauten: Psychologie selbst ist veränderlich und lässt sich nicht festlegen.
Man könnte eine Antwort aber auch durch das Studium anerkannter Lehrbücher für Psychologen (z. B. Schönpflug 2006, Gerrig/Zimbardo 2008) finden. Schließlich müssen Psychologen selbst doch wissen, was Psychologie ist oder sein soll. Psychologie ist dann einfach das, was in anerkannten Lehrbüchern steht.
Für jemanden, der gerade beginnt, sich in ein neues Wissensgebiet einzuarbeiten, klingen diese beiden Antworten wohl nicht sehr ermutigend. Vollends zynisch muss es dem Laien vorkommen, wenn ihm mit Hinweis auf sein »falsches« Verständnis von Wissenschaft die Antwort einfach verweigert wird (z. B. Groeben/Westmeyer 1981, S. 13).
Allgemeine Definition
Im Sinne einer Annäherung ist eine vorläufige, allgemeine Charakterisierung sinnvoll, um einen Einstieg in eine genauere Beschäftigung mit dem Wissenschaftsgebiet Psychologie zu erleichtern:
Psychologie versteht sich als Wissenschaft, die alle Phänomene des Erlebens und Handelns von Menschen zu beschreiben, zu erklären, zu verstehen und zu beeinflussen sucht.
Psychologie versteht sich primär als empirische Wissenschaft, d. h. als eine Wissenschaft, die ihre Erkenntnisse auf der Grundlage systematisch gewonnener Erfahrungen formuliert.
Dies ist eine sehr allgemeine Charakterisierung. Diese Zielsetzung kann je nach dem speziellen Wissenschaftsverständnis und Tätigkeitsbereich unterschiedlich akzentuiert sein. So kann der Schwerpunkt psychologischer Tätigkeit auf
Akzentuierungen
der möglichst differenzierten Beschreibung des psychischen Geschehens bzw. sozialen Verhaltens,
dem Erklären von Verhaltensweisen,
dem Verstehen von Verhaltensweisen,
dem Erstellen von Prognosen zukünftigen Verhaltens,
dem Entwickeln von Maßnahmen der Veränderung
liegen.
Erinnern wir uns noch einmal an die Aufgaben der Alltagstheorien. Mit Hilfe seiner Alltagstheorien orientiert sich das Individuum in sozialen Situationen, schätzt die weitere Entwicklung ab und handelt dementsprechend.
Man kann nun leicht erkennen, dass die Aufgaben des Alltags und die der Wissenschaft sich entsprechen. So gesehen, gibt es keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Alltagstheorien und den Theorien in der Wissenschaft. Der Unterschied liegt eher im methodischen Vorgehen und im Geltungsbereich.
Je nachdem, welcher der dargestellten Aufgabenbereiche schwerpunktmäßig bearbeitet wird, lassen sich drei Typen psychologisch-wissenschaftlicher Forschung unterscheiden:
Forschungstypen
Beschreibende (deskriptive) Forschung: Wie sieht Realität aus?
Hypothesen-(Theorien-)prüfende Forschung: Warum ist das so?
Wirkungs-(Entwicklungs-)Forschung: Wie kann sie verändert werden?
beschreibend
Die deskriptive Forschung ist Grundlage jeglicher psychologischen Forschung überhaupt. Ohne sie kann es keine hypothesenprüfende Forschung und auch keine Entwicklungsforschung geben. Wir müssen jedoch feststellen, dass wir in vielen Bereichen der sozialen Realität über Beschreibungen nicht hinausgekommen sind, ja, dass wir häufig nicht einmal über genügend differenzierte Beschreibungen verfügen.
hypothesenprüfend
In der hypothesenprüfenden Forschung wird versucht, diejenigen Regeln zu entdecken, mit deren Hilfe wir die beschriebene Realität erklären könnten. Nicht ganz korrekt lässt sich dieser Typ von Forschung als Grundlagenforschung bezeichnen. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen neigen manchmal dazu, die hypothesenprüfende Forschung als die wissenschaftliche Tätigkeit überhaupt zu bewerten. Aufgestellte Theorien müssen sich bewähren und zumindest potentiell zur Realitätsbewältigung beitragen. Sonst werden sie für die soziale Realität bedeutungslos.
anwendend/entwickelnd
Die Entwicklungsforschung dagegen wird nicht selten von Berufspraktikern hoch geschätzt. Sie unterliegen dem Druck, kurzfristig konkrete Aufgaben erledigen zu müssen. Dazu erwarten sie konkrete Hilfe und vergessen allzu leicht, dass Entwicklungsforschung ohne hypothesenprüfende Forschung langfristig nicht möglich ist. Sie erschöpfte sich sonst in »blindem« Aktionismus.
Tagtäglich kommen wir als Einzelpersonen in unserer sozialen Welt nur zurecht, weil wir uns orientieren, Entwicklungen abschätzen und dementsprechend handeln. In gleicher Weise wird die Psychologie als Wissenschaft nur dann im Dienste der Menschen stehen, wenn im aktiven Forschungsprozess alle drei Forschungstypen gefördert werden. Es besteht somit keinerlei Veranlassung, die beschriebenen Forschungstypen unterschiedlich zu bewerten. Jeder ist, auf seine Art, gleichermaßen notwendig und legitim.
Mit was beschäftigt sich die Psychologie nun aber inhaltlich? Etwas anschaulicher wird das Bild von der Wissenschaft Psychologie, wenn man ihre Aufgliederung in Teilgebiete betrachtet.
2.2.2. Teilgebiete der Psychologie
Wenngleich eine klare Trennung zwischen Teilgebieten nicht immer möglich ist, kann eine entsprechende Aufteilung ein Mindestmaß an Orientierung bieten und so einen weiteren Einstieg in die Psychologie erleichtern. Bei der Aufteilung der einzelnen Gebiete kann unterschieden werden in solche, deren Bearbeitung relativ unabhängig von der gesellschaftlichen Situation erfolgt (Grundprinzipien des Lernens können beispielsweise unabhängig von den sozialen Bezügen der Menschen außerhalb der menschlichen Gesellschaft an Ratten oder Tauben untersucht werden) und in solche Gebiete, deren Bearbeitung in Abhängigkeit von konkreten gesellschaftlichen Situationen geschieht (beispielsweise lassen sich die Wirkungen von Fließbandarbeit nur untersuchen und sind nur ein Problem, wenn Fließbandarbeit existiert). Zuweilen werden diese unterschiedlichen Gebiete auch als Grundlagen- bzw. Anwendungsbereiche bezeichnet.
In diesem Sinne sind Grundlagengebiete: Allgemeine Psychologie einschließlich Forschungsmethodik, Differenzielle Psychologie, Entwicklungspsychologie und Sozialpsychologie. Anwendungsgebiete sind z. B.: Arbeits- und Organisationspsychologie, Klinische Psychologie oder Pädagogische Psychologie.
Grundlagen
Die Allgemeine Psychologie hat das zum Forschungsgegenstand, was für alle Individuen zutrifft. Sie sucht nach allgemeinen Prinzipien, Regeln oder Gesetzmäßigkeiten psychischer Prozesse. Ihre wichtigsten Forschungsfelder sind Wahrnehmung, Lernen, Gedächtnis, Denken, Motivation und Emotion. Die Entwicklung von Forschungsmethoden kann ebenfalls dem Aufgabenbereich der Allgemeinen Psychologie zugeordnet werden.
Die Differenzielle Psychologie kann als Gegenstück zur Allgemeinen Psychologie beschrieben werden. Sie untersucht die Unterschiede zwischen Personen und versucht, diese zu erklären. Ein damit zusammenhängendes Arbeitsgebiet ist die psychologische Diagnostik.
Die Entwicklungspsychologie beschreibt und erklärt die Entwicklung von Menschen. Sie fragt danach, wie einzelne Funktionen (z. B. das Denken), Merkmale der Person (z. B. die Intelligenz) oder einzelne Verhaltensaspekte (z. B. hilfreiches Verhalten) sich im Laufe des Lebens verändern. Eine häufige Beschreibungsform ist die nach Lebensabschnitten. So entsteht eine Psychologie des Kleinkindes, des Kindes, des Jugendlichen, des Erwachsenen und des alten Menschen.
Die Sozialpsychologie hat das Verhalten und Erleben von Personen in ihren sozialen Beziehungen zum Gegenstand. Sie fragt nach der gegenseitigen Beeinflussung der Menschen untereinander.
Anwendungen
Die Arbeits- und Organisationspsychologie beschäftigt sich mit allen Fragen des Arbeits- und Berufslebens (z. B. Berufseignung oder optimale Gestaltung des Arbeitsplatzes) sowie den Einflüssen von Strukturen und Organisationsformen in Betrieben und Behörden auf den Einzelnen.
Die Pädagogische Psychologie umfasst den Problembereich des Erziehens und Unterrichtens in Familien und Institutionen.
Die Klinische Psychologie ist dasjenige Teilgebiet, das sich mit den Störungen des Verhaltens und Erlebens befasst. Sie wird beispielsweise in der Arbeit von Psychotherapeuten, Ehe- oder Familienberatern sichtbar.
Solche Teilgebietsnennungen sind nun keine klaren unveränderlichen Beschreibungen. Die Teilgebiete stehen miteinander in Beziehung; die Übergänge sind fließend. So kann etwa eine allgemeinpsychologische Fragestellung durchaus entwicklungspsychologisch bearbeitet werden (z. B. das Denken: wie entwickelt es sich etwa von Geburt bis zur Einschulung?). Die praktischen Probleme der Erziehungsberatung können beispielsweise zum Bereich der Pädagogischen und der Klinischen Psychologie gezählt werden. Innerhalb der Arbeits- und Organisationspsychologie gibt es eindeutig pädagogisch-psychologische Fragestellungen (z. B. die der beruflichen Weiterbildung, Umschulung oder Rehabilitation).
Psychologie ist veränderlich. Mit ihren Teilgebieten verhält es sich nicht anders. Sie verändern sich, tauchen auf oder verschwinden wieder. Von »Charakterkunde« spricht kaum noch jemand in der Psychologie. Biopsychologie ist ein relativ neues, aufstrebendes Fach, das nach den biologischen Grundlagen des Verhaltens und Erlebens sucht. In der Pädagogischen Psychologie etwa nahmen, mit zurückgehenden Schüler- und Lehrerzahlen, die Forschungsaktivitäten im Bereich der Schule ab, während die Zunahme alter Menschen in unserer Gesellschaft die Frage nach einer pädagogischen Betreuung drängend werden lässt. Es entsteht eine Gerontopsychologie. Eine Öko-Psychologie, die nach den Konsequenzen des Umweltgebrauchs und Missbrauchs für menschliches Verhalten und Erleben fragt, scheint sich vorerst nur zögernd zu entwickeln.
Kurz: Psychologie ist eine dynamische Wissenschaft und kein geschlossenes System. Dies ist durchaus etwas Faszinierendes, wenn man bereit ist, lange Zeit die Unsicherheit zu ertragen, nicht genau zu wissen, was Psychologie »eigentlich« ist.
2.3. Psychologische Erkenntnis: Weichenstellungen im Erkenntnisprozess
Jeder Mensch gewinnt im Laufe seiner Biographie Lebenserfahrung über andere Menschen, erwirbt Wissen über deren Charakter, findet Erklärungen ihres Verhaltens und entwickelt know-how der Beeinflussung anderer Menschen. Ein solches Erfahrungswissen findet sich zu allen Zeiten; es ist heutzutage gespeist auch von psychologischen Ratgebern in Buchform, von Fernsehmagazinen oder Wochenendseminaren. In einem gewissen Sinne ist jeder Mensch ein handlungspraktisch (mehr oder weniger) erfolgreicher Psychologe. Von einem solchen alltagspraktisch gewonnenen Erfahrungswissen über andere Menschen unterscheidet sich das psychologische Wissen einer Psychologin vor allem dadurch, dass diese ihre Erkenntnisse in einen ausgebauten Theoriezusammenhang einbindet und aus diesem heraus begründen kann, dass sie ihre Erkenntnisse methodisch kontrolliert und in nachvollziehbarer Weise gewinnt – und dadurch, dass sie in einem gesellschaftlichen Kontext als Psychologin tätig ist, in dem ihr und ihrem Wissen ein bestimmter Status und eine bestimmte Reputation verliehen ist. Im Unterschied zu alltagspraktischer Erkenntnis über andere Menschen, die durchaus »aus dem Bauch heraus« zustande kommen kann, muss die Psychologin ihre Erkenntnis strengen Begründungs- und Rechtfertigungsanforderungen unterwerfen. Damit wird psychologische Erkenntnis nicht wahrer, richtiger oder besser als alltagspraktische Erkenntnis. Sie wird aber zur Erkenntnis mit besonderer Verfahrensqualität. Wodurch diese besondere Qualität zustande kommt, soll im folgenden mit der Erläuterung des typischen Forschungsablaufs gezeigt werden.
Erkenntnis als Problemlösen
Eine ausführliche Darstellung gibt Breuer (1991). Dabei wird für diese Darstellung die Erkenntnistätigkeit als Problemlöse-Prozess betrachtet. Jede Erkenntnis beginnt mit der Wahrnehmung eines Problems – dies ist in der Entdeckungszusammenhang Psychologie nicht anders als in anderen Wissenschaften. Dieses Problem kann die Psychologin im Rahmen ihrer systematischen Forschungstätigkeit erkennen (»Die Vorbildfunktion von Boygroups auf Kinder russischer Migranten zwischen 10 und 13 Jahren ist noch nicht untersucht.«), dieses Problem kann sie aufgrund ihrer persönlichen Biographie umtreiben (»Was wissen wir eigentlich über die Entstehungsbedingungen von Homosexualität?«) oder es kann von Auftraggebern an sie herangetragen werden (»Wie können wir das Arbeitsklima in unserem Unternehmen verbessern?«). Diese Phase wird auch als Entdeckungszusammenhang bezeichnet.
Begründungszusammenhang
An diese Phase schließt die Problemformulierung an. Bei der Problemformulierung erfolgt eine kritische Weichenstellung im Erkenntnisprozess. Je nach Wahl der Begrifflichkeit und des theoretischen Hintergrunds erhält das Problem an dieser Stelle eine spezifische Kontur oder »Handschrift«. Wahl der Theorien Die Entscheidung für das gewählte Vokabular bzw. die gewählte Theorie ist daher begründungspflichtig. Diese Phase wird auch als Begründungszusammenhang bezeichnet. Diese Begründung kann allerdings immer nur bis zu einer gewissen »Tiefe« gegeben werden. »Darunter« liegt die besondere Forscherindividualität, die in ihrer Subjektivität durch das Problem angesprochen und »zum Klingen« gebracht wird. Diese Subjektivität der Forscherin ist notwendige Bedingung von Erkenntnistätigkeit (Devereux 1998). Für die Lösung eines Problems liefern unterschiedliche Theorien unterschiedliche Perspektiven. Sie geben an, in welcher Richtung die Lösung gesucht werden könnte und welche Folgen dann wahrscheinlich wären. Diejenige, die viele Theorien kennt, wird viele Perspektiven einnehmen können. Sie wird fähig sein, »ihr« Problem facettenreich zu analysieren. Je mehr Perspektiven sie einzunehmen vermag, desto eher wird sie eine angemessene Lösung finden. Theorien verhelfen so zu einem höheren Grad an Reflexionsfähigkeit und steigern mittelbar die praktische Kompetenz.
Wahl der Methoden
Das Ausgangsproblem hat jetzt den Status einer theoriegeleiteten Fragestellung. Mit der Wahl eines bestimmten Theoriezusammenhangs sind meist auch schon Grundsatzentscheidungen für das weitere Vorgehen – die Wahl der Methode – bei der empirischen Untersuchung verbunden, d. h. der Untersuchung eines Wirklichkeitsausschnitts. Alle Tätigkeiten der Psychologin sind in dieser Phase hohen Anforderungen an Planung, Kontrolle und Transparenz unterworfen. Die Art und Weise, in der die Psychologin zu ihren Erkenntnissen kommt, muss von anderen Menschen nachvollzogen werden können bzw. begründet kritisiert werden können. Dies schließt den faktischen Vollzug von Forschungstätigkeit und seine Beeinflussung durch Faktoren der Arbeitsbedingungen und Forscherkommunikation mit ein (vgl. Knorr-Cetina 2002).
Verwertungszusammenhang
Eine weitere Weichenstellung in der Erkenntnistätigkeit tritt auf, wenn die Psychologin ihre Erkenntnisse formuliert. Das gewählte Darstellungsmuster und die Entscheidung für einen bestimmten wissenschaftlichen Schreibstil prägt wiederum die besondere Kontur ihrer Ergebnisse (vgl. Geertz 1993).
Mit der Übermittlung der Ergebnisse überlässt die Psychologin ihre Erkenntnisse der (fach-) wissenschaftlichen Öffentlichkeit, der Öffentlichkeit generell oder auch dem Auftraggeber im Besonderen. Hier entscheidet sich, wie die Erkenntnisse aufgenommen werden (Rezeption): Liefern sie Anregungen für weitere Forschung, werden sie in der Lehre eingesetzt, finden sie Eingang in die Berichterstattung, werden sie praktisch umgesetzt, werden sie ignoriert? Diese Phase wird auch als Verwertungszusammenhang bezeichnet.
2.4. Psychologische Untersuchungsperspektiven
2.4.1. Unterschiedliche Wissenschaftsauffassungen
Jede Wissenschaftlerin fühlt sich einem bestimmten Konzept wissenschaftlicher Tätigkeit verpflichtet, einer Methodologie.
Innerhalb der Psychologie als empirischer Wissenschaft gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Haltungen (oder »Mentalitäten«), aus denen heraus man seine Erkenntnisse gewinnen will und kann. Diese Haltung bestimmt den Zuschnitt wissenschaftlicher Erkenntnisse ganz wesentlich. Wenn zwei Psychologinnen also von ihrer wissenschaftlichen Arbeit sprechen, können sie darunter etwas durchaus Verschiedenes verstehen oder sogar eine Debatte darüber führen, ob es sich bei der Arbeit der jeweils anderen wirklich um wissenschaftliche Erkenntnis handelt. Mit der Entscheidung für eine bestimmte Haltung übernimmt die Wissenschaftlerin persönliche Verantwortung, die sie – jedenfalls im Rahmen demokratischer Gesellschaften – nicht »objektiven Interessen«, »höheren Instanzen«, dem »Zeitgeist« oder anderen Größen übertragen kann. Diese Haltungen unterscheiden sich in dem Selbstverständnis, das sie der Psychologin als Wissenschaftlerin vermitteln, in den Prinzipien, die für sie als Forscherin leitend sind, in den Methoden, die nahegelegt werden oder im Stil der wissenschaftlichen Texte. Die wichtigsten dieser wissenschaftstheoretischen Konzepte werden im Folgenden skizziert:
Kritischer Rationalismus
Kritische Theorie
Grounded Theory
Feminismus
Konstruktivismus.
Kritischer Rationalismus
Der Kritische Rationalismus ist zweifelsohne die vorherrschende Wissenschaftsauffassung in der gegenwärtigen Psychologie. Er entwickelte sich im zwanzigsten Jahrhundert aus Ansätzen, die bestrebt waren, die Psychologie aus der Philosophie herauszulösen (siehe Abschnitt 2.1.), und die (elitäre) philosophische Wesensschau durch die (demokratische) transparente, nachvollziehbare Beobachtung ersetzen wollten.
Die kritische Rationalistin orientiert sich an einer Haltung, wie sie innerhalb der Naturwissenschaften propagiert wird: die der distanzierten, methodisch kontrollierten, theoriegeleiteten Beobachtung von Untersuchungsobjekten (klassischerweise im Laborexperiment). Ziel ist die Ermittlung von Erkenntnissen in Form gesetzesmäßiger Aussagen oder allgemeiner Tendenzen, die in allgemeiner Form einen Zusammenhang formulieren (»wenn ..., dann ...«). Handlungsleitende Prinzipien sind:
die logisch stringente Ableitung von Fragestellungen bzw. Hypothesen aus Theorien;
der Einsatz von Untersuchungsverfahren, die strengen Gütestandards entsprechen;
das Postulat der Wertfreiheit der Erkenntnis, d. h. die strikte Konzentration auf objektbezogene Aussagen und das Vermeiden nicht disziplinär bezogener, z. B. politischer, gesellschaftlicher, pädagogischer, etc. Bewertungen der Erkenntnisse.
Kritische Theorie
Die Kritische Theorie hat sich aus marxistischen Grundüberlegungen heraus entwickelt und versucht, diese Überlegungen auf Verhältnisse der Gegenwart zu beziehen. Eine klassische Untersuchung ist die Studie zur Autoritären Persönlichkeit von Theodor W. Adorno (1995).
Die Anhängerin der Kritischen Theorie begreift sich als Wissenschaftlerin, die dazu beitragen will, den Einfluss gesellschaftlicher Strukturen, insbesondere gesellschaftlicher Widersprüche, auf das Bewusstsein und das Verhalten von Menschen bewusst zu machen und dadurch zur Aufhebung dieser Widersprüche beizutragen. Im strikten Gegensatz zur kritischen Rationalistin betrachtet sie ihre Tätigkeit als politische, nämlich in emanzipatorischer Absicht. Sie versteht sich als Aufklärerin.
Die kritische Theorie setzt in der Psychologie bei der subjektiven Erfahrung gesellschaftlicher Widersprüche an und versucht, die psychologischen Auswirkungen solcher Widersprüche zu bestimmen. Sie bevorzugt den Einsatz qualitativer Verfahren wie z. B. Tiefeninterviews und Gruppendiskussionsverfahren, mit denen sie subjektive Spuren solcher Widersprüche aufzudecken hofft.
Grounded Theory
Die Grounded Theory wurde im Rahmen der verstehenden Soziologie entwickelt, die die Untersuchung der elementaren Strukturen des Alltagslebens zum Programm gemacht hat. Von der Soziologie aus hat sie sich mittlerweile auch in die Psychologie ausgebreitet (z. B. Breuer 1996).
Die Anhängerin der Grounded Theory begreift sich als Forscherin, die die Lebenswirklichkeit von Menschen aus deren Perspektive erkennen möchte. Sie sieht ihre Aufgabe darin, subjektive Sichtweisen von Menschen zu rekonstruieren und verständlich zu machen und zu zeigen, wie Menschen ihrer Existenz Sinn verleihen. Ziel ist ein vertieftes Verstehen fremder Perspektiven. Sie versteht sich als Wissenschaftlerin, die für ihre Forschung eine enge Beziehung zu den untersuchten Menschen entwickeln muss, um diese verstehen zu können. Diese Haltung wird am prägnantesten durch die Ethnographin verkörpert. Der vertiefte Kontakt zu den Untersuchungspersonen ist schon deswegen wichtig, weil die Forscherin nur auf dieser Grundlage Charakteristika der Perspektiven und Sichtweisen ermitteln und als wissenschaftlich leitende Fragestellungen formulieren und verfolgen kann. Die Hypothesenbildung erfolgt also, wie man auch sagt, empirisch geleitet. Das Vorgehen ist qualitativ; es erfolgt in Feldforschung mit Hilfe von Interviewtechniken (v. a. narrativen Interviews) und mit Beobachtungs- und Dokumentenanalysen (v. a. Gesprächsanalysen, vgl. Deppermann 2008).
Feminismus
Der Feminismus ist eine Wissenschaftsströmung, die sich im Zuge der Emanzipationsbewegung entwickelt und sich mittlerweile in allen sozialwissenschaftlichen Disziplinen positioniert hat. Großen Einfluss in der Psychologie hatte die Arbeit von Gilligan (1993).
Die feministische Wissenschaftlerin begreift sich in starkem Maße in ihrer Forschungstätigkeit als politisch handelnd. Ihr Ziel ist die Emanzipation von Frauen aus den gegebenen, als patriarchalisch betrachteten Verhältnissen. Dieses Ziel der Aufhebung von Ausbeutung und Unterdrückung von Frauen bestimmt ihr wissenschaftliches Handeln. Sie ist entschieden parteiisch. Sie betrachtet bisherige Vorgehensweisen in der Wissenschaft als »Instrument zur Herrschaftssicherung« (Mies 1987, S. XX) und propagiert statt dessen »aktive Teilnahme an emanzipatorischen Aktionen und die Integration von Forschung in diese Aktionen. Dies bedeutet ferner, dass die Veränderung des Status Quo als Ausgangspunkt wissenschaftlicher Erkenntnis angesehen wird. Das Motto für diese Vorgehensweise könnte sein: »Um ein Ding kennenzulernen, muß man es verändern« (Mies 1987, S. XX). Der prinzipielle Herrschaftsverdacht traditionellen Formen und Verfahren wissenschaftlicher Tätigkeit gegenüber stellt auch das Prinzip der Beobachtung in Frage, da die Erkenntnisgewinnung über das Beobachten, d. h. das Sehen, als männlich geprägte Erkenntnisweise betrachtet wird (Mies 1987). Erkenntnismöglichkeiten über andere Sinnesmodalitäten (Hören, Fühlen) werden diskutiert.
Konstruktivismus
Der Konstruktivismus hat sich im Zuge der Postmoderne als Wissenschaftsauffassung etabliert; eine programmatische Darstellung in der Psychologie ist die von Gergen (1985). Die Konstruktivistin will das Selbst- und Weltverständnis von Menschen zum einen in Frage stellen und zum anderen zeigen, dass dieses auf der Grundlage kulturell vorgegebener Muster erfolgt. Sie nimmt psychologische Phänomene gleichsam nicht für bare Münze, sondern fragt nach den Redeweisen, in denen solche Phänomene erwähnt werden. Sie hält solche Phänomene – kurz gesagt – für gesellschaftliche Erfindungen, z. B. die Erfindung der »Mutterliebe« (vgl. Badinter 1999). Den Gründen und Folgen solcher Erfindungen sucht sie auf die Spur zu kommen. Ein Verfahren, das sie dabei einsetzt, ist die Dekonstruktion, d. h. das kritische Hinterfragen selbstverständlich erscheinender Annahmen, Vorstellungen und Denkgewohnheiten. Die Konstruktivistin hat in besonderer Weise Abstand zu den Dingen, die sie untersucht, und nimmt eine Haltung an, die auch als ironisch gekennzeichnet wird – sie betrachtet Phänomene nicht als real, sondern als kulturell ausgedachte Konstruktionen, die entsprechend nicht ernsthaft als Gegenstände der Wirklichkeit untersucht werden können.
2.4.2. Zusammenfassende Übersicht
Im Schema Übersicht über verschiedene Wissenschaftstheorien auf S. 33 stellen wir die verschiedenen Auffassungen stichwortartig noch einmal gegenüber. Um die Unterschiedlichkeit deutlich zu machen, wählen wir ein psychologisches Untersuchungsphänomen, »Liebe«, und zeigen, wie dieses Phänomen in den verschiedenen Wissenschaftsauffassungen zum Thema gemacht werden würde.
2.5. Forschungsmethoden in der empirischen Psychologie
Wissenschaftliche Tätigkeit zeichnet sich durch ein begründetes und kontrolliertes Vorgehen bei der Gewinnung von Erkenntnissen aus. Eine Wissenschaftlerin muss bei der Mitteilung ihrer Erkenntnisse die Frage »Woher weißt Du das?« sehr genau und ausführlich beantworten können. Innerhalb der Psychologie haben sich bestimmte Vorgehensweisen oder Methoden eingebürgert bzw. durchgesetzt, die die Wissenschaftlerin bei ihrer Erkenntnisgewinnung anleiten. Die Leistung solcher Methoden besteht darin, dass sie den Erkenntnisprozess systematisieren und kontrollieren. Im Rahmen der empirischen Psychologie spielen u. a. die folgenden Bewertungskriterien eine Rolle:
Objektivität: die Methode soll Ergebnisse liefern unabhängig von der Person, die die Methode einsetzt. Das bedeutet: Wenn mehrere Personen ein und denselben Gegenstand untersuchen, sollte jeweils dasselbe Ergebnis herauskommen.
Reliabilität
Reliabilität: die Methode sollte beim Untersuchungsobjekt immer wieder zu demselben Ergebnis führen. Das bedeutet: Wenn ein und derselbe Gegenstand mit der Methode zu unterschiedlichen Zeiten untersucht wird, sollte sich jeweils dasselbe Ergebnis finden – vorausgesetzt, dass der Gegenstand selbst sich nicht verändert.
Validität
Validität: die Methode soll den Gegenstand erfassen können, der untersucht werden soll. Das bedeutet: Wenn ein bestimmtes Merkmal (z. B. »Intelligenz«) einer Person untersucht werden soll, dann sollte die Methode wirklich genau dieses Merkmal erfassen und nicht noch ein anderes (z. B. »Aufmerksamkeit«).
Diese Gütekriterien sind im Rahmen des Kritischen Rationalismus (siehe Abschnitt 2.4.) entwickelt worden. Inwieweit sie auf das Vorgehen im Rahmen anderer Methodologien angewendet werden können, ist daher umstritten (zur Entwicklung anderer Gütekriterien vgl. Nothdurft 1998, S. 54ff.). Aber selbst wenn die Kriterien anerkannt werden, gilt: Psychologische Methoden erfüllen diese drei Kriterien niemals vollständig, sondern jeweils nur annäherungsweise. Dies macht es notwendig, stets abzuwägen, unter welchen Umständen welches Kriterium am wichtigsten ist.
| Kritischer Rationalismus | Kritische Theorie | Grounded Theory | Feminismus | Konstruktivismus | |
| Selbstverständnis als Wissenschaftlerin | objektiv analytisch Distanz zum Untersuchungsobjekt | politisch-kritisch dialektisch | verstehende Haltung Untersuchungsobjekt gegenüber ethnographisch | parteiisch emanzipatorisch Identifikation mit Untersuchungsobjekt | historisch-kritisch dekonstruktivistisch ironisch sprachanalytische Haltung zum Untersuchungsobjekt |
| Prinzipien des Vorgehens | Ableitung von Hypothesen aus Theorien kontrollierte Beobachtung kritische Prüfung des Vorgehens Wertfreiheit der Erkenntnis | allgemeine gesellschaftliche Widersprüche an Phänomenen des Psychischen aufzeigen und bewusst machen | empirisch geleitete Hypothesenbildung Beobachtung Binnenperspektive des Untersuchungsobjekts rekonstruieren (subjektiver Sinn) | »Um ein Ding kennenzulernen, muss man es verändern« Forschung muss Beitrag zum Emanzipationsprozess leisten Integration von Forschung in politische Aktion | Aufzeigen des untersuchten Phänomens als historisch-kulturell konstruiert |
| Vertreter | Karl Popper | Theodor W. Adorno | Anselm Glaser & Barney Strauss | Carol Gilligan | Kenneth Gergen |
| typischer Text | Quantitative Studie | Essay Qualitative Studie | Qualitative Studie | Manifest | Essay |
| Beispiel »Liebe« | »Messung emotionaler Erregungszustände von Jugendlichen in Abhängigkeit von …« | »Das Durchschlagen kapitalistischer Grundwidersprüche auf die Entwicklung intimer Beziehungen von Jugendlichen« | »Das interaktive Management von Flirtbeziehungen in US-amerikanischen Großstadtbars« | »Maßnahmen gegen die Unterdrückung weiblicher Empfindungsfähigkeit in patriarchalischen Arbeitsstrukturen« | »Die Konstruktion erotischer Handlungsmuster im französischen Film der 30er Jahre« |
Schema: Übersicht über verschiedene Wissenschaftstheorien
Zwei wichtige Methoden in der Psychologie werden im Folgenden vorgestellt:
das Experiment
die Feldforschung.
Experiment
Im Experiment werden Individuen, Versuchspersonen (Vpn) im Rahmen eines experimentellen Designs systematisch und kontrolliert Reizen ausgesetzt und dann ihre Reaktionen beobachtet und erfasst (gemessen). Ziel ist die Feststellung von Ursache-Wirkungsbeziehungen (»wenn ..., dann ...«).
Die Vorteile von Experimenten liegen auf der Hand. Es kann präzise das untersucht werden, was untersucht werden soll. Im Idealfall können Ursache-Wirkungs-Beziehungen eindeutig identifiziert werden. Dies gelingt um so besser, je restriktiver, also »künstlicher« die experimentelle Situation ist. Experimente eignen sich so vorzüglich zur Prüfung spezifischer Hypothesen. Dieser Vorteil muss mit einem Nachteil erkauft werden: Je künstlicher die Experimentalsituation ist, desto schwieriger wird die Übertragung der Ergebnisse auf natürliche Situationen.
Das experimentelle Vorgehen soll an einem Beispiel näher erläutert werden, ohne dass auf spezielle Fragen des Designs und der Planung eingegangen wird. Angenommen, es ginge um die Fragestellung, ob es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Videokonsum und Aggressivität bei Jugendlichen gibt.
Hypothese
Beim experimentellen Vorgehen würde die Frage nach einem Zusammenhang präzisiert zu einer Hypothese: »Erhöhter Konsum von Horror-Videos führt zur Steigerung der Aggressivität«.
Plan
Ein möglicher Untersuchungsplan: Einer Gruppe von Jugendlichen werden ausgewählte Horror-Videos gezeigt (Experimentalgruppe). Vorher und nachher erfasst man ihr aggressives Verhalten. Eine zweite Gruppe sieht währenddessen »harmlose« Videos (Kontrollgruppe). Auch bei ihnen wird das aggressive Verhalten vor und nach dem Videokonsum erfasst.
Ergebnis
Ein mögliches Ergebnis: Die Experimentalgruppe zeigt nach dem Videokonsum stärkeres aggressives Verhalten als vorher und als die Kontrollgruppe.
Leistung des Experimentes: Eindeutiger Nachweis der Wirkungsweise der ausgewählten Videos.
Offene Fragen: Werden Jugendliche, die sich solche Videos anschauen, sich auch in natürlichen Situationen (z. B. Jugendbegegnungsstätte) aggressiver verhalten? Dort werden sie durch viele weitere Faktoren beeinflusst sein (Freunde, Betreuer, Langeweile, Drogen), die ihr aggressives Verhalten ebenfalls fördern oder hemmen können. Das aggressive Verhalten in natürlichen Situationen wird aufgrund des experimentellen Ergebnisses allein nur unzulänglich vorhersagbar sein.
Feldforschung
In der Feldforschung (Ethnographie) wird das Verhalten von Menschen in natürlichen Situationen beobachtet und die Menschen werden zu ihren Verhaltensweisen befragt. Ziel ist es, zu einem genauen Verständnis des Verhaltens bzw. der Situation zu gelangen. Es geht um möglichst reiche, »dichte« Beschreibungen der Sichtweisen der Beteiligten und des Zusammenspiels ihrer Verhaltensweisen. Der Vorteil der Feldforschung liegt in ihrer Realitätsnähe, womit ein höheres Maß an praktischer Relevanz erreicht werden kann. Als Nachteil muss die eingeschränkte Eindeutigkeit und Generalisierbarkeit in Kauf genommen werden.
Fragestellung
Auch bei der Feldforschung erfolgt als erstes eine Zuspitzung der Fragestellung, hier zum einen hinsichtlich der untersuchten Situation, und zum anderen hinsichtlich einer genaueren Bestimmung, was »Zusammenhang« heißen soll.
Die Zuspitzung könnte dann im gewählten Beispiel lauten: »Die Bedeutung von Horror-Videos im Zuge aggressiven Verhaltens von Jugendlichen einer Jugendbegegnungsstätte«.
Plan
Ein möglicher Plan: Das Phänomen aggressiven Verhaltens der Jugendlichen wird möglichst genau beobachtet (z. B. mit Videokameras) und differenziert (z. B. spielerische Aggression, imitierte Aggression, Aggression als Bestandteil von Status-Wettkämpfen, Aggression mit Zuschauerbeteiligung, etc.). Außerdem werden die Jugendlichen möglichst genau nach ihren Sehgewohnheiten von Horror-Videos befragt.
Ergebnis
Ein mögliches Ergebnis: Horror-Videos haben eine große Bedeutung als Rollen-Lieferant für imitierte Aggressionen und Aggressionen mit Zuschauerbeteiligung. Bestimmte Videos dienen außerdem als Zitatenschatz zur Identifikation von Subgruppen innerhalb des Jugendzentrums.
Leistung der Feldforschung: Es entsteht ein genaues Verständnis der Bedeutung von Videos für die Begegnungen der Jugendlichen.
Offene Fragen: Welches sind die Ursachen der individuell unterschiedlichen Aggressivität der Jugendlichen?
2.6. Daten und Konstrukte in der empirischen Psychologie
2.6.1. Die Bedeutung von Daten im psychologischen Erkenntnisprozess
Fakten/Daten
Bleiben wir beim Beispiel des Zusammenhangs von Aggressivität und dem Konsum von Horror-Videos. Die Psychologin macht im Zuge ihres methodischen Vorgehens Verhaltensbeobachtungen bei den Jugendlichen: Sie protokolliert Beschimpfungen, notiert Schlägereien, misst die Lautstärke von Drohungen, erfasst physiologische Reaktionen (Blutdruck, Pulsfrequenz), nimmt verbale Duelle auf Tonband auf oder zeichnet Mimik und Gestik auf Video auf. Außerdem befragt sie die Jugendlichen nach ihrem Videokonsum. So gewinnt sie eine Vielzahl unterschiedlicher Fakten. Diese Fakten jedoch haben für sich genommen keine Bedeutung. Das Faktum, dass ein Jugendlicher fünfmal am Tag eine Schlägerei provoziert hat, erhält seine Bedeutung erst dann, wenn die Psychologin es als Ausdruck von Aggressivität interpretiert. Diese Interpretation erfolgt durch die Theorie, an der die Psychologin sich in ihrer Untersuchung orientiert. An dieser Stelle wird deutlich, dass es ohne Theorie nicht geht (man stünde sonst vor einer Unmenge von Fakten, die einem »nichts sagen« würden) und dass es in der Tat nichts Praktischeres gibt als eine Theorie, weil sie der Psychologin dazu verhilft, Fakten verstehen und einordnen zu können. Theoriegeleitet interpretierte Fakten bezeichnet man als Daten.
In unserem alltäglichen Nachdenken über andere Menschen vollziehen wir solche Interpretationen automatisch – wer sich viel prügelt, ist aggressiv. Für uns ist selbstverständlich: Prügelei ist ein Ausdruck von Aggressivität. Von solchen alltagsweltlichen Kurzschluss-Theorien unterscheiden sich psychologische Theorien dadurch, dass der Zusammenhang von Theorien und Fakten theoretisch und empirisch begründet wird. Das bedeutet nicht, dass eine Psychologin Fakten nicht auch durch ihre »alltagsweltliche Brille« betrachtet – in der Tat tut sie dies (vgl. Cicourel 1974). Gerade deswegen aber ist sie in besonderer Weise gefordert, ihre alltagsweltlichen Interpretationen zu reflektieren und zu kontrollieren.
2.6.2. Die Interpretation von Daten
hypothetisches Konstrukt
»Aggressivität« hat den Status eines hypothetischen Konstrukts. Mit dieser Bezeichnung soll deutlich gemacht werden, dass es sich dabei um eine nicht beobachtbare, vermutete oder angenommene Größe handelt. Sehr viele Phänomene, mit denen sich die Psychologie beschäftigt, sind nicht direkt beobachtbar – man kann Intelligenz nicht sehen, und auch nicht Egoismus, Schüchternheit oder eben Aggressivität.
Woran erkennt man beispielsweise, dass Peter introvertiert ist? Seine Introversion selbst kann man nicht sehen, wohl aber kann man beobachtbare Sachverhalte feststellen, die für Introversion sprechen:
Er geht selten aus.
In Gesellschaft spricht er wenig.
Er meidet gesellige Veranstaltungen.
Er macht häufig allein Spaziergänge.
Er hat wenige Freunde.
Er sagt, er sei gern allein.
Operationalisierung
Das Vorgehen der Zuordnung eines hypothetischen Konstrukts zu beobachtbaren Sachverhalten nennt man Operationalisierung.
Man mag darüber streiten, ob z. B. die operationale Definition für Introversion vernünftig ist oder nicht – die entscheidende Leistung wissenschaftlicher Tätigkeit besteht gerade darin, dass man solche Debatten führen kann, weil der Zusammenhang von Daten und Theorie explizit gemacht wird, während im Alltagsleben solche Interpretationen meist stillschweigend vollzogen werden und deshalb nicht aufgedeckt und kritisch hinterfragt werden können.
Sämtliche Begriffe, die sich auf psychische Sachverhalte beziehen, die grundsätzlich als in der Person liegend betrachtet werden, sind hypothetische Konstrukte. Einige von ihnen sind relativ gut definiert (z. B. Intelligenz), andere weniger (z. B. Kreativität).
Hypothetische Konstrukte spielen eine zentrale Rolle in der psychologischen Forschung und Theoriebildung. Nur über sie sind wir in der Lage, Erleben und Verhalten von Personen zu erklären und vorherzusagen. Dies wird durch die nachfolgende Abbildung noch einmal verdeutlicht.
Schema: Der Zusammenhang von Indikatoren und hypothetischen Konstrukten
Wenn beispielsweise ein Kind weint, kann es viele Gründe dafür geben: Es hat vielleicht Bauchschmerzen, es ist geschlagen worden oder es ist traurig. Wir werden es sicherlich zu trösten versuchen. Wir haben aber zunächst keine Möglichkeit, vorherzusehen, welche Konsequenzen folgen. Nehmen wir an, wir kämen zu der Hypothese, dies Kind sei besonders schulängstlich und fürchte sich vor der angekündigten Mathematikarbeit. Wir werden dann erwarten, dass das Kind zwei Tage später bei der Klassenarbeit aufgeregt sein wird, vielleicht wieder weinen und nicht seine optimale Leistung zeigen wird oder sich sogar weigern wird, in die Schule zu gehen.
Schematisch lässt sich der Zusammenhang des Erklärens und Vorhersagens folgendermaßen darstellen:
Schema: Der Zusammenhang von Schlussfolgerungen und Vorhersagen
Daten über hypothetische Konstrukte bergen eine Vielzahl von Problemen in sich: Sind die konkret beobachteten Verhaltensweisen wirklich Hinweise auf das hypothetische Konstrukt? Ist das hypothetische Konstrukt hinreichend definiert? Sind die notwendigen Beobachtungen angemessen? Solche Probleme können nur gelöst werden, wenn der Zusammenhang zwischen Empirie (Daten) und Theorie erhalten bleibt.
Theorie und Empirie
Zusammenfassend kann man also sagen: Nur Theorien systematisieren die empirischen Sachverhalte (Daten) und geben ihnen einen Sinn. Nur aufgrund von Theorien sind Vorhersagen über empirische Sachverhalte möglich. Andererseits entscheidet sich nur in der Empirie das Zutreffen von Theorien.
2.6.3. Psychologische Daten-Verarbeitung
Messen
Bleiben wir beim Beispiel der Frage nach Aggressivität und dem Konsum von Horror-Videos. Will man diese Frage im Sinne der Frage nach einem Ursache-Wirkungs-Zusammenhang verfolgen, kommt man an einen Punkt, an dem man die Jugendlichen miteinander vergleichen muss: Wer hat mehr Videos konsumiert? Wer ist aggressiver als die anderen? An diesem Punkt kommt man zur Quantifizierung von Daten bzw. zur Messung. Messen bedeutet zunächst nichts anderes als »vergleichen«. Personen werden in irgendeiner Weise hinsichtlich eines bestimmten Merkmals miteinander verglichen. Wer sagt »Frau Maier ist mir sympathischer als ihr Mann« hat nach dieser Definition bereits eine (einfache) Messung durchgeführt und die Ungleichheit zweier Personen unter dem Aspekt »meine Sympathie« festgestellt. Wenn die Psychologie von Messen spricht, so beansprucht sie damit also keinesfalls, den Menschen als solchen auszumessen, wie gelegentlich geargwöhnt wird. Messvorgänge geben Auskunft über Gleichheit oder Ungleichheit von Personen hinsichtlich eines bestimmten definierten Merkmals. Nun sind die Ergebnisse solcher Vergleiche nicht bei jedem Merkmal gleich informativ. Am wenigsten informativ ist das Messergebnis, wenn es nur aussagt, ob etwas gleich oder ungleich ist. Wesentlich informativer wird das Messergebnis, wenn es zusätzlich anzugeben vermag, wie stark die Ungleichheit ausgeprägt ist. Psychologie als Wissenschaft strebt möglichst informative Messergebnisse an. Deshalb ist die Entwicklung von Theorien über Messvorgänge und eine »Instrumentenkunde« zur Entwicklung und Bewertung psychologischer Messinstrumente eine wesentliche Aufgabe der Psychologie. Die Bewältigung größerer Mengen gemessener Daten erfolgt durch Verfahren der Statistik.
2.6.4. Beschreibende Statistik
deskriptive Statistik
Betrachten wir mehrere Daten einer oder mehrerer Personen, so sind wir schnell überfordert und verlieren leicht den Überblick. In dieser Situation hilft die beschreibende oder deskriptive Statistik: Sie systematisiert und stellt Daten so dar, dass ein Überblick möglich wird. In dieser Form begegnet uns Statistik nahezu täglich. Arbeitslosenquote, Anstieg der Kriminalität, Marktanteile bei Pkw-Zulassungen, Prozentzahl vermeintlich verhaltensgestörter Grundschüler, Wachstum des Bruttosozialproduktes und vieles mehr sind statistische Informationen in den Tageszeitungen oder Nachrichtensendungen.
Die gegenwärtige psychologische Literatur ist nur noch mit Kenntnis einschlägiger deskriptiv-statistischer Begriffe zu verstehen. Dies wird auch im weiteren Text dieses Lehrbuches teilweise so sein. Statistische und methodische Begriffe lassen sich im umfangreichen Lexikon der Psychologie (Wirtz 2014) nachschlagen. Im Folgenden werden einige häufig auftretende Grundbegriffe kurz erläutert.
Häufigkeiten
Einsicht in die Struktur von Daten und damit über die Ergebnisse sind im Wesentlichen durch Häufigkeitsangaben, Angaben über zentrale Tendenzen und Variation sowie über Zusammenhänge (Korrelationen) von Merkmalen zu erhalten. Häufigkeiten geben an, wie oft bestimmte Merkmale oder Merkmalsausprägungen vorkommen. Die Darstellung geschieht in Tabellen oder Diagrammen; absolute und relative (Prozent-)Angaben sind möglich.
zentrale Tendenz
Maße der zentralen Tendenz beschreiben einen Wert, der für eine Gruppe von Objekten (Personen) typisch ist. Bekanntestes Beispiel ist das arithmetische Mittel oder Mittelwert (umgangssprachlich: Durchschnitt). Im Beispiel der Mathematiknoten ergibt sich als Mittelwert: M = 2,94.
Variation
Maße der Variation enthalten die Information, wie weit die einzelnen Messwerte vom festgestellten Mittelwert abweichen. Diese Information ist wichtig; schließlich können die einzelnen Messwerte sehr stark oder sehr wenig vom Mittelwert abweichen. Das bedeutsamste Maß ist die Standardabweichung (bzw. die Varianz als quadrierte Standardabweichung). Geometrisch dargestellt entspricht die Standardabweichung dem Abstand zwischen Höhepunkt und Wendepunkt in der Normalverteilung (auch bekannt als Gaußsche Kurve). Je höher der Wert der Standardabweichung, desto stärker streuen die einzelnen Messwerte um den Mittelwert.
Im vorigen Beispiel der Schulnoten ergibt sich eine Standardabweichung von s = 1,03 bzw. eine Varianz von s2 = 1,06.
Korrelation
Korrelationsmaße beschreiben den Zusammenhang zwischen zwei Merkmalen. Er wird durch Korrelationskoeffizienten ausgedrückt. Diese bewegen sich im Zahlenbereich von -1,0 bis +1,0. Eine Korrelation mit positivem Vorzeichen beschreibt eine gleichsinnige Variation der Merkmale (wenn A ansteigt, dann steigt auch B an). So besteht beispielsweise eine positive Korrelation zwischen »Intelligenz« und »Schulleistung«. Je höher die Intelligenz einer Person, desto höher ist, mit bestimmter Wahrscheinlichkeit, auch ihre Schulleistung. Eine negative Korrelation beschreibt eine gegenläufige Variation der beiden Merkmale (wenn A ansteigt, dann sinkt B ab). Ein Beispiel einer negativen Korrelation ist der Zusammenhang zwischen Nikotinkonsum und Lebenserwartung. Je höher der Nikotinkonsum einer Person, desto niedriger wird, mit bestimmter Wahrscheinlichkeit, ihre Lebenserwartung.
Schema: Mittelwert und Standardabweichung in einer Normalverteilung
Korrelationen sagen nichts über Ursache-Wirkungs-Beziehungen aus. Man erfährt nur, dass ein bestimmter Zusammenhang zwischen zwei Merkmalen besteht und nicht warum. Zur sprachlichen Kennzeichnung von Korrelationskoeffizienten hat sich folgende Konvention herausgebildet (ohne Berücksichtigung des Vorzeichens):
| 0,0 bis 0,2: | »kein Zusammenhang« | |
| 0,2 bis 0,4: | »geringer Zusammenhang« | |
| 0,4 bis 0,6: | »mittlerer Zusammenhang« | |
| 0,6 bis 0,8: | »hoher Zusammenhang« | |
| 0,8 bis 0,9: | »sehr hoher Zusammenhang« | |
| 1,0: | »perfekter Zusammenhang« |
Beschreibende Statistik ist nur ein Hilfsmittel, einen Überblick zu erhalten, der sonst nicht erreichbar wäre. Wichtiger jedoch ist die Frage, ob die damit beschriebenen Ergebnisse auf Regeln oder Gesetzmäßigkeiten schließen lassen, die verallgemeinert werden können. Dieses Problem wird in der Schließenden Statistik (oder Inferenzstatistik) bearbeitet.
2.6.5. Inferenzstatistik – oder: Irren ist menschlich
Population
Psychologische Forschung sucht nach Regeln des Verhaltens und Erlebens. Die Gesamtheit aller Personen (oder Objekte), über die etwas ausgesagt werden soll, wird als Population bezeichnet. Sie wird durch die Forschungsfrage definiert. Wenn ich etwa wissen will, welchen Erziehungsvorstellungen alleinerziehende Mütter folgen, dann ist die Gesamtheit aller alleinerziehenden Mütter die Population – und nicht Mütter allgemein. Wenn ich nach den Verhaltensstörungen von Grundschülern in der vierten Klasse frage, dann wird die Population aus allen Viertklässlern gebildet – und nicht etwa aus allen möglichen Schülern. Populationen sind daher unterschiedlich umfangreich.
Stichprobe
Nun wird es praktisch niemals gelingen, eine definierte Population insgesamt zu untersuchen. Vielmehr können nur mehr oder weniger kleine Stichproben daraus untersucht werden. Stichproben sollten möglichst getreue (repräsentative) Abbilder ihrer Population sein. Da empirische Untersuchungsergebnisse praktisch immer aus Stichproben stammen, die wissenschaftliche Aussage aber für die zugehörige Population gültig sein soll, besteht die grundsätzliche Gefahr eines Irrtums: Gilt das, was in der Stichprobe gefunden wurde, wirklich auch für die Population? Oder anders formuliert: Darf ein Stichprobenergebnis verallgemeinert werden oder nicht?
Folgende vier Situationen können nun vorliegen, wobei beachtet werden muss, dass die Verhältnisse in der Population grundsätzlich nicht bekannt sein können:
(1) In der Stichprobe zeigt sich eine Regelhaftigkeit. In der Population gilt sie auch.
(2) In der Stichprobe zeigt sich keine Regelhaftigkeit. In der Population existiert sie auch nicht.
(3) In der Stichprobe zeigt sich eine Regelhaftigkeit. In der Population gilt sie nicht.
(4) In der Stichprobe zeigt sich keine Regelhaftigkeit. In der Population existiert jedoch eine.
Werden nun Stichprobenergebnisse als gültig für die Population angenommen, d. h. verallgemeinert, dann zeigt sich Folgendes: In den Situationen (1) und (2) ist die Verallgemeinerung zutreffend und richtig. Das, was sich in der Stichprobe zeigt, gilt auch in der Population.
Alpha-Fehler
Situation (3) führt zu einer falschen Schlussfolgerung. Aufgrund des Stichprobenergebnisses wird eine Gesetzmäßigkeit in der Population angenommen, die nicht existiert. Diese Art von Fehler kann als »Aberglaube« bezeichnet werden. (So wie Astrologen in Sternbildern einen ordnenden Einfluss auf das Leben von Menschen annehmen, der nicht existiert.) In der methodischen Literatur wird dieser Irrtum mit Alpha-Fehler benannt.
Beta-Fehler
Situation (4) führt ebenfalls in die Irre. Man vermutet keine Gesetzmäßigkeit in der Population, obwohl sie vorhanden ist. Diese Art von Fehler deutet auf »Unfähigkeit«. (So wie Astronomen lange Zeit die Gesetzmäßigkeiten der Bewegung von Himmelskörpern nicht fanden.) Dies ist der Beta-Fehler.
Im Forschungsprozess wird nun versucht, die Situation (3) d. h. den Alpha-Fehler so weit wie möglich zu vermeiden. Im Vertrauen darauf, dass Fehler oder »Unfähigkeit« mit zunehmender Forschung abnehmen, wird der Beta-Fehler dagegen eher in Kauf genommen.
Signifikanzprüfung
Mit den Verfahren der Interferenzstatistik werden Berechnungen darüber angestellt, wie wahrscheinlich der Alpha-Fehler ist, wenn ein vorgefundenes Stichprobenergebnis verallgemeinert wird. Das Grundprinzip besteht darin, die tatsächlich gefundenen Ergebnisse der Stichprobe mit hypothetischen Ergebnissen zu vergleichen, so wie sie ausfallen müssten, wenn in der Population keine entsprechenden Gesetzmäßigkeiten bestünden. Oder anders: Es wird geprüft, inwieweit das vorgefundene Ergebnis (noch) durch zufällige Gegebenheiten der Stichprobe erklärt werden könnte. Diesen Vorgang nennt man Prüfung der statistischen Signifikanz (kurz Signifikanzprüfung), die entsprechenden mathematisch-statistischen Verfahren Signifikanztests.
Irrtumswahrscheinlichkeit
Da nun eine falsche Schlussfolgerung, ein Irrtum nie ausgeschlossen werden kann, ist abzuwägen, welches Risiko noch in Kauf genommen werden soll. Als Konvention hat sich herausgebildet, eine Irrtumswahrscheinlichkeit für den Alpha-Fehler von 5 % bzw. 1 % zu tolerieren. Erst wenn die Wahrscheinlichkeit für die fälschliche Annahme einer Gesetzmäßigkeit nur noch 5 % bzw. 1 % beträgt, ist man bereit, Stichprobenergebnisse auch für die Population als gültig anzunehmen. Anders formuliert heißt dies: Verallgemeinert man ein Stichprobenergebnis, dann ist diese Verallgemeinerung mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 5 % bzw. 1 % unzutreffend.
Ergebnisse, die mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit für den Alpha-Fehler von 5 % behaftet sind, nennt man statistisch signifikant, solche mit 1 % sehr signifikant.
Auf ein zunehmendes Missverständnis soll noch hingewiesen werden. Statistische Signifikanz bedeutet in keiner Weise auch inhaltliche Bedeutsamkeit! Ergebnisse können statistisch sehr signifikant und inhaltlich höchst bedeutungslos sein. Die statistische Signifikanz berechtigt nur zur Verallgemeinerung.
Seriöse empirische Untersuchungen enthalten bei der Ergebnisdarstellung stets drei Komponenten: Das inhaltliche Ergebnis selbst, die Art der Signifikanzprüfung (Signifikanztest) und die Signifikanzangabe. Fehlt eine dieser drei Komponenten, sind damit verbundene Aussagen unbrauchbar.
Wegen der immer noch bestehenden und grundsätzlich nicht zu vermeidenden Möglichkeit eines Irrtums verbietet es sich, aufgrund von empirischen Untersuchungen von Beweisen zu sprechen. Vielmehr liefern empirische, inferenzstatistisch geprüfte Ergebnisse »nur« mehr oder weniger überzeugende Belege für bestimmte Hypothesen. Seriöse psychologische Argumentationen können daher nicht mit Formulierungen wie »Untersuchungen haben bewiesen, dass ...« beginnen.