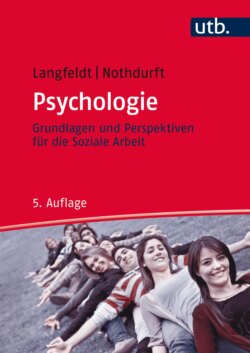Читать книгу Psychologie - Hans P. Langfeldt - Страница 9
Оглавление3. Psychologie der Person
In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit dem zentralen Gegenstand der Psychologie, dem Individuum, der Person.
Die Vorstellung einer einzigartigen, einmaligen Persönlichkeit erscheint heutzutage selbstverständlich – sie ist aber eine relativ moderne Erfindung und entsteht erst unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen. Diesen Bedingungen spüren wir im ersten Abschnitt dieses Kapitels nach (3.1.2.), um dann zu erkunden, in welcher Weise Persönlichkeit heutzutage zum Thema und zur Sprache gebracht wird (3.1.3.). Daran anschließend stellen wir drei Theorien vor, in denen auf sehr unterschiedliche Weise Persönlichkeit zum Gegenstand psychologischen Nachdenkens gemacht wird (3.2.).
3.1. Bilder vom Menschen
3.1.1. Alltagsvorstellungen über »Persönlichkeit«
»Er hat Persönlichkeit.«, »Sie ist eine Persönlichkeit.« Was immer das auch heißen mag, es ist ein Kompliment. »Sie ist ein nettes Persönchen.« Von Frauen wird dies wohl nicht als Kompliment verstanden, sondern eher als überhebliches Männergerede. »So eine Person!« Dieser Ausruf teilt einigermaßen unzweideutig Entrüstung über jemanden mit.
So schillernd die Begriffe »Persönlichkeit« oder »Person« auch sein mögen, umgangssprachlich scheinen wir recht gut damit umgehen zu können. Dies fällt umso leichter, als uns zur näheren Beschreibung von Personen von »arglistig« bis »zynisch« Tausende von Eigenschaftswörtern zur Verfügung stehen.
Wenn von jemandem gesagt wird, er sei ein »Chaot«, ein »Penner«, ein »Softie« oder sie sei eine »Schlampe«, ein »Muttchen« oder eine »Emanze«, wenn also Substantive zur Personenbeschreibung verwendet werden, dann nähert man sich einer alltagspsychologischen Persönlichkeitstypologie. Damit werden uns weitere, nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Kennzeichnung einzelner Personen zur Verfügung gestellt. Es ist also nicht uninteressant, einmal zu fragen, mit welchen Bezeichnungen Personen im Alltag beschrieben werden.
Personenbeschreibung
Eine Inhaltsanalyse freier Personenbeschreibungen, die von amerikanischen Kindern und Jugendlichen angefertigt wurden, erbrachte 30 unterscheidbare Inhaltsklassen, die sich wiederum in fünf Gruppen systematisieren ließen. Nach diesen Ergebnissen (Bromley 1977, zit. n. Schneewind 2010, S. 19 – 22) werden in Alltagsbeschreibungen von Personen folgende Inhalte verwendet:
Dimensionen von Personenbeschreibungen
(1) interne Aspekte der Person (z. B. Eigenschaften, Fähigkeiten, Motive, Emotionen),
(2) externe Aspekte der Person (z. B. äußere Erscheinung, biographische Daten, materielle Situation),
(3) soziale Beziehungen (z. B. familiäre und freundschaftliche Beziehungen, Wirkung auf andere Personen, Reaktionen anderer Personen),
(4) Beziehung zwischen beschreibenden und beschriebenen Personen (z. B. Betonung von Gemeinsamkeiten oder Unterschieden),
(5) Bewertungen und Sonstiges.
Nun wird es allerdings nicht so sein, dass immer alle Inhalte verwendet werden. Selbstverständlich werden die mehr oder weniger deutlich erkennbaren Eigenarten der beschriebenen Personen bestimmte Inhalte nahe legen. Aber auch der Beschreibende selbst mit seinen Vorlieben und Eigenheiten, sowie die Situation (z. B. Zweck der Personenbeschreibung) haben einen Einfluss auf die Inhalte der Personenbeschreibung.
Eine Untersuchung von Huber/Mandl (1979) an Lehrern bestätigt diese allgemeine Aussage. In Schülerbeschreibungen konnten 36 Inhaltsklassen identifiziert werden, die sieben Aspekten zugeordnet wurden:
(1) sozioökonomischer Hintergrund
(2) familiäre Bedingungen
(3) schulische Bedingungen,
(4) allgemeine Persönlichkeitscharakterisierungen,
(5) abweichendes Sozialverhalten,
(6) interaktive Merkmale und
(7) Leistungsmerkmale.
Eine detaillierte Betrachtungsweise der Ergebnisse zeigte, dass nicht alle Lehrer alle Inhalte in gleicher Weise nutzten. Es ließen sich vier Gruppen von Lehrern identifizieren: Lehrer, die eher allgemeine Persönlichkeitscharakterisierungen verwendeten, die familiäre Bedingungen betonten, die Leistungsmerkmale in den Vordergrund rückten oder die ihr Augenmerk auf abweichendes Verhalten und Konformität richteten. Es ist leicht zu erkennen: Die Inhalte von Persönlichkeitsbeschreibungen richten sich nach dem Beschreibenden, dem Beschriebenen und der Situation (vgl. auch Kapitel 5). Deshalb wurde Persönlichkeit eingangs als »schillernder Begriff« bezeichnet.
3.1.2. Persönlichkeit – Eine neuzeitliche Erfindung
Selbstverständnis – selbstverständlich
Für uns heutzutage ist die Vorstellung, dass wir eine individuelle, von unseren Mitmenschen unterschiedene Persönlichkeit besitzen, so selbstverständlich, dass jede andere Vorstellung schwerfällt. Wir begreifen uns als komplexe Persönlichkeit, mit einer differenzierten – vielleicht nicht ganz durchschauten – Gefühlswelt, mit Vernunft und Rationalität ausgestattet, mit inneren Werten, einem besonderen Charakter und einem Wesenskern (dem wir »im Grunde unseres Herzens« treu sind). Diese ganze Ausstattung begreifen wir zudem als in uns liegend, als etwas, was höchstens teilweise für andere sichtbar ist, als unseren eigenen, unveräußerlichen privaten Wesenskern. »In unseren Sprachen der Selbstverständigung spielt der Gegensatz ›innen/außen‹ eine wichtige Rolle. Unsere Gedanken, Vorstellungen oder Gefühle sind nach unserer Auffassung ›in‹« uns, (...). Außerdem meinen wir, unsere Fähigkeiten oder Möglichkeiten seien etwas ›Inneres‹, das auf die Entwicklung wartet, durch die dieses Potentielle in der öffentlichen Welt kundgetan oder verwirklicht wird. Das Unbewusste befindet sich nach unserer Vorstellung innen; und die Tiefen des Ungesagten, des Unsagbaren, der sich anbahnenden heftigen Gefühle, Neigungen und Ängste, mit denen wir um die Beherrschung des eigenen Lebens ringen, fassen wir ebenfalls als etwas Inneres auf. Wir sind Geschöpfe mit innerer Tiefe, mit einem Inneren, das zum Teil unerforscht und dunkel ist« (Taylor 1996, S. 207).
Selbstverständnis – nicht natürlich
Dieses Selbstverständnis empfinden wir so tiefsitzend, so elementar, so »bis in die Knochen«, dass es weit mehr ist als nur ein Selbstverständnis – es ist ein elementares Gefühl für uns selbst, das die Basis unseres Denkens, Erlebens und Handelns ist, uns ein elementares Sicherheitsgefühl verleiht und uns zur inneren Natur geworden ist. Gerade weil uns dieses Gefühl so selbstverständlich, so natürlich ist, ist es wichtig, festzustellen, dass es sich hier um ein »modernes« Lebensgefühl handelt, das in dieser Form erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Europa auftaucht. Es ist ein Resultat gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse, »... ist abhängig von einer historisch begrenzten Art der Selbstinterpretation, die im neuzeitlichen Abendland zur Vorherrschaft gekommen ist und sich von da aus freilich auch auf andere Teile der Erdkugel ausbreiten kann, (...) aber dennoch einen Anfang in Raum und Zeit hat und vielleicht auch ein Ende« (Taylor 1996, S. 207f.). Dass dieses Gefühl aber so elementar für uns werden konnte, ist das Ergebnis des Zusammenwirkens unterschiedlicher zivilisatorischer Entwicklungsstränge aus Philosophie, Naturwissenschaft, Technik, Politik und Stadtentwicklung. Diese Stränge haben dieses Selbstgefühl so tief in uns eingeschrieben, dass es auch die Basis unseres Nachdenkens über uns selbst ist. »So ist es ganz natürlich, dass wir zu der Auffassung kommen, wir hätten ein Selbst in der gleichen Weise, in der wir einen Kopf oder Arme haben, oder innere Tiefe in der gleichen Weise wie Herz oder Leber« (Taylor 1996, S. 208).
Natürlich haben Menschen schon immer über sich selbst oder über Menschen im Allgemeinen nachgedacht. Zu Beginn der Moderne kommt es aber zu einer wesentlichen Zuspitzung dadurch, dass die eigene Person in besonderer Weise zum Gegenstand der eigenen Betrachtung gemacht wird.
Das Ich als Mittelpunkt
»Vor dem siebzehnten Jahrhundert betrachteten die herrschenden Kosmologien das Universum als eine sinnhafte Ordnung« (Taylor 1992, S. 246). Diese Vorstellung wird nunmehr fragwürdig. Innerhalb der Philosophie gelangte man zu der Einsicht, dass wahre Erkenntnis erfordert, die eigenen Denkprozesse in ihrem Funktionieren zu beobachten und zu kontrollieren. Dazu war es erforderlich, einen Schritt aus sich heraus zu machen und sich selbst von außen als Gegenstand zu betrachten. Dieser Schritt wurde als »reflexive Wende« bezeichnet. Diese reflexive Wende zu den eigenen Denkprozessen ist die Geburtsstunde des modernen Selbst-Konzepts, seit der wir von dem »Selbst«, dem »Ich« oder dem »Ego« sprechen.
Kontrolle als Leitgedanke
Diese reflexive Wende konnte sich durchsetzen, weil sie in der damaligen Zeit von einer allgemeinen Geisteshaltung der Disziplinierung und Überwachung aller gesellschaftlichen Bereiche getragen wurde. Diese Haltung führte zur Ausbildung entsprechender Praktiken und prägte die Entwicklung von Militär, Anstalten wie z. B. Hospitälern, Irrenhäusern, Schulen, etc., und förderte bürokratische Kontrolle und Organisation (vgl. Foucault 1993). Die reflexive Wende »(...) dürfte sich den treuen Befürwortern dieser Praktiken empfehlen, diesen eine rationale Grundlage verschaffen, sie rechtfertigen und überdies recht weitreichende Hoffnungen wecken auf ihre Wirksamkeit im Bereich der menschlichen Angelegenheiten. Die Theorie hat ohne Zweifel dazu beigetragen, dass sich die Praktiken auf ihrem Marsch durch die Kultur von heute alles haben unterwerfen können« (Taylor 1996, S. 314).
Das Autonome Ich
Parallel zu dieser reflexiven Wende bildet sich die Vorstellung eines individuellen Einzelsubjekts aus. Während man sich selbst bis zu diesem Zeitraum wesentlich als Bestandteil einer größeren Gemeinschaft, der Familie, der Sippe, des »Hauses« oder des Dorfes empfand und sich dieser gegenüber im eigenen Handeln verpflichtet fühlte, begreift man sich nun zunehmend als autonomes, mit eigenem freien Willen begabtes Einzelsubjekt. Diese Idee des Atomismus entwickelt sich simultan in verschiedenen Gesellschaftsbereichen, sie wirkt innerhalb der sich etablierenden Naturwissenschaften, innerhalb moderner Auffassungen über das Politische, im Bereich des Religiösen und im Bereich der Ökonomie.
Entwicklung zum Privaten
Zur gleichen Zeit gibt es eine entscheidende Entwicklung in der Lebensweise der Menschen zur Privatisierung – vom »Leben vor aller Augen« (Taylor 1992, S. 254) hin zum Leben im Privaten. »Wenn der Mensch Individuum wird, beginnt er mehr und mehr in privaten Räumen zu leben« (Trilling 1980, S. 31). Menschen schaffen zunehmend ihnen allein gehörende Räume, verändern ihr Mobiliar (die Ersetzung von Bänken durch Stühle) und führen persönliche Gerätschaften ein (z. B. Essbesteck). Diese Lebensweise und dieses Lebensgefühl befördern den Gedanken des inneren persönlichen Raumes, der für die Vorstellung des inneren privaten Ichs Pate gestanden hat.
Die Bedeutung des Spiegels
Im Zuge der zivilisatorischen Entwicklung können außerdem bestimmte, einzelne technische Erfindungen von besonderer Bedeutung für die Förderung des modernen Selbstverständnisses gewesen sein. »Der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan meint, dass die Entwicklung des »Je« durch die Spiegelherstellung gefördert wurde, (es) lässt sich nicht entscheiden, ob die Überzeugung des Menschen, ein »Je« zu sein, sich herausbilden konnte, weil die venezianischen Handwerker gelernt hatten, wie man Spiegelglas herstellt, oder ob umgekehrt das Bedürfnis nach Spiegeln diese technische Neuerung angeregt hat« (Trilling 1980, S. 31).
Autobiographie als Modell
Die Entstehung – oder Erfindung – des eigenen, persönlichen, individuellen Ichs wird weiterhin gefördert durch die Entwicklung einer neuen Schreibform, der Autobiographie, der Selbstbeschreibung, des Tagebuchs. Autobiographien lieferten den Menschen gleichsam Modelle, wer sie sind und wie sie sind, an denen sie sich orientieren konnten angesichts der neuen Frage: »Wer bin ich?«. Diese Frage wird den modernen Menschen nicht mehr loslassen. Psychologische Persönlichkeitstheorien sind Versuche, auf sie eine Antwort zu finden.
| Philosophie | Politik/Wirtschaft | Alltagspraxis | Gesellschaft | |
| traditionelle Auffassung | Ordnung in der Welt | Mensch Bestandteil einer größeren Gemeinschaft | kollektiver Lebensvollzug | regelloses Handeln |
| Veränderung | reflexive Wende | Atomismus | Privatisierung | Überwachung |
| neuzeitliche Auffassung (17. Jhdt.) | Ordnung im Subjekt | Einzelsubjekt autonom, souverän mit eigenem Willen | private Räume privates Mobiliar private Geräte | Institutionalisierung (Militär, Schule, Anstalten) u. Bürokratisierung |
| Leitbegriff | Vernunft | Autonomie | Individualität | Kontrolle |
Schema: Zivilisatorische Entwicklungslinien der Ausbildung des modernen Selbstkonzeptes
3.1.3. Person als Gegenstand der Psychologie
Gleichheit und Verschiedenheit können als grundsätzliche Charakteristika allen Lebens gesehen werden. Trotz vieler Gemeinsamkeiten sind die Angehörigen einer Art durch mindestens ebenso viele Unterschiede gekennzeichnet. Jeder Mensch erlebt sich auf seine Weise einzigartig und unterscheidet sich darin von allen anderen Menschen, von welchen Gemeinsamkeiten mit anderen, wie etwa Rasse, Geschlecht, Fähigkeiten Vorstellungen, Vorlieben oder Abneigungen er auch sonst geprägt sein mag. Unverwechselbar, »Ich selbst«, ein »Individualist« zu sein und eben nicht »Rädchen im Getriebe« oder »Teil einer Masse« sein zu wollen, diese Zielvorstellung bestimmt in vielen Situationen unser tägliches Leben. Wir betonen die Unterschiede zwischen uns und unseren Mitmenschen. Gleichzeitig betonen wir aber auch unsere Gleichheit. Kleidung, Sprache, Hobbys oder Freizeitverhalten zeigen häufig unser Bemühen, so zu sein wie andere. Für viele von uns ist es wichtig, zu wissen, was »in« und was »out« ist.
Die Frage von Gleichheit oder Verschiedenheit ist vorwiegend die Frage der Genauigkeit, mit der wir Personen wahrnehmen. Je genauer wir einzelne Personen beobachten und kennen, desto mehr kann sich eine zunächst wahrgenommene Gleichheit zur Ähnlichkeit oder gar Unterschiedlichkeit auflösen. Umgekehrt ist es ebenso möglich, dass wir erst nach intimer Kenntnis von Personen Ähnlichkeiten wahrnehmen, die uns vorher verborgen geblieben waren.
Differenzielle Psychologie
Die Suche nach Gleichheit und Verschiedenheit zwischen Menschen führt zwangsläufig zur Beobachtung einzelner, möglicherweise immer spezifischeren Charakteristika oder Merkmalen von Personen. In der Regel nehmen wir in unserem Bekanntenkreis deutliche Unterschiede zwischen den Personen wahr. Wir haben Eindrücke über ihre Intelligenz, ihr Selbstvertrauen, ihre Sportlichkeit oder Musikalität, über ihre Ängstlichkeit oder Aggressivität und vieles mehr. Solche wahrgenommenen individuellen Unterschiede beeinflussen wesentlich die soziale Interaktion im Privatleben, ebenso wie im Erziehungswesen oder im Berufsleben. Spätestens wenn Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion auftreten, können Theorien und Befunde der Differenziellen Psychologie hilfreich sein. Dabei geht es um:
die Beschaffenheit von Merkmalen mit interindividuellen Differenzen,
das Ausmaß und die Ursachen dieser Differenzen,
die wechselseitigen Abhängigkeiten differierender Merkmale sowie
deren Beeinflussbarkeit durch Erziehung, Training oder Umwelteinflüsse (siehe Amelang/Bartussek 2010, S. 4).
Es gelingt nicht, eine generelle Bedeutsamkeit einzelner Persönlichkeitsmerkmale festzulegen, einfach deswegen, weil sie immer nur für etwas wichtig sind. Es hängt im Wesentlichen von der Situation ab, in der nach bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen gefragt wird. Bei Berufswahlsituationen mag »Intelligenz« sehr wichtig sein, bei der Rehabilitation von Alkoholikern etwa »Aggression« und bei Adoptionsentscheidungen »prosoziales Verhalten«.
Für die Angehörigen sozialer Berufe wird die psychologisch-wissenschaftliche Betrachtungsweise von Persönlichkeitsmerkmalen und den interindividuellen Unterschieden immer dort bedeutsam, wo zu irgendwelchen Zwecken psychologische Gutachten erstellt und interpretiert werden müssen. Während das Erstellen solcher Gutachten eindeutig eine ausschließliche Aufgabe von Psychologen ist (oder zumindest sein sollte), sind Angehörige sozialer Berufe nicht selten vor die Aufgabe gestellt, solche Gutachten zu interpretieren und daraus Schlussfolgerungen ziehen zu müssen. Dazu sollen zwei grundlegende Gesichtspunkte der psychologischen Personenbeschreibung diskutiert werden:
Die Annahmen über Art und Ausmaß von Personenunterschieden und
die speziellen Schwierigkeiten der sprachlichen Formulierung.
3.1.4. Die Normalverteilung als Modell zur quantitativen Beschreibung von Unterschieden
Wenn sehr viele Personen gemessen werden, dann ergibt sich bei vielen Merkmalen als charakteristische Verteilungsform der Messwerte eine Normalverteilung oder Gaußsche Glockenkurve.
Beispiel
Betrachten wir zur Demonstration einmal die relative Häufigkeitsverteilung des komplexen psychischen Merkmals emotionale Erregbarkeit. Dazu bearbeiteten 1.237 Jugendliche 21 Fragen entsprechenden Inhalts. Die Abbildung zeigt, wie viele Jugendliche wie viele Fragen im Sinne von emotionaler Erregbarkeit beantworteten.
empirische Häufigkeitsverteilung, mit der Jugendliche Fragen zur »emotionalen Erregbarkeit« beantworten (nach Daten von Seitz/Rausche 1976, S. 65)
hypothetische Verteilung
Die Häufigkeitsverteilung lässt erkennen: Die meisten Jugendlichen liegen in einem mittleren Bereich (etwa 5 – 13 Fragen), einige liegen darüber oder darunter, Extremwerte 0 oder 1 bzw. 20 oder 21 Fragen sind selten.
Solche Befunde führen zur sinnvollen Hypothese, dass psychische Merkmale sich häufig auf der Grundlage von Normalverteilungen beschreiben lassen. Sie wird so zum grundlegenden Modell zur quantitativen Beschreibung von Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit bei Personen hinsichtlich eines definierten Merkmals. Die Mehrzahl der Personen gruppiert sich dabei im Mittelbereich der Verteilung. Sie sind sich also in diesem Merkmal relativ ähnlich. Einige weichen mehr oder weniger deutlich von diesem Mittelbereich ab, wenige liegen in den beiden Extrembereichen. Je weiter sich Personen vom Mittelbereich entfernen, desto relativ unähnlicher werden sie den vielen Personen im Mittelbereich.
Ab wann ist aber eine Person vom Mittelbereich so weit abweichend, dass man sagen könnte, sie sei anders als die anderen? Zur Beantwortung dieser Frage hat sich eine statistische Konvention eingebürgert, die besagt, dass alle Personen, die mehr als eine Standardabweichung s (Kap. 2.6.4.) vom Mittelwert abweichen, als »unter-« bzw. »überdurchschnittlich« betrachtet werden. Dies ist in der folgenden Abbildung dargestellt.
Nach dieser Definition haben stets, wegen der mathematischen Eigentümlichkeiten der Normalverteilung, bei jedem entsprechenden Merkmal jeweils etwa 16 % aller Personen über- bzw. unterdurchschnittliche und etwa 68 % durchschnittliche Messwerte. Diese Klassifikation bedeutet für sich noch keine Wertung. Überdurchschnittlich intelligent zu sein, wird beispielsweise positiv gewertet, überdurchschnittlich emotional erregbar zu sein, wohl eher negativ. Die Wertung, ob Unterschiede für wichtig oder unwichtig, für positiv oder negativ gehalten werden, ergibt sich nicht aus dem statistischen Modell der Normalverteilung, sondern aus der inhaltlichen Fragestellung.
3.1.5. Sprachliche Beschreibung von Individualität
Dass man mit Sprache die Individualität eines Menschen, seine Eigenarten, seine Neigungen oder sein Verhalten vorzüglich und anschaulich beschreiben kann, zeigen uns hervorragende Schriftsteller immer wieder. Sprache, gut beherrscht, ist ein exzellentes Mittel zur Beschreibung von Personen in ihrer Gleichheit und Verschiedenheit. Gerade darin liegt, so paradox dies zunächst auch klingen mag, eine Schwierigkeit der psychologisch fundierten Personenbeschreibung.
Unschärfe von Begriffen
Eine psychologische Personenbeschreibung kann, von wenigen Fachbegriffen einmal abgesehen, nur die Begriffe der Umgangssprache verwenden. Fachbegriffe und umgangssprachliche Begriffe können unter Umständen gleich lauten, aber doch zumindest teilweise etwas Unterschiedliches bedeuten. Nicht selten gehen psychologische Fachbegriffe in den umgangssprachlichen Wortschatz über (wie etwa »Motivation«, »Frustration« oder »neurotisch«) und verändern dabei teilweise ihre ursprüngliche Bedeutung.
In dem Maße, in dem psychologische Beschreibungen umgangssprachlich formuliert sind, unterliegen sie denselben Prozessen der Bedeutungsveränderung wie sonstige sprachliche Beschreibungen auch. Wenn ein Romantext bei mehreren Personen unterschiedliche Eindrücke hervorruft, ist dies wahrscheinlich weniger gravierend. Das kann dem Text sogar einen besonderen Reiz geben. Wenn jedoch aus einem psychologischen Gutachten unterschiedliche Eindrücke und Schlussfolgerungen möglich sind, dann können sich durchaus schwerwiegende Problemlagen ergeben.
vier Ebenen der Beschreibung
Personenbeschreibungen können aufgrund der verfügbaren Begriffe nur mehr oder weniger eindeutig sein. Der Versuch, sie in eindeutigen, nicht umgangssprachlichen Begriffen abzufassen, führt dagegen leicht in Unverständlichkeit. Es scheint zumindest die Gefahr eines Dilemmas zwischen Eindeutigkeit und Unverständlichkeit zu bestehen. Es lohnt also, sich die sprachlichen Möglichkeiten zur Personenbeschreibung einmal näher anzusehen.
Graumann (1964) unterscheidet vier Modi oder Ebenen sprachlicher Beschreibung. Sie sollen an einem Beispiel erläutert werden.
Angenommen, ein vierjähriges Kind sei weinend im Einkaufstrubel einer Fußgängerzone allein aufgefunden worden. Es wird von einer Mitarbeiterin des Jugendamtes abgeholt. Sie muss nun einen Bericht über diesen Vorfall schreiben. Folgende Möglichkeiten stehen ihr zur Verfügung:
Modi verbaler Beschreibung:
(1) Der verbale Modus: »Das Kind weinte.«
verbal
Die Person wird in ihrem Verhalten unter Verwendung von Verben beschrieben. Der Leser erfährt nur, was die Person tut. Diese Beschreibung ist relativ eindeutig.Ob das Kind weinte oder nicht, ist ziemlich unzweifelhaft feststellbar.
adverbial
(2) Der adverbiale Modus: »Das Kind weinte verzweifelt.«
Die Person wird in ihrem Verhalten unter Verwendung von Verben und Adverbien beschrieben. Diese Aussage enthält eine Schlussfolgerung des Beschreibenden über das »Wie« des Verhaltens. Ob das Kind wirklich »verzweifelt« weinte, ist schon weniger eindeutig.
adjektivisch
(3) Der adjektivische Modus: »Das Kind war verzweifelt.«
Die Person wird mit Adjektiven beschrieben. Man erfährt bereits nichts mehr über das konkrete Verhalten, dafür aber etwas darüber, wie die Person ist. Dies sind bereits weitgehende Schlussfolgerungen des Beschreibenden, die unter Umständen nur noch schwer nachvollziehbar sind.
substantivisch
(4) Der substantivische Modus: »Die Verzweiflung des Kindes war groß.« Die Person wird in Substantiven beschrieben. Dabei sind dann überdauernde Persönlichkeitsmerkmale oder Zustände beschrieben. Der Beschreibende geht also in seinen Schlussfolgerungen noch einen Schritt weiter und entfernt sich noch mehr vom konkreten Verhalten.
Von Stufe zu Stufe nehmen die Schlussfolgerungen zu, die der Beschreibende hinzufügt.
In einer Berufspraxis, in der über Personen beraten, Stellungnahmen abgegeben oder zur Kenntnis genommen werden müssen, sollten daher Personenbeschreibungen im adjektivistischen oder substantivischen Modus durch Erläuterungen im verbalen und adverbialen Modus präzisiert werden. In der psychologischen Fachsprache ist dieses Problem insofern eingegrenzt, als die Begriffe über Personenmerkmale sehr häufig operational definiert sind. Findet man zum Beispiel in einem psychologischen Gutachten eine Aussage über das Ausmaß des Neurotizismus einer Person, dann beschränkt sich diese Aussage im strengen Sinne zunächst nur auf die Fragen, mit denen Neurotizismus abgefragt wurde. Will man psychologische Aussagen verstehen, so ist es daher unumgänglich notwendig, die Methoden zu kennen, auf denen sie beruhen. Die sprachlichen Etiketten reichen nicht aus.
3.2. Drei Beispiele von Persönlichkeitstheorien
3.2.1. Vorbemerkung
In der Psychologie existiert keine einheitliche, verbindliche Definition von Persönlichkeit. »Mit der Persönlichkeit ist es wie mit der Liebe. – Jedermann weiß, dass es sie gibt, aber niemand weiß, was sie ist!« (Cattell 1973, S. 41, unsere Übersetzung). Die Anzahl entsprechender Definitionsversuche dürfte inzwischen dreistellig sein. Die Definition von Persönlichkeit verändert sich, wie im Alltag, unter den verschiedenen Blickwinkeln, unter denen Individuen betrachtet werden können. Dies muss all diejenigen enttäuschen, die von einer wissenschaftlichen Psychologie eine Antwort auf die philosophische Frage nach dem Wesen des Menschen erwarten. Eine empirische Persönlichkeitspsychologie, die »nur« danach fragt, wie menschliches Verhalten und Erleben beschrieben, erklärt und verändert werden kann, versteht »Persönlichkeit« ohnehin nur als hypothetisches Konstrukt, das nicht unbedingt abschließend definiert zu werden braucht.
Bezieht man sich nicht auf das Wesen des Menschen, sondern auf sein Verhalten und Erleben, dann lässt sich wenigstens einigermaßen übereinstimmend angeben, womit sich die Persönlichkeitspsychologie beschäftigt. Sie befasst sich mit den relativ überdauernden Verhaltens- und Erlebensunterschieden zwischen Individuen und deren Entwicklung.
Persönlichkeitstheorien werden von Wissenschaftlern entwickelt. Sie sind selbst Persönlichkeiten mit Vorlieben und Abneigungen, mit persönlichen Überzeugungen, mit Weltanschauungen und mit unterschiedlichen Menschenbildern. Ihre Theorien entsprechen ihrer Persönlichkeit. So wie wir selbstverständlich akzeptieren, dass ein Porträt von Lucas Cranach anders aussieht als eines von Picasso, müssen wir akzeptieren, dass Psychologen ebenfalls unterschiedliche Bilder (Theorien) vom Menschen entwerfen. Wir werden also eine Vielzahl unterschiedlichster Persönlichkeitstheorien vorfinden.
Die Frage, welche dann die richtige Theorie sei, ist dabei wenig fruchtbar.
Wir werden im Folgenden drei Theorien vorstellen, die in sehr unterschiedlicher Weise an das Thema Persönlichkeit heran gehen:
die psychoanalytische Theorie von Sigmund Freud,
die humanistische Persönlichkeitstheorie von Carl Rogers,
die sozialkonstruktivistische Persönlichkeitstheorie von Kenneth J. Gergen.
3.2.2. Sigmund Freud: Die psychoanalytische Theorie
von Maria Langfeldt-Nagel
Sigmund Freud ist populär wie wenige andere Wissenschaftler. Seine Theorien sind von einem breiten Publikum aufgegriffen, sowie in der Literatur, der Malerei und in Filmen verarbeitet worden. In weiten Bereichen der Psychotherapie, aber auch in der Pädagogik, bilden seine Konzepte und Methoden die Grundlage für die Erklärung individuellen Verhaltens und für Interventionen.
Sigmund Freud wurde 1856 in Mähren geboren und wuchs in Wien auf, wo er Medizin studierte und die meiste Zeit seines Lebens verbrachte. Ein Studienaufenthalt in Paris beim Psychiater Jean Charcot war der erste Schritt in die Richtung, die er schließlich einschlug; ein weiterer war die Zusammenarbeit und Freundschaft mit dem Wiener Internisten Josef Breuer. Freuds Ansichten brachten ihn in der prüden Wiener Gesellschaft in mancherlei soziale Schwierigkeiten; hinzu kam offener Antisemitismus. Seine wissenschaftliche Anerkennung fand er außerhalb Wiens. Aber auch seine Anhänger wie Alfred Adler, Carl Gustav Jung oder Wilhelm Reich sagten sich von ihm los und gründeten eigene psychoanalytische Schulen. Freud emigrierte 1938 nach London, wo er ein Jahr später starb.
Zu der Zeit, als Freud anfing, als Nervenarzt zu arbeiten, war gängige medizinische Lehre, dass Neurosen durch eine genetisch bedingte Nervenschwäche bedingt seien. Möglichkeiten ihrer Behandlung sah man daher kaum. Während eines Studienaufenthaltes in Paris im Jahre 1885 beschäftigte Freud sich mit der Hysterie und lernte die Hypnose kennen.
Hypnose
Durch Hypnose konnten für kurze Zeit hysterische Symptome sowohl erzeugt als auch zum Verschwinden gebracht werden. Freud folgerte daraus, dass psychische Prozesse, die den Patienten oder Patientinnen selbst nicht zugänglich sind, Ursache für die hysterischen Symptome seien. Dies war eine völlig neue Sichtweise, die auf Ablehnung und Unverständnis stieß.
Zurück in Wien, wo er eine psychiatrische Praxis gegründet hatte, arbeitete Freud mit Josef Breuer zusammen. Dieser ließ seine Patienten und Patientinnen in den Behandlungssitzungen intensiv reden. Mit dieser Methode der »Redekur« glaubte er zu den psychischen Ursachen der Störungen vorzudringen.
freie Assoziation
Freud entwickelte die Redekur zur Methode der freien Assoziationen weiter. Die Patienten und Patientinnen wurden verpflichtet, alles, was ihnen durch den Kopf ging, mitzuteilen. Eine willkürliche Lenkung oder Zensur sollte vermieden werden. Die Annahme war, dass das, was unter diesen Umständen gesagt wurde, durch unbewusste Motive bestimmt sei. Somit konnte mit der Methode der freien Assoziationen ein Zugang zu den unbewussten psychischen Prozessen gefunden werden. Diese Methode nannte Freud Psychoanalyse. Mit ihr konnte eine neue Welt von Daten erschlossen werden.
Traumdeutung
Eine weitere psychoanalytische Methode ist die der Traumdeutung. Während des Schlafens ist die bewusste Kontrolle herabgesetzt und unbewusste Prozesse können in verschlüsselter Form im Traum wahrgenommen werden. Eine Entschlüsselung der Trauminhalte müsste daher diese unbewussten Prozesse aufdecken.
Freud unterschied zwei Gruppen unbewusster Phänomene. Einige Inhalte können durch verstärkte Aufmerksamkeit ohne größere Schwierigkeiten ins Bewusstsein geholt werden. Diese nannte er vorbewusst. Andere wiederum können erst nach einigem Widerstand und erheblichem Aufwand durch die Psychoanalyse zugänglich gemacht werden. Freud bezeichnet solche als unbewusst. Zwei grundlegende Hypothesen begründen Freuds Theorie (Zusammenfassung bei Brenner 2000 oder Gay 2006):
(1) Psychische Prozesse sind selten bewusst. Freud ist zwar nicht der Entdecker des Unbewussten. Er betonte jedoch wie kein anderer vor ihm den Einfluss des Unbewussten auf das Erleben und Verhalten.
(2) Alle psychischen Prozesse sind durch vorhergehende bedingt. Nichts geschieht zufällig. Bei jedem Phänomen, und sei es noch so unverständlich, kann daher gefragt werden, wodurch es verursacht wurde. Dies gilt für »normales« Verhalten und Erleben ebenso wie für Auffälliges.
Verführungstheorie
Die Verführungstheorie: Im Jahre 1896 hielt Freud vor dem Verein für Psychiatrie und Neurologie in Wien einen Vortrag mit dem Titel »Zur Ätiologie der Hysterie« (Freud 1896). Darin entwickelte er die Theorie, dass Hysterien auf sexuelle Verführung im Kindesalter zurückzuführen seien.
Mit Hilfe der analytischen Methode war er bei Patientinnen und Patienten mit hysterischen Symptomen (zwölf Frauen und sechs Männer) auf sexuellen Missbrauch in der Kindheit durch Väter, Lehrer oder Dienstpersonal gestoßen. Den Patienten und Patientinnen waren die traumatischen sexuellen Erlebnisse zunächst nicht bewusst und es war ein langer und schwieriger Weg, die Erinnerungen daran freizulegen.
Freud versuchte eindringlich und mit großer Klarheit, den Zuhörern seine Ergebnisse auseinander zu setzen. Er ging selbst auf mögliche Einwände ein. Er führte aus, dass die massive Abwehr der Erinnerungen dagegen spräche, dass die Misshandlungen phantasiert worden waren. Zudem sprächen eine Reihe weiterer Gründe für die Richtigkeit seiner Entdeckung. So wurden die Symptome durch die Art der Misshandlung verständlich und durch das Erinnern und nochmalige Durchleben konnten Teilerfolge in der Therapie erreicht werden. In zwei der Fälle konnte die sexuelle Misshandlung durch dritte Personen bestätigt werden (Masson 1991).
Reaktion
Die Reaktion auf den Vortrag war eisig. Er stieß auch bei seinen Befürwortern und Freunden auf einhellige Ablehnung. Wenige Jahre nach diesem Vortrag nahm Freud von seiner »Verführungstheorie« Abstand. Als Grund gab er an, dass sexueller Missbrauch von Kindern so häufig gar nicht vorkommen könne. Da das Unbewusste ohnehin nicht zwischen Realität und Phantasie unterscheiden könne, sei es auch nicht wesentlich, ob der sexuelle Missbrauch tatsächlich stattgefunden habe oder nicht. Die Verführungstheorie wurde durch die bekanntere Triebtheorie ersetzt.
Triebtheorie
Die Triebtheorie: Freud blieb bei seiner Annahme, dass neurotische Symptome durch Verdrängungen von Regungen aus dem Sexualleben stammen. Diese seien jedoch nicht in realen Erlebnissen begründet, sondern in Wunschvorstellungen der Kinder. Dazu musste allerdings postuliert werden, dass der Sexualtrieb bereits bei Säuglingen ausgeprägt ist.
Triebe sind das, was die Psyche antreibt. Sie werden von Freud als psychische Energie verstanden, die in Handlungen verbraucht wird. Wenn eine bestimmte Menge an Energie vorhanden ist, bilden sich Triebspannungen. Die Sexualtrieb Psyche strebt danach, diese Spannungen zu lösen und drängt auf Triebabfuhr. Der wichtigste, alles dominierende Trieb ist in Freuds Sicht der Sexualtrieb, der sich nicht nur genital äußert. Seine Energie nannte er Libido (Später stellte Freud dem Sexualtrieb einen Todestrieb gegenüber.). Der Begriff der Sexualität wurde in diesem Konzept sehr ausgeweitet. Berühren, Beißen, Zeigen usw. können als sexuelle Betätigungen aufgefasst werden. Auch der Wunsch nach Nähe und Geborgenheit und die Bindung der Kinder an ihre Eltern ist nach Freud sexuellen Ursprungs.
Freud (1921, S. 85) formuliert dies selbst so: »Der Kern des Liebe geheißenen bildet natürlich die Geschlechtsliebe mit dem Ziel der geschlechtlichen Vereinigung. Aber wir trennen davon nicht ab, was auch sonst an dem Namen Liebe Anteil hat, einerseits Eltern- und Kindesliebe, die allgemeine Menschenliebe, auch nicht die Hingabe an konkrete Gegenstände oder abstrakte Ideen. Unsere Rechtfertigung liegt darin, dass die psychoanalytische Untersuchung uns gelehrt hat, alle Strebungen seien Ausdruck der nämlichen Triebregungen, die zwischen den Geschlechtern zur geschlechtlichen Einigung hindrängen.«
Entwicklung
Die psychosexuelle Entwicklung: Da praktisch alle Strebungen des Menschen sexuell determiniert sind, ist seine Entwicklung als psychosexuell beschreibbar. Der Sexualtrieb ist demnach von Anfang an vorhanden und führt zum Streben nach sexueller Lust. Diese ist allerdings für das Kind (noch) nicht im genitalen Bereich, sondern in anderen Körperregionen (erogene Zonen) zu erreichen. Die lustvollen Regionen wechseln im Laufe der kindlichen Entwicklung (Freud 1905 b).
Orale Phase
Zunächst bezieht das Kleinkind seine Lustgefühle für eine gewisse Zeitspanne aus der Mundregion. Freud nannte dies orale Phase. Sie dauert von der Geburt bis zum Alter von etwa 18 Monaten. Die libidinöse Befriedigung erfolgt durch Nahrungsaufnahme oder durch Saugen und Lutschen an Gegenständen.
Anale Phase
Im Laufe des zweiten Lebensjahres wechselt die erogene Zone. Nun steht die Schleimhaut des Afters im Vordergrund, die anale Phase beginnt. Die Kinder genießen das Koten. Auch Darmstörungen wie Durchfall oder Verstopfungen sorgen für intensive Erregung.
Phallische Phase
Die ersten beiden Phasen sind prägenital. Erst etwa im vierten Lebensjahr wird der Genitalbereich als erogene Zone bedeutsam; es beginnt die phallische Phase. Während dieser Phase spielt sich ein wahres Familiendrama ab: Der kleine Junge liebt seine Mutter und möchte seinen Penis irgendwie an ihr betätigen. Dem steht allerdings der Vater als Rivale entgegen, den er am liebsten aus dem Weg räumen möchte. Er ist eifersüchtig auf den Vater und hasst und liebt ihn zugleich. Nach Freud entwickelt der Junge einen Ödipuskomplex. Jedenfalls fürchtet der Junge die Strafe des Vaters, die darin Ödipuskomplex bestünde, dass er ihm den Penis abschneidet. Da Mädchen keinen Penis haben, sehen die Jungen, dass so etwas möglich sein kann. Ihre Kastrationsangst ist also höchst real. Aus dieser Angst heraus werden die ödipalen Wünsche aufgegeben. Der Junge identifiziert sich mit dem Vater und übernimmt dessen Normen, die sich als Über-Ich etablieren. Die Art und Weise, wie der Ödipuskomplex bewältigt wird, determiniert das spätere Seelenleben.
Das Mädchen liebt zunächst, ebenso wie der Junge, seine Mutter. Es muss jedoch bemerken, dass es keinen Penis hat. Die Mutter hat es verstümmelt geboren. In seiner Enttäuschung wendet es sich dem Vater zu und wünscht sich von ihm ein Kind als Penisersatz. Dieser Penisneid führt bei Mädchen und Frauen zu negativen Eigenschaften wie Neid oder Eifersucht und verursacht Minderwertigkeitsgefühle.
Latenzphase
An die phallische Phase schließt die ruhige Latenzphase an, die bis zur Pubertät andauert. Während dieser Zeit spielt Sexualität für das Leben und die Entwicklung des Kindes eine untergeordnete Rolle. Mit der Pubertät tritt der Jugendliche in die genitale Phase ein, die zur Aufnahme heterosexueller Genitale Phase Aktivitäten führt.
Die Phasen der psychosexuellen Entwicklung in einem Überblick:
| (1) orale Phase: | 1. und 2. Lebensjahr | |
| (2) anale Phase: | 2. und 3. Lebensjahr | |
| (3) phallische Phase: | 4. bis 6. Lebensjahr | |
| (4) Latenzphase: | 6. Lebensjahr bis Pubertät | |
| (5) genitale Phase: | ab der Pubertät |
Nach Freud entscheidet sich in den ersten fünf Lebensjahren die weitere psychische Entwicklung eines Menschen. In dieser Zeit sind die Ursachen von neurotischen Fehlentwicklungen eines Erwachsenen zu suchen.
Persönlichkeit
Das Instanzen-Modell der Persönlichkeit: Das Persönlichkeitsmodell Freuds ist durch die Aufteilung in drei unabhängige Instanzen, das Es, das Ich und das Über-Ich gekennzeichnet. Sie werden so beschrieben, als ob sie eigenständige Personen wären (Freud 1938).
Es
Das Es, das von Geburt an vorhanden ist, wird von Freud als Kessel brodelnder Erregungen beschrieben. Es ist ausschließlich darauf bedacht, alle Triebwünsche unmittelbar zu erfüllen. Dabei ist es unlogisch und unmoralisch. Es funktioniert nur nach dem Lustprinzip. Alles, was im Es vorgeht, ist vom Bewusstsein abgeschnitten; es ist unbewusst.
Ich
Die Erfüllung der Triebwünsche kann jedoch nur in Kontakt mit der Außenwelt geschehen. Um solche Interaktionen zu ermöglichen, spaltet sich nach und nach eine weitere Instanz ab: das Ich. Das Ich stellt die zur Befriedigung notwendige Beziehung zur Außenwelt her. Dazu muss es die Außenwelt wahrnehmen, im Gedächtnis speichern und denken. Das Ich vertritt das Realitätsprinzip, im Grunde aber nur, um die Triebwünsche des Es zu erfüllen. Das Ich reagiert dabei mit Besonnenheit und nimmt beispielsweise Triebaufschübe in Kauf, um nicht in Konflikt mit der Umwelt zu geraten.
Über-Ich
In der phallischen Phase werden die Gebote und Verbote, Normen und Wertvorstellungen des Vaters übernommen. Aus diesen übernommenen Normen bildet sich das Über-Ich. Dieses verurteilt alle Triebwünsche des Es, die den Normen widersprechen, und veranlasst das Ich mit Hilfe von Angst, solche Wünsche ins Es zurückzuschicken, zu verdrängen und sie damit wieder unbewusst zu machen.
Das Ich muss so zwischen beiden Instanzen (Es und Über-Ich) und zwischen diesen und der Umwelt vermitteln. »Das arme Ich dient zwei gestrengen Herren, es ist bemüht, deren Ansprüche und Forderungen in Einklang zu bringen. Diese Ansprüche gehen immer auseinander, scheinen oft unvereinbar zu sein; kein Wunder, dass das Ich so oft an seiner Aufgabe scheitert« (Freud 1933, S. 514).
Durch die Verdrängung der unerlaubten Triebwünsche wird psychische Energie verbraucht. Müssen wegen eines starken, strengen Über-Ichs viele Wünsche verdrängt werden, wird das Ich geschwächt oder bricht im Extremfall ganz zusammen.
Abwehrmechanismen
Die Abwehrmechanismen: Das Ich hat die Aufgabe, für eine optimale Triebbefriedigung zu sorgen. Wenn nun aus dem Es Impulse auftauchen, die dem Ich als zu gefährlich erscheinen, entsteht Angst. Wegen der Wirkung des Lustprinzips muss das unangenehme Angstgefühl so schnell wie möglich beendet werden. Die Es-Impulse müssen abgewehrt werden. Zu dieser Abwehr stehen dem Ich mehrere Strategien, die sogenannten Abwehrmechanismen, zur Verfügung.
Verdrängung
Die Verdrängung als Abwehrmechanismus wurde von Freud am frühesten beschrieben. Den Es-Impulsen wird der Zugang zum Bewusstsein versperrt. Sie bleiben ebenso unbewusst wie der Prozess der Verdrängung selbst. Mit einem hohen Maß an aufgewendeter psychischer Energie wird ein Zustand erreicht, als würden die Impulse nicht existieren.
Reaktionsbildung
Der Mechanismus der Reaktionsbildung vermindert die Angst vor bestimmten Triebwünschen dadurch, dass das Gegenteil (über-)betont wird. Eine Mutter beispielsweise lehnt ihr Kind ab und möchte es hassen. Dieser Impuls wird vom Ich nicht akzeptiert. Die Abwehr kann nun darin bestehen, dass das Kind mit Liebesbeweisen überschüttet wird. Das Ich verhält sich nach dem Motto: »Es stimmt doch gar nicht, dass ich mein Kind ablehne. Seht alle her, wie ich es liebe!« Bei übersteigerten Haltungen kann daher gefragt werden, ob sie nicht als Abwehr des gegenteiligen (inakzeptablen) Impulses dienen. Da die Reaktionsbildung unbewusst geschieht, darf sie nicht mit dem bewussten Verhalten der Heuchelei verwechselt werden.
Regression
Die Regression bedeutet die Abwehr von Es-Impulsen durch den Rückzug in frühere Entwicklungsphasen, in denen die Triebbefriedigung ungefährlich und akzeptabel erscheint. Rauchen und Trinken können so als eine Regression in die orale Phase, Pedanterie und das Betonen von Sauberkeit als eine Regression in die anale Phase interpretiert werden.
Sublimierung
Eine Sonderstellung in den Abwehrmechanismen nimmt die Sublimierung ein. Sie ist eine »normale« und gewünschte Abwehr von Triebimpulsen. Freud unterstellt, dass bei allen Kindern in der analen Phase der Wunsch besteht, mit dem Kot zu spielen. Dieser Wunsch wird in unserer Gesellschaft nicht toleriert und das Kind formt ihn um. Es backt Sandkuchen, malt mit Fingerfarben, spielt mit Knete und könnte schließlich anfangen zu töpfern. Auf diese Weise kann der inakzeptable Wunsch in eine akzeptable und wertvolle Tätigkeit umgewandet werden. Allgemein werden auf diese Weise sexuelle Wünsche in künstlerischen Aktivitäten befriedigt. Kunst wird so als »Ersatz« (Sublimierung) für Sexualität gesehen.
Bewertung
Die Bewertung von Freuds Theorie ist uneinheitlich und kontrovers. Handelt es sich dabei um »das vielleicht größte Ereignis der bisherigen Geschichte der Psychologie« (Flammer 2009, S. 74) oder um einen »Tiefenschwindel«, eine »Tollhauspsychologie« und einen »Jahrhundertirrtum« (Zimmer 1990)?
Mit seinen Denkansätzen hat Freud zweifellos neue Perspektiven eröffnet. Indem er Neurosen als Symptome psychischer Konflikte interpretierte, die Tragweite frühkindlicher Traumata offen legte und die Bedeutung der Sexualität betonte, schuf er veränderte Möglichkeiten, Entwicklungsprozesse und psychische Prozesse zu interpretieren. Diese neuen Perspektiven wurden vielfach aufgegriffen und in unterschiedlichen Richtungen weiterentwickelt. Betrachtet man Popularität und Anregungsgehalt als Maßstäbe für die Bedeutung einer Theorie, dann ist die psychoanalytische Theorie sicherlich sehr bedeutsam.
Kritik
Nach den Kriterien der gegenwärtigen empirischen Psychologie müssen gegen die Theorie Freuds einige kritische Einwände erhoben werden (in Anlehnung an Gerrig/Zimbardo 2008):
Wichtige (Teil-)Konzepte sind nur verschwommen definiert und lassen sich daher nicht empirisch prüfen.
Das Verhalten wird stets im nachhinein erklärt. Es wurden keine Vorhersagen getroffen, deren Richtigkeit geprüft werden könnte.
Die Datenbasis ist gering und bezieht sich auf »gestörte« Personen. Die Übertragbarkeit der theoretischen Aussagen auf »gesunde« Personen ist nicht belegt.
Die Betonung der frühkindlichen Ereignisse vernachlässigt die Bedeutung aktueller Bedingungen für das Verhalten.
Die Bedeutung einer Theorie ist jedoch nicht nur an ihrer Richtigkeit oder am Umfang ihrer Anwendungsmöglichkeiten zu bewerten, sondern auch an der Initiierung neuer Forschung. Freuds Ansätze waren in dieser Hinsicht äußerst fruchtbar. Seine Gedanken über die Bedeutung der frühen Kindheit wurden vielfach aufgegriffen und weiterentwickelt (z. B. Spitz 2005), manchmal dann auch im Widerspruch zu ihnen (z. B. Bowlby 2006).
Bild der Frau
Für das Bild der Frau in der Gesellschaft und für die Bewertung sexueller Übergriffe hatte Freuds Triebtheorie fatale Folgen. Sexueller Missbrauch, Ausgangspunkt seiner Theoriebildung, konnte im Lichte der Triebtheorie uminterpretiert werden. Nicht Väter (Männer) misshandeln die Kinder, sondern diese phantasieren Vergewaltigungen oder – wenn die Realität nicht geleugnet werden kann – lassen sich ihre geheimen Wünsche erfüllen. Die Opfer werden so zu Komplizinnen der Täter.
Im Bericht über den »Fall Dora« interpretierte Freud (1905 a) den Ekel, den ein vierzehnjähriges Mädchen empfand, als es von einem älteren Mann überrumpelt und gegen seinen Willen geküsst wurde, als hysterisches Symptom. Das Mädchen hätte, seiner Ansicht nach, angenehme sexuelle Empfindungen haben müssen. Das Leiden an sexuellen Übergriffen wird als krankhaft eingestuft. Damit wird eine Legitimation für sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Frauen geliefert.
Die Darstellung der Frau als Mängelwesen und die Zuschreibung negativer Eigenschaften boten eine vermeintlich wissenschaftliche Begründung für die Abwertung von Frauen. Allen, die ein Interesse an ihrer sexuellen Verfügbarkeit hatten und denen ihre Autonomiebestrebungen suspekt waren, mussten Freuds Theorien willkommen sein. Ihre Popularität kann auch unter diesem Aspekt bewertet werden.
3.2.3. Carl R. Rogers: Eine Theorie der Psychotherapie, Persönlichkeit und der zwischenmenschlichen Beziehungen
Als die entscheidende Triebfeder zur Entwicklung seines theoretischen Konzepts sieht Rogers selbst seine jahrzehntelange therapeutische Arbeit mit Menschen, die persönliche Hilfe brauchen. »Sie stellen für mich den wesentlichen Anreiz meiner psychologischen Überlegungen dar. Aus dieser Arbeit, aus meiner Beziehung zu diesen Menschen, habe ich beinahe all das Wissen bezogen, das ich über die Bedeutung von Therapie, die Dynamik der interpersonellen Beziehungen und der Struktur und Funktion der Persönlichkeit besitze« (Rogers 2009, S. 13).
Carl Rogers, geboren 1902 in einem Vorort von Chicago, wuchs in einer Familie auf, in der »harte Arbeit und ein sehr konservativer (fast fundamentalistischer) Protestantismus ... gleichermaßen geschätzt [wurden]« (Rogers 2009, S. 11). Als Carl zwölf Jahre alt war, zog seine Familie auf eine Farm. Er entwickelte ein starkes Interesse für Agrarwissenschaft, für die er sich später an der University of Wisconsin einschrieb. Später wechselte er zur Theologie, um Pfarrer zu werden, ein Berufsziel, das er zugunsten der Klinischen Psychologie aufgab. Zwölf Jahre lang arbeitete er an einer heilpädagogischen Beratungsstelle für Kinder in Rochester, New York. 1940 wurde er Professor an der Ohio State University. Seine weitere akademische Karriere führte ihn an die Universitäten von Chicago, Wisconsin und La Jolla, California. Er ist der Begründer der Klientzentrierten Psychotherapie. Während seiner Laufbahn hat er stets intensiv als Psychotherapeut gearbeitet. Carl Rogers starb 1987.
Da jede Intervention und Therapie (zumindest implizit) mit theoretischen Vorstellungen wenigstens über Psychotherapie speziell, über Personen allgemein und über Interaktionen getränkt ist, war es nur konsequent, dass diese Vorstellungen nach und nach expliziert wurden. Obwohl es sich um eine integrale Theorie über Therapie, Personen und Interaktionen handelt, wird in diesem Abschnitt nur die Facette »Theorie der Persönlichkeit« behandelt. Die Aspekte der Psychotherapie werden dagegen im Rahmen der klientenzentrierten Therapie ausführlicher dargestellt (7.4.).
Grundlegende Konstrukte: Organismus
Für Rogers Theorie der Persönlichkeit sind zwei Konstrukte und deren Beziehung zueinander grundlegend: Organismus und Selbst. Der Organismus ist der Ort allen Erlebens und aller Erfahrung. Dazu gehört alles, was im Körper vor sich geht, sofern es (wenigstens potentiell) bewusst wahrgenommen (»symbolisiert«) werden kann. Dies ist das Wahrnehmungsfeld, das nur die Person selbst wahrnimmt und von Außenstehenden niemals in gleicher Form wahrgenommen, allenfalls mehr oder weniger angenähert erschlossen werden kann. Das Wahrnehmungsfeld ist das individuelle Bezugssystem der Person; es ist die Realität für die Person. Auf diese Realität reagiert der Organismus als »organisiertes Ganzes«.
In einer »Fallgeschichte eines Konstruktes« schildert Rogers (1987, S. 26 – 29), wie sich das Selbst vom vagen wissenschaftlich bedeutungslosen zum zunehmend präziser definierten Begriff (Begriffssystem) wandelte. Unter Selbst Selbst, Selbstkonzept, Selbststruktur bzw. Selbstideal versteht Rogers (1987, S. 26):
»Diese Begriffe beziehen sich auf die organisierte, in sich geschlossene Gestalt. Diese beinhaltet die Wahrnehmungscharakteristiken des Ich, die Wahrnehmungen der Beziehungen zwischen dem Ich und anderen und verschiedenen Lebensaspekten, einschließlich der mit diesen Erfahrungen verbundenen Werte. Dieser Gestalt kann man gewahr werden, sie ist jedoch nicht notwendigerweise gewahr. Es handelt sich um eine fließende, eine wechselnde Gestalt, um einen Prozeß, der zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine spezifische Wesenheit ist, zumindest teilweise durch operationale Begriffe erfaßbar ...«
Selbstideal
»Selbstideal (oder Ideal-Selbst) bezeichnet das Selbstkonzept, das eine Person am liebsten besäße, worauf sie für sich selbst den höchsten Wert legt.«
Kongruenz
Die Beziehungen zwischen Organismus und Selbst sind durch Kongruenz bzw. Inkongruenz gekennzeichnet. Wenn die Erfahrungen, die das Selbst bilden, die tatsächlichen Erfahrungen des Organismus unverfälscht und unverzerrt abbilden, dann ist eine Person kongruent (oder reif, integriert, ausgeglichen, psychisch gesund). Inkongruenz liegt vor, wenn die Erfahrungen von Selbst und Organismus nicht übereinstimmen.
Ein populäres Beispiel ist der Junge, der wahrnimmt, dass es ihm Spaß macht, seine kleine Schwester zu ärgern. Wahrscheinlich haben seine Eltern dies aber verboten. Er wird sich vielleicht sagen, dass er ein braver Sohn ist, der seine Schwester nicht ärgert. Es besteht eine Inkongruenz zwischen Selbstkonzept (»Ich selbst bin ein braver Junge, der keinen Spaß darin findet, kleine Mädchen zu ärgern«) und der organismischen Erfahrung (»Es macht Spaß, kleine Mädchen zu ärgern«). Inkongruenz führt langfristig zu psychischer Fehlentwicklung der Person.
Aktualisierungstendenz
Die Entwicklungsdynamik der Person ergibt sich aus der Aktualisierungstendenz, d. h. der Tendenz des Organismus, sich zu entfalten und sich zu erhöhen. Als ein Beispiel für diese Tendenz kann das Bemühen des Kleinkindes interpretiert werden, unter Mühen und Anstrengung den aufrechten Gang zu lernen, obwohl das Krabbeln (zunächst) eine leichtere und effektivere Art der Fortbewegung darstellt.
Die Aktualisierungstendenz kann durch das Bedürfnis nach Zuwendung einerseits und/oder nach Schutz des Selbst andererseits beeinträchtigt werden. Wenn etwa eine Person versucht, so zu sein, wie man es von ihr erwartet, statt so zu sein wie sie selbst, dann tut sie das möglicherweise, um Zuwendung zu erhalten. Es entsteht eine entwicklungsbeeinträchtigende Inkongruenz. Personen haben auch das Motiv, ihr Selbst vor Veränderung oder Instabilität zu schützen. Erfahrungen, die mit dem Selbst nicht kongruent sind, werden als bedrohlich erlebt und dementsprechend abgewehrt (vermieden, verleugnet, verfälscht, usw.). Auch in diesem Fall entsteht eine entwicklungsschädigende Inkongruenz.
An dieser Stelle lässt sich der fließende Übergang zur Theorie der Psychotherapie beschreiben. In der Therapie muss es möglich sein, die Aktualisierungstendenz zu fördern, indem das Bedürfnis nach Zuwendung angemessen verwirklicht wird und inkongruente Erfahrungen nicht länger abgewehrt werden. Insgesamt geht es darum, Kongruenz herzustellen.
Die bereits zitierte Veröffentlichung (Rogers 1987) gilt als die authentische, grundlegende Darstellung der Theorie von Rogers selbst. Bereits vorher hatte er seine Theorie in Form von neunzehn Thesen beschrieben (Rogers 1973, S. 417 – 449).
| »I. | 19 Thesen Jedes Individuum existiert in einer ständig sich ändernden Welt der Erfahrung, deren Mittelpunkt es ist.« | |
| »II. | Der Organismus reagiert auf das Feld, wie es erfahren und wahrgenommen wird. Dieses Wahrnehmungsfeld ist für das Individuum ›Realität‹.« | |
| »III. | Der Organismus reagiert auf das Wahrnehmungsfeld als ein organisiertes Ganzes.« | |
| »IV. | Der Organismus hat eine grundlegende Tendenz, den Erfahrungen machenden Organismus zu aktualisieren, zu erhalten und zu erhöhen.« | |
| »V. | Verhalten ist grundsätzlich der zielgerichtete Versuch des Organismus, seine Bedürfnisse, wie sie in dem so wahrgenommenen Feld erfahren wurden, zu befriedigen.« | |
| »VI. | Dieses zielgerichtete Verhalten wird begleitet und im allgemeinen gefördert durch Emotion, eine Emotion, die in Beziehung steht zu dem Suchen aller vollziehenden Aspekte des Verhaltens, und die Intensität der Emotion steht in Beziehung zu der wahrgenommenen Bedeutung des Verhaltens für die Erhaltung und Erhöhung des Organismus.« | |
| »VII. | Der beste Ausgangspunkt zum Verständnis des Verhaltens ist das innere Bezugssystem des Individuums selbst.« | |
| »VIII. | Ein Teil des gesamten Wahrnehmungsfeldes entwickelt sich nach und nach zum Selbst.« | |
| »IX. | Als Resultat der Interaktion mit der Umgebung und insbesondere als Resultat wertbestimmender Interaktion mit anderen wird die Struktur des Selbst geformt – eine organisierte fließende, aber durchweg begriffliche Struktur von Wahrnehmungen von Charakteristika und Beziehungen des ›Selbst‹ zusammen mit den zu diesen Konzepten gehörenden Werten.« | |
| »X. | Die den Erfahrungen zugehörigen Werte und die Werte, die ein Teil der Selbst-Struktur sind, sind in manchen Fällen Werte, die vom Organismus direkt erfahren werden, und in anderen Fällen Werte, die von anderen introjiziert oder übernommen, aber in verzerrter Form wahrgenommen werden, so als wären sie direkt erfahren worden.« | |
| »XI. | Wenn Erfahrungen im Leben des Individuums auftreten, werden sie entweder a) symbolisiert wahrgenommen und in eine Beziehung zum Selbst organisiert, b) ignoriert, weil es keine wahrgenommene Beziehung zur Selbst-Struktur gibt, oder c) geleugnet oder verzerrt symbolisiert, weil die Erfahrung mit der Struktur des Selbst nicht übereinstimmt.« | |
| »XII. | Die vom Organismus angenommenen Verhaltensweisen sind meistens die, die mit dem Konzept vom Selbst übereinstimmen.« | |
| »XIII. | Verhalten kann in manchen Fällen durch organische Bedürfnisse und Erfahrungen verursacht werden, die nicht symbolisiert wurden. Solches Verhalten kann im Widerspruch zur Struktur des Selbst stehen, aber in diesen Fällen ist das Verhalten dem Individuum nicht ›zu eigen‹.« | |
| »XIV. | Psychische Fehlanpassung liegt vor, wenn der Organismus vor dem Bewußtsein wichtige Körper- und Sinnes-Erfahrungen leugnet, die demzufolge nicht symbolisiert und in Gestalt der Selbst-Struktur organisiert werden. Wenn diese Situation vorliegt, gibt es eine grundlegende oder potentielle psychische Spannung.« | |
| »XV. | Psychische Anpassung besteht, wenn das Selbst-Konzept dergestalt ist, daß alle Körper- und Sinnes-Erfahrungen des Organismus auf einer symbolischen Ebene in eine übereinstimmende Beziehung mit dem Konzept vom Selbst assimiliert werden oder assimiliert werden können.« | |
| »XVI. | Jede Erfahrung, die nicht mit der Organisation oder der Struktur des Selbst übereinstimmt, kann als Bedrohung wahrgenommen werden, und je häufiger diese Wahrnehmungen sind, desto starrer wird die Selbst-Struktur organisiert, um sich zu erhalten.« | |
| »XVII. | Unter bestimmten Bedingungen, zu denen in erster Linie ein völliges Fehlen jedweder Bedrohung für die Selbst-Struktur gehört, können Erfahrungen, die nicht mit ihr übereinstimmen, wahrgenommen und überprüft und die Struktur des Selbst revidiert werden, um derartige Erfahrungen zu assimilieren und einzuschließen.« | |
| »XVIII. | Wenn das Individuum all seine Körper- und Sinneserfahrungen wahr- und in ein konsistentes und integriertes System aufnimmt, dann hat es notwendigerweise mehr Verständnis für andere und verhält sich gegenüber anderen als Individuen akzeptierender.« | |
| »XIX. | Wenn das Individuum mehr von seinen organischen Erfahrungen in seiner Selbst-Struktur wahrnimmt und akzeptiert, merkt es, daß es sein gegenwärtiges Wert-System, das weitgehend auf verzerrt symbolisierten Introjektionen beruht, durch einen fortlaufenden, organismischen Wertungsprozeß ersetzt.« |
Bewertung
Die damit kurz skizzierte Persönlichkeitstheorie von Rogers erhält ihre volle Bedeutung nur in ihrer Verzahnung mit der Theorie zur Psychotherapie und der zwischenmenschlichen Beziehungen (Kap. 7.4.). Das von ihm entwickelte Konzeptder Therapie war bahnbrechend und beeinflusste nicht nur die zeitgenössische klinische Psychologie. Seine Denkweise hat in vielen Bereichen der Praxis von der Pädagogik bis hin zur Betriebspsychologie einen weiten Eingang gefunden. »Selbstverwirklichung« ist auch eines der Themen im alltäglichen Leben. Die von Rogers und Kolleginnen und Kollegen begründete und geförderte »humanistische Psychologie« ist eine der großen psychologischen Schulen der Gegenwart, deren Attraktivität sich auch an dem andauernden publizistischen Erfolg der hier zitierten Werke ablesen lässt (Rogers 2009, 2012).
3.2.4. Kenneth J. Gergen: Persönlichkeit als soziale Konstruktion
Die beiden bisher vorgestellten Persönlichkeitstheorien hatten – bei aller Unterschiedlichkeit – einen gemeinsamen Ausgangspunkt ihrer Überlegungen, nämlich, dass jeder Mensch eine ihm eigene, unverwechselbare, beständige, stabile Persönlichkeit besitzt. Der im Folgenden vorgestellte Ansatz unterscheidet sich von diesen und anderen Persönlichkeitstheorien radikal dadurch, dass er den Gegenstand solcher Theorien, die Idee von Persönlichkeit selbst, kritisch hinterfragt und in ganz anderer Weise als die bisher vorgestellten Theorien psychologisch ausdeutet.
Kenneth Gergen ist Professor für Psychologie am Swarthmore College in Pennsylvania, USA. Einer seiner Vorgänger dort war Kurt Lewin. Aus umfangreichen Forschungsarbeiten zur Selbstwahrnehmung in der Rogers-Tradition heraus entwickelte er eine zunehmend kritische Haltung dem Selbst-Konzept gegenüber. Durch zahlreiche Gastaufenthalte in Europa, u. a. in Marburg und Heidelberg, hat er europäische, philosophische Denkhaltungen in seine Arbeiten integriert. Er gilt als einer der führenden Vertreter konstruktivistischen Denkens in der Psychologie. Gergen ist Mitbegründer des Taos Institute, New Mexico, zur Förderung sozialkonstruktivistischen Denkens in der Praxis.
»Wer bin ich?«, »Wer bin ich im Kern meines Wesens?«, »Welches ist mein wahrer Charakter?«, »Was ist mein eigentliches Ich?«, »Wer bin ich im Grunde meiner Persönlichkeit?«, »Durch welche Persönlichkeitsmerkmale bin ich bestimmt?« – Bevor Gergen sich mit solchen Fragen auseinandersetzt, beschäftigt er sich zunächst mit den Rahmenbedingungen, unter denen das Nachdenken über Persönlichkeit aus seiner Perspektive Sinn macht. Zwei dieser Rahmenbedingungen sind ihm besonders wichtig:
Psychologische Beschreibungsvokabulare für Persönlichkeit
Soziokulturelle Rahmenbedingungen für Persönlichkeit
Traditionen:
Bei der Sichtung des psychologischen Beschreibungsvokabulars stellt Gergen zwei unterschiedliche Traditionen der Auffassung von Persönlichkeit fest – er nennt diese Traditionen die romantische und die modernistische.
romantisch
Die romantische Tradition bestimmte die Persönlichkeitspsychologie des frühen 19. Jahrhunderts. Persönlichkeit wurde als im tiefsten Inneren des Menschen versenkte, irrationale, geheimnisvolle Innenwelt betrachtet, zu der allenfalls »Seelenverwandte« Zugang gewinnen konnten. Das Vokabular, in dem in dieser Tradition über Persönlichkeit gesprochen wurde, enthielt Begriffe wie »Leidenschaft«, »Inspiration«, »Genie«, »Impuls«, »Kraft«, etc. Diese romantische Tradition findet sich v. a. in der Literatur des 19. Jahrhunderts, aber auch Freud mit seiner Theorie des Unbewussten gehört noch zu dieser romantischen Tradition.
modernistisch
In der modernistischen Tradition wird der Mensch als beobachtbares, durchschaubares, kalkulierbares, zuverlässiges, authentisches, beständiges Wesen betrachtet, das auf der Grundlage von psychologischen Regelhaftigkeiten und Gesetzen agiert. Gergen vergleicht diese Betrachtung mit der Auffassung einer Maschine. Deutlich wird diese Auffassung z. B. in der Lerntheorie, in der »Lerngesetze« formuliert werden; deutlich wird die Auffassung aber auch in der kognitiven Wende in der Psychologie (vgl. Kapitel 2.1.), in der der Mensch als »informationsverarbeitender Apparat« betrachtet wird. Das Vokabular, in dem der Mensch beschrieben wird, ist dem Vokabular der entwickeltsten Maschine, dem Computer, entlehnt. Die modernistische Auffassung reaktiviert Grundgedanken der Aufklärung, z. B. die große Bedeutung von Vernunft. Sie führt zu der optimistischen Haltung, dass es mit Hilfe wissenschaftlicher Beobachtung und Theoriebildung möglich sein könne, Menschen planmäßig nach vorgegebenen Kriterien (zu ihrem Besten) zu verändern, z. B. auszubilden, zu schulen, oder weiterzuentwickeln.
postmodern
Diesen beiden Traditionen stellt Gergen eine dritte Beschreibungsweise gegenüber; diese nennt er »postmodern«. In dieser Beschreibungsweise werden Zweifel formuliert, ob es überhaupt (noch) Sinn macht, von einer einheitlichen Persönlichkeit oder einer Person-wie-sie-wirklich-ist zu sprechen. Diese Zweifel werden aus einer ganzen Reihe von Quellen gespeist; zum einen aus einer zunehmenden Kritik am Anspruch der Objektivität wissenschaftlicher Aussagen, d. h. dem Anspruch, zu sagen, »wie es ist«, und zum anderen aus der Vielzahl unterschiedlicher Theorien über »die Persönlichkeit«. »Es gibt heute keine Stimme, der zugetraut wird, die ›wahre Person‹ aus dem Meer der Portraitierungen retten zu können« (Gergen 1996, S. 232). Die Zweifel an der Gültigkeit der Vorstellung einer einheitlichen Persönlichkeit werden aber auch aus einer Betrachtung der soziokulturellen Entwicklung unserer Gesellschaft genährt. Damit kommen wir zum zweiten Punkt von Gergens Betrachtung – der Analyse aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen.
Gesellschaftliche Entwicklung
Gergens These ist, dass die Vorstellung einer einheitlichen, echten, authentischen, beständigen, zeitlich konstanten Persönlichkeit eines Menschen heutzutage nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Diese Vorstellung wird von einem zivilisatorischen Prozess zerstört, den er »soziale Sättigung« nennt (Gergen 1996, S. 94 ff.). Soziale Sättigung bedeutet v. a. eine dramatische Erweiterung des Beziehungsspektrums des modernen Menschen. Traditionelle Gesellschaftsformen zeichneten sich durch Konstanz und Begrenztheit der Sozialbeziehungen aus – man kannte nur die Leute aus dem eigenen Dorf. Demgegenüber ist es dem modernen Menschen möglich, mit einer Vielzahl von Menschen in Kontakt zu treten und zu bleiben. Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Entwicklung haben die »Technologien der sozialen Sättigung« geleistet: moderne Verkehrssysteme (v. a. Flugzeug), Kommunikationstechnologien (Telefon, E-Mail, soziale Netzwerke) und Medien (Film, Fernsehen, Radio) und Computer. Die Technologie brachte »die Menschen in immer unmittelbarere Nähe zueinander, setzte sie einem immer größer werdenden Kreis anderer Menschen aus und förderte eine Spannbreite von Beziehungen, wie sie vorher niemals möglich gewesen wäre.« (Gergen 1996, S. 100). So ermöglichen es diese Technologien z. B., Beziehungen weiter zu führen, auch wenn man mittlerweile räumlich getrennt ist (z. B. in eine andere Stadt gezogen ist) und sie beschleunigen die Beziehungsentwicklung (z. B. von der Beziehungsqualität der Bekanntschaft zur intimen Beziehung).
Gergens These ist, dass das Vokabular unserer Selbstverständigung unter diesen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht mehr funktioniert. Dies Krisen der Selbstverständigung führt zu einer Vielzahl praktischer Krisen der Selbstverständigung, auf die Gergen aufmerksam macht. Beispiele sind:
man fühlt sich überfordert, all die Beziehungen, die man eingehen konnte, auch zu pflegen und zu wahren;
man entwickelt Schuldgefühle dem eigenen Selbst gegenüber, weil man laufend in bestimmten Rollen agiert, die mit der Selbstwahrnehmung in Konflikt stehen. Man empfindet, dass man dem eigenen Selbst gegenüber »untreu« wird;
man empfindet Unbehagen angesichts der Oberflächlichkeit, mit der man sich in Interaktion bewegt, man beklagt die fehlende Tiefe von Kontakten und Beziehungen;
man ist irritiert, weil die Vorstellung von Aufrichtigkeit, die für die traditionelle Selbstbeschreibung zentral ist, angesichts aktueller gesellschaftlicher Rahmenbedingungen nicht mehr gewahrt werden kann, weil Beziehungen zu Anderen immer auch aus strategischen Gründen oder zweckgerichteten Absichten geknüpft und aufrechterhalten werden;
man ist befremdet angesichts der Vermarktung von Persönlichkeiten, z. B. in Wahlkämpfen; und spürt die Ohnmacht, angesichts des öffentlichen Bildes eines Menschen seinen wahren Charakter zu erfassen.
Beziehungs-Selbst
Diese zunehmende Trennung von der Vorstellung eines stabilen Persönlichkeitskerns bzw. einer wahren Identität oder eines inneren Wesens macht den Weg frei für eine andere Auffassung des Selbst, eine Auffassung, in der man sich selbst als Ensemble der Sozialbeziehungen begreift, in die man involviert ist – das Selbst als Beziehungsgeflecht. Gergen spricht vom »Beziehungs-Selbst«. Während in den traditionellen Ansätzen das Primat stets auf dem Individuum lag und Sozialbeziehungen gleichsam als Komposition einzelner Individualitäten betrachtet wurden, dreht Gergen dieses Verhältnis um: Man ist jemand stets nur in Bezug auf jemanden anderes. »Wenn es nicht das individuelle ›Ich‹ ist, das Beziehungen schafft, sondern es Beziehungen sind, die das ›Ich‹-Gefühl schaffen, ist das ›Ich‹, das als gut oder schlecht usw. eingeschätzt wird, nicht mehr das Zentrum für Erfolg und Versagen. ›Ich‹ bin nur ein Ich durch die bestimmte Rolle, die ich in einer Beziehung spiele. Erfolge und Versagen, die Erweiterung des Potentials, Verantwortung usw. sind einfach Eigenschaften, die jedem Wesen zugewiesen sind, das einen bestimmten Platz in gewissen Beziehungsformen einnimmt« (Gergen 1996, S. 257).
Gergen betont, dass es töricht wäre, »zu behaupten, dass das Bewusstsein eines Beziehungs-Selbst in der westlichen Kultur weiträumig geteilt wird« (Gergen 1996, S. 257). Gleichwohl beobachtet er, dass sich in wichtigen gesellschaftlichen Bereichen eine solche Auffassung tendenziell durchsetzt: in der Geschäftswelt wird das Leitbild des autonomen, sich durchsetzenden Selfmade-man zunehmend durch die Vorstellung des interpersonellen Systems ersetzt; in der Psychotherapie konzentriert man sich bei der Behandlung von Klienten zunehmend auf das soziale Netzwerk, innerhalb dessen der Klient eine Rolle spielt (v. a. Familientherapie); in Filmen und in der Literatur tritt die Rolle des großen oder einsamen Helden zunehmend in den Hintergrund. Stattdessen werden Beziehungsgeflechte bzw. »Netze gegenseitiger Abhängigkeit« (Gergen 1996, S. 260) zum Thema gemacht.
Gergen zeigt an zwei Bereichen dessen, was wir gemeinhin zum Kernbereich unserer Individualität zählen, wie stark diese Bereiche durch die Beziehungsmuster, in denen wir leben, durchdrungen sind: individuelle Biographie und Gefühlswelt.
Biographie
Wir begreifen uns traditionell als mit einer persönlichen Geschichte ausgestattet (Biographie) und verstehen uns so, dass diese Geschichte mit all ihren Erinnerungen an Besonderheiten, Ereignisse, Empfindungen, mit Berufungen, Karriere und Schicksal unsere Individualität wesentlich ausmacht. Jeder Mensch – so sagt man – hat seine individuelle Geschichte. Aber man bildet sich seine Geschichte auf der Grundlage gesellschaftlich verbreiteter Erzählweisen, auf der Grundlage von Mustern wie (Miss-)Erfolgsgeschichte, Heldenepos, Tragödie, und die Inhalte unserer Biographie werden in Kommunikationsprozessen mit relevanten Anderen (Familie, Therapeut) entwickelt, formuliert, ausgehandelt, bestätigt oder verworfen.
Gefühlswelt
Wir begreifen uns traditionell (romantisch) am persönlichsten, privatesten und natürlichsten in unserer Gefühlswelt – aber was wir als natürliche Gefühle empfinden, ist geprägt von den gesellschaftlich vorgegebenen Emotionsmustern, mit denen wir Zustände physiologischer Erregung situativ angemessen deuten und etikettieren.
Individualität als Collage
Auf der Grundlage dieser Überlegungen nimmt für Gergen Individualität die Gestalt einer Collage an – eine Komposition unzusammenhängender, widersprüchlicher, konkurrierender, vorgefertigter Versatzstücke des kommunikativen Lebens eines Menschen. Gergen hebt drei Aspekte dieser Collage hervor (Gergen 1996, S. 289ff.):
Wir bestehen aus Fragmenten anderer Menschen, deren Auffassungen, Haltungen, Beurteilungskriterien, deren Gesten und Stimmen wir verinnerlicht haben.
Wir existieren als Teilnehmer in Sozialbeziehungen, d. h. wir begreifen uns als Teil solcher Beziehungen in Gestalt einer Rolle, die wir spielen möchten, wozu wir aber Mitspieler benötigen (»soziale Komplizenschaft«); diese Beziehungen sind aber aufgrund der sozialen Sättigung Teilbeziehungen, die voneinander abgegrenzt und in ihrer Geltung begrenzt sind; entsprechend bedürfen sie »nicht des vollen Selbstausdrucks«, sondern fordern uns nur in fragmentierter Weise.
Wir schlüpfen in Ersatzwesen, in Figuren und Rollen, die uns aus überlieferten Beziehungsmustern geläufig und vertraut sind und die wir gleichsam »nachspielen«. Film und Fernsehen sind unsere Hauptlieferanten, die uns Ersatzwesen zur Verfügung stellen.
Konsequenzen
Gergen ist sich bewusst, dass seine Auffassung Konsequenzen für das Selbstverständnis von Menschen haben kann, die beunruhigend und bedrohlich erscheinen. »An diesem Punkt der Analyse erscheinen die Alltagsverhältnisse der postmodernen Welt sehr problematisch. Tiefe Beziehungen sind am Aussterben, das Individuum ist wegen des Aufgebots an Teilbeziehungen gespalten, und man lebt sein Leben als eine Serie unzusammenhängender Posen. Da der konstruierte Charakter der Ersatzidentitäten immer offensichtlicher wird, verliert das Selbst sowohl für den Darsteller als auch für das Publikum seine Glaubwürdigkeit. Das Alltagsleben scheint sich in ein Spiel oberflächlicher Heuchelei zu verwandeln, in ein Scherzo der Trivialität« (Gergen 1996, S. 300 f.). Er entwickelt aus seinen Betrachtungen aber auch Konsequenzen, die ein anderes Bild zeichnen:
Wenn es keine objektiven Kriterien für die Gültigkeit einer Persönlichkeitstheorie gibt, empfiehlt sich eine Haltung der Toleranz den unterschiedlichsten Entwürfen gegenüber. So spricht nichts dagegen, auch traditionelle Persönlichkeitstheorien zu vertreten, wenn man sich nur über den kontingenten Charakter ihrer Geltung im Klaren ist.
Statt eine Theorie zu verteidigen bzw. ein Beschreibungsvokabular als verbindlich festzulegen, empfiehlt Gergen die Erweiterung des Beschreibungsvokabulars bzw. Neuerfindungen. »Es gibt wenig Grund, irgendeine Stimme zu unterdrücken. Vielmehr bestimmt man mit jedem neuen Vokabular oder jeder neuen Ausdrucksform die Welt auf unterschiedliche Weise und spürt in der einen Aspekte des Lebens, die in der anderen verborgen oder nicht vorhanden sind, wodurch in einer Modalität Beziehungskapazitäten eröffnet werden, die sonst verschlossen bleiben« (Gergen 1996, S. 389).
Wenn unser Selbstverständnis in so dramatischem Maße von den Sozialbeziehungen abhängt, erwächst daraus eine enorme Verantwortung des Anderen im Anteil an der Gestaltung der Beziehung.
Die Orientierung psychotherapeutischen Handelns verlagert sich von der Erforschung der inneren Quellen des Selbst zur Reflexion der Erzählungen und Metaphern, in denen man sein eigenes Leben beschreibt und versteht sowie zur Verbesserung des Verhandlungsgeschicks, mit dem man die Sozialbeziehungen, in denen man lebt, ausgestaltet.
Die Überlegungen Gergens stellen sehr grundlegende Vorstellungen über das autonome Individuum in Frage und skizzieren ein Bild des Menschen, das möglicherweise fremd erscheint. An dieser Stelle ist vielleicht der Hinweis auf andere Kulturen angebracht: in östlichen oder afrikanischen Kulturen z. B. ist die Vorstellung, dass der einzelne Mensch sich wesentlich als Teil einer größeren sozialen Einheit, z. B. der Familie oder der Firma, begreift, selbstverständlich. In diesen Kulturen ist die Vorstellung einer autonomen Individualität dagegen nur schwer verständlich.