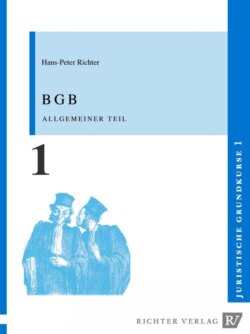Читать книгу Juristische Grundkurse 1 - BGB Allgemeiner Teil - Hans-Peter Richter - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kapitel – Methodik und Technik der Fallbearbeitung
ОглавлениеViele, vielleicht allzu viele Bücher sind bereits zu diesem Thema geschrieben worden. Das kann aber nicht darüber hinweg täuschen, dass es nicht möglich ist, dieses Anliegen abstrakt und in wohlgeformten Sätzen zu erfassen, geschweige denn zu erlernen. Daher soll hier auch nicht die juristische Methodenlehre, sondern es soll lediglich das unumgängliche „Handwerk der Fallbearbeitung“ vermittelt werden. Dazu bedarf es vor allem der Übung am Fall, d. h. es müssen immer wieder eigene Falllösungen erarbeitet werden. Nur aus den Fehlern und der Auseinandersetzung mit den dabei auftauchenden Problemen kann man sich nach und nach die Technik und Methodik erschließen und so zu einer sicheren Beherrschung jenes „Handwerks“ gelangen. Freilich bedarf es dazu der Grundkenntnis verschiedener elementarer und zu lernender Regeln. Deren wichtigste sollen nachfolgend dargestellt werden, doch auch an vielen anderen Stellen im Buch erfolgen weitere Hinweise zur Fallbearbeitungstechnik und Methodik.
Bevor man mit der schriftlichen Ausarbeitung einer Falllösung beginnt, sind zunächst einige Vorüberlegungen anzustellen.
1. Erfassen des Sachverhaltes
2. Ausdeuten (= Auslegen → Verstehen!) der Fallfrage
3. Aufsuchen der einschlägigen Anspruchsgrundlagen
1. Erfassen des Sachverhaltes
Der Sachverhalt ist gründlich durchzulesen, inhaltlich voll und richtig! zu begreifen, so dass man weiß, worum es geht und welche Personen beteiligt sind. Bei umfangreicheren Sachverhalten empfiehlt es sich, eine kleine Skizze anzufertigen.
Sollte der Sachverhalt durch Bearbeitungshinweise ergänzt sein, sind diese unbedingt zu beachten, denn oft wird dort der Prüfungsumfang (und damit der Aufgabenumfang) eingeschränkt, so kann dort insbesondere aufgeführt sein, dass einzelne Normen nicht zu erörtern sind usw.
2. Ausdeuten der Fallfrage
Am Ende des Sachverhaltes findet man üblicherweise die Fallfrage, die angibt, welche Aufgabe der Bearbeiter zu lösen hat.
Es kann sich dabei um eine eindeutige konkrete Frage handeln, - z.B.: Hat A Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises? - Es kann aber auch allgemein nach den Ansprüchen einer Person gefragt sein, z.B.: Ansprüche des A? - Schließlich kann auch gefragt sein: Wie ist die Rechtslage? Dann gilt es, Rechtsbeziehungen aller Beteiligten zueinander zu untersuchen. - Oft ist die Fallfrage in Beziehung zu dem vorangegangenen Text zu setzen, so auch hier, wo man ausformulieren könnte: erhebt E zu Recht den Anspruch auf Herausgabe?
TIPP: es kann sinnvoll sein, zuerst die Fallfrage und evtl. Bearbeitungshinweise und dann den Sachverhalt zu lesen, denn dann erfasst man den Sachverhalt schon im Hinblick auf die Aufgabenstellung.
Aus der Fallfrage entnimmt man vor allem, welches Anspruchsziel verfolgt wird. Dies ist wichtig für die dritte Vorüberlegung.
3. Aufsuchen der einschlägigen Anspruchsgrundlagen
Meist ist in einem Fall nach Ansprüchen von einer oder mehreren Personen gefragt. Für jeden, der Ansprüche gegen einen anderen hat (oder zu haben glaubt), muss irgendwo im Gesetz eine Vorschrift existieren, die abstrakt besagt, dass ein derartiger Anspruch besteht. Eine solche Norm ist damit die rechtliche Basis oder Grundlage für den Anspruch und wird daher als Anspruchsgrundlage bezeichnet. Es gilt daher, alle ernsthaft in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen aus dem Gesetz herauszusuchen. Dazu geht man wie folgt vor:
1. Schritt: feststellen, was vom Anspruchsteller begehrt wird – ergibt sich aus dem bereits herausgearbeiteten Anspruchsziel!
2. Schritt: suchen nach einer Norm, in deren Rechtsfolge dieses Begehren genannt, also erfüllt wird.
Dazu muss man die Norm in Voraussetzungen und Rechtsfolge zerlegen. Die Voraussetzungen beschreiben, was erfüllt sein muss, damit die beschriebene Folgerung gezogen werden kann – und diese muss dem Anspruchsziel inhaltlich gerecht werden!
Bsp.: Rechtsfolge des § 985 ist „Herausgabe der Sache“. Begehrt der Anspruchsteller also die Herausgabe einer Sache, entsprechen sich dieses Anspruchsziel und die Rechtsfolge der Norm. Folglich ist dies die zutreffende Anspruchsgrundlage.
Anspruchsgrundlagen in den Gesetzen zu finden, ist nicht immer einfach. Vom Wortlaut her erkennt man sie an Formulierungen wie: ..hat zu.. ..muss.. kann verlangen.. ..ist verpflichtet zu.. usw.- Gemeinsam ist all jenen Vorschriften, die als Anspruchsgrundlagen bezeichnet werden, dass sie (wie fast alle Normen) in zwei Teile zerlegbar sind: Rechtsfolge und Tatbestandsvoraussetzungen. Auf der Rechtsfolgeseite wird oft die eine Partei zu einem Verhalten verpflichtet, oder der anderen Partei wird das Recht gegeben, etwas zu verlangen. Man findet Anspruchsgrundlagen im Gesetz z. B. über das Schlagwortregister oder indem man in dem jeweiligen Sachbereich, z.B. Kaufrecht, Miete, Werkvertrag, nachschlägt.
Es gibt allein im BGB eine kaum überschaubare Vielzahl solcher Anspruchsgrundlagen, so dass es dem Anfänger meist Schwierigkeiten bereitet, festzustellen, wo sich die Vorschriften finden und ob eine Norm Anspruchsgrundlage ist. In diesem Buch werden einige wesentliche Anspruchsgrundlagen verschiedener Bereiche des BGB besprochen.
Hat man die Anspruchsgrundlage(n) gefunden, so sind diese an den Beginn der schriftlichen Prüfung zu stellen.
Da bei Ansprüchen regelmäßig mindestens zwei Personen beteiligt sind, hat man daneben auch das Anspruchsverhältnis zu nennen, denn nur so weiß der Leser, um wessen Belange es eigentlich geht.
Schließlich muss noch dargelegt werden, was die eine Partei von der anderen verlangt. Dies bezeichnet man als den Anspruchsinhalt oder Anspruchsgegenstand.
Damit ergibt sich der Einleitungssatz (auch Hypothese genannt), mit dem jede Prüfung im Zivilrecht beginnt. Er lässt sich als abstrakter Merksatz so festhalten:
Wer (Anspruchsteller) verlangt
von wem (Anspruchsgegner)
was (Anspruchsinhalt)
woraus (Anspruchsgrundlage)
Einführungsfall:
B ist im Besitz eines Autos, das dem E gehört. E verlangt die Herausgabe des Wagens von B. Zu Recht?
Nach den Vorüberlegungen kommt man zu § 985 als möglicher Anspruchsgrundlage. Der abstrakte Merksatz (oben) wird konkretisiert, also auf den Fall bezogen. Da dies alles jedoch nicht feststeht, sondern gerade erst untersucht werden soll, formuliert man konjunktivisch. Übertragen auf den obigen Fall sähe das so aus:
E (Wer) könnte gegen B (von wem) einen Anspruch auf Herausgabe (was) des Autos aus § 985 (woraus) haben
Daran schließt sich dann die Prüfung an, ob E auch tatsächlich einen solchen Anspruch hat, indem man die Voraussetzungen des § 985 durchprüft. Auch dies geschieht in einer im Grundsatz festumrissenen Methode. Dabei geht man in mehreren, voneinander trennbaren Schritten vor.
1. Schritt
Man zeigt zunächst auf, was erfüllt sein müsste, indem man das erste Tatbestandsmerkmal aufgreift. Tatbestandsmerkmale in diesem Sinne sind alle im Gesetz genannten Umstände, die den Tatbestandsvoraussetzungen zuzurechnen sind. Im vorliegenden Fall wären dies Sache, Besitzer, Eigentümer.
Es werden nun die Merkmale jedes für sich untersucht, also hier zunächst Sache. Sie formulieren daher: Dann müsste es sich bei dem Auto um eine Sache handeln.
2. Schritt
Sie haben nun zu untersuchen, ob das Auto eine Sache ist. Dazu ist zunächst einmal der zu untersuchende Begriff näher zu beschreiben, also zu definieren. Definitionen finden sich entweder im Gesetz oder man kann sie aus dem Gesetz folgern oder sie sind durch Rechtsprechung und Lehre entwickelt worden. Hier gibt es eine Definition in § 90, sie folgt also ausdrücklich aus dem Gesetz.
Man formuliert daher: Gem. § 90 sind Sachen alle körperlichen Gegenstände.
3. Schritt:
Nunmehr gilt es, das betreffende Stück des Sachverhaltes herauszuarbeiten, das man im Hinblick auf die Sacheigenschaft untersucht. Man schreibt dann den betreffenden Sachverhaltsteil in knapper, aber präziser Form nieder. Im vorliegenden Fall wäre dies die Tatsache, dass es sich um ein Auto handelt.
Man formuliert daher: Hier handelt es sich um ein Auto.
4. Schritt:
Nunmehr folgt die eigentlich wichtige, entscheidende und oftmals schwierige Aufgabe des Juristen, festzustellen, ob dieser konkrete Sachverhalt von dem abstrakten Begriff - Tatbestandsmerkmal - des Gesetzes erfasst, abgedeckt wird. An dieser Stelle liegt die Hauptarbeit des Juristen, gilt es doch Sachverhalt und Reichweite der Vorschrift zu ermitteln und zu argumentieren, warum man eine solche Deckungsgleichheit mit dem Sachverhalt bejaht oder verneint.
Man könnte hier also formulieren: Bei einem Auto handelt es sich um einen Gegenstand, den man anfassen kann, der Konturen und Umrisse aufweist, also all das, was man typischerweise unter einem körperlichen Gegenstand versteht. Damit ist das Auto ein körperlicher Gegenstand.
5. Schritt:
Nachdem man die Deckungsgleichheit zwischen Sachverhalt und Tatbestandsmerkmal festgestellt hat, gilt es, abschließend nur noch die im ersten Schritt aufgeworfene Frage zu beantworten: Folglich ist das Auto eine Sache.
Entsprechend sind dann die weiteren Tatbestandsmerkmale der Anspruchsgrundlage zu behandeln.
1. Schritt (bzgl. Besitzer): Man könnte formulieren:
Weiter müsste B Besitzer dieser Sache sein.
2. Schritt: Für den „Besitzer findet sich im Gesetz keine unmittelbare Definition. § 854 Abs.1 beschreibt jedoch, wie man den Besitz erlangt. Daraus kann man entnehmen, unter welchen Voraussetzungen eine Person Besitzer ist. Man kann daher formulieren:
Aus § 854 Abs.1 ergibt sich, dass Besitzer derjenige ist, der über eine Sache die tatsächliche Sachherrschaft ausübt.
3. Schritt: Das Auto befindet sich offenbar bei B.
4. Schritt: Daraus lässt sich folgern, dass eine Situation vorliegt, in der B vermutlich auch die tatsächliche Sachherrschaft ausübt.
5. Schritt: Folglich ist B Besitzer der Sache.
1. Schritt (bzgl. Eigentümer): Schließlich müsste E Eigentümer des Autos sein.
2. Schritt: Problematisch ist hier, eine Definition des Eigentümers zu finden. Falsch wäre es, auf § 903 abzustellen, da dieser lediglich beschreibt, welche Befugnisse jemand hat, bei dem man bereits festgestellt hat, dass er Eigentümer ist. Auch ein Umkehrschluss aus § 903 verbietet sich, da nicht jeder, der mit einer Sache nach Belieben verfahren kann, deshalb deren Eigentümer ist. Aus der Vielzahl der von Rechtsprechung und Lehre entwickelten Definitionen des Eigentümers könnte man zusammenfassend diesen als denjenigen beschreiben, dem von der Rechtsordnung die rechtliche Herrschaftsmacht über eine Sache zugewiesen ist. Mit dieser Definition ist freilich in der Falllösung nicht viel gewonnen. Es lässt sich kaum aus einem „Papiersachverhalt“ entnehmen, ob die Rechtsordnung nun gerade dieser Person die rechtliche Herrschaftsmacht zugewiesen hat. Eingebürgert hat sich daher für die Lösung von derartigen Schulfällen, dass das Eigentum „historisch“ geprüft wird. Man schaut dazu an den Beginn des Sachverhaltes und stellt fest, wer (vermutlich) ursprünglich Eigentümer der jeweiligen Sache war. Dies ist in der Regel derjenige, der zum Zeitpunkt des Sachverhaltsbeginnes im Besitz der Sache war (Argument aus § 1006!). Man hat in diesem Zusammenhang lediglich zu schauen, ob der Sachverhalt gegenteilige Hinweise gibt. Sodann prüft man den weiteren Verbleib des Eigentums, indem man fragt, ob der ursprüngliche Eigentümer evtl. sein Eigentum verloren hat. So verfolgt man, wo das Eigentum schließlich „gelandet ist“. Damit weiß man dann auch, wer zum Zeitpunkt der Falllösung Eigentümer ist.
Ein anderes Vorgehen hinsichtlich des Eigentums ist allerdings dann zulässig, wenn in einem Fall wie hier ausreichende Hinweise auf die Eigentumslage sich unmittelbar aus dem Sachverhalt ergeben. Dann kann man auf diese Darstellung im Sachverhalt zurückgreifen, sofern keine gegenteiligen Anhaltspunkte gegeben sind.
In jedem Falle zeigt sich, dass hier von dem oben aufgezeigten Subsumtionsschema abgewichen wird. Es fehlt praktisch völlig der Definitionsschritt!
Vielfach wird auch folgende Def. verwandt: Eigentümer ist, wer das Eigentum an der Sache erworben und nicht wieder verloren hat. Allerdings bedarf es auch hier der Unterstellung, wer zu Beginn des Sachverhaltes das Eigentum inne hatte. Vorteil: das Schema der Subsumtion mit Definitionsschritt wird eingehalten.
3. Schritt: Man könnte hier daher formulieren: Aus dem Sachverhalt ergibt sich, dass das Auto dem E gehört.
4. Schritt: Mangels anderer Angaben kann daraus entnommen werden, dass offensichtlich dem E das Eigentum am Fahrzeug zustand und immer noch zusteht.
5. Schritt: Damit ist E Eigentümer des Fahrzeugs.
Da nun alle drei Tatbestandsmerkmale geprüft und bejaht wurden, sind die Tatbestandsvoraussetzungen sämtlich erfüllt und damit kommt es zu der in § 985 angegebenen Rechtsfolge. Dieses Ergebnis hat man dann als Schlusssatz festzuhalten. Man formuliert daher:
Da alle Voraussetzungen des § 985 somit erfüllt sind, hat E gegen B einen Anspruch auf Herausgabe des Autos aus § 985.
Die vorstehend in fünf Schritten durchgeführte Arbeitsweise zur Falllösung bezeichnet man als Subsumtion.
Traditionell wird die Subsumtion in nur vier Schritten vorgenommen: Schritt drei und vier werden dabei zusammengefasst. In der Sache besteht daher also kein Unterschied zu dem vorstehenden Verfahren. Der Vorteil des zusätzlichen Schrittes liegt darin, dass der häufige Fehler, statt zu subsumieren nur den Sachverhalt wiederzugeben, so vermieden wird.
Abstrakt lässt sich die Subsumtion auch so darstellen:
1. Schritt: Aufwerfen und Darlegung der zu bearbeitenden Frage (meist ein Tatbestandsmerkmal der Anspruchsgrundlage)
2. Schritt: Definition des Merkmals
3. Schritt: Feststellung des Sachverhaltes
4. Schritt: Prüfung, ob Deckungsgleichheit zwischen Schritt 2 und 3 besteht (eigentliche Subsumtion).
5. Schritt: Aufzeigen des Ergebnisses, worin die Antwort auf die Frage des 1. Schrittes liegen muss.
Die ordentliche Subsumtion ist
einer der Grundpfeiler juristischer Arbeit
und muss unbedingt beherrscht werden
Nun kann dieses starre Schema in sehr klaren Fällen nicht nur umständlich, so ndern teilweise sogar etwas absurd wirken. Dennoch: es wird zunächst bei den Falllösungen an diesem Grundschema festgehalten. Im Fortgang des Kurses sind dann freilich von diesem Schema an eindeutigen Stellen, die keiner weiteren Erörterung bedürfen, mehr und mehr Abstriche zu machen, aus sprachlichen Gründen Schritte zusammenfassen usw. Kaum jemals entfallen kann jedoch der eigentliche Subsumtionsschritt.
Das Gutachten
Sie haben oben in der Lösung gesehen, dass man zunächst eine Frage aufwarf, die es dann zu diskutieren galt und schließlich war ein Ergebnis zu formulieren. Diese Arbeitsweise, die von der Frage ausgehend schließlich den Schluss auf ein Ergebnis erbringt, bezeichnet man als Gutachten. Arbeiten im Universitätsstudium sind stets als Gutachten anzufertigen!
Der Gegensatz zum Gutachten ist das Urteil. Dieses stellt das Ergebnis voran und begründet es anschließend - gedanklich quasi der umgekehrte Weg, verglichen mit dem Gutachten.
Der Gedankengang, der für ein Gutachten erforderlich ist, bedingt auch einen dieser Gedankenführung angepassten Stil, den sog. Gutachtenstil. Dieser trägt dem schließenden, fortentwickelnden Charakter des Gedankengangs Rechnung und bringt dies mit typischen Worten zum Ausdruck wie: also, demnach, somit, deshalb, daher, folglich, mithin usw.
Demgegenüber drücken denn, weil usw. begründenden Charakter aus und sind daher für den Urteilstil typisch. Grundsätzlich hat der Urteilstil in Universitätsarbeiten keinen Niederschlag zu finden. Ausnahmen gelten nur insoweit, als es sich um klare, eindeutige Feststellungen handelt, Probleme dürfen nie als Urteil verfasst werden. Insbesondere der Anfänger sollte sehr vorsichtig mit der Ansicht sein, es handele sich um eine klare eindeutige Feststellung. Es gilt: im Zweifel lieber kurz gutachtlich darstellen.
Die Anforderungen, die an die äußere Form von Arbeiten zu stellen sind, können Sie im Anhang nachlesen. Weitere technische Hinweise zur Fallbearbeitung finden sich an relevanter Stelle in den einzelnen Falllösungen.
Zur Übung lösen Sie, wie im Einführungsfall vorgeführt, nunmehr selbständig folgenden
Übungsfall:
K hat von V einen Kühlschrank gekauft. V hat das Gerät ausgeliefert. K will den Kühlschrank aber nicht bezahlen. Hat V Anspruch auf Bezahlung des Kühlschranks?
Lösungsvorschlag
V könnte gegen K einen Anspruch auf Bezahlung des Kühlschrankes aus § 433 Abs.2 haben.
Dann müsste ein Kaufvertrag wirksam zustande gekommen sein.
Das Merkmal Kaufvertrag findet sich so nicht in § 433 Abs.2, aber da die dort genannten „Käufer“und „Verkäufer“ die Beteiligten an einem Kaufvertrag beschreiben, kann man dies zusammen fassen und gleich den Kaufvertrag als Tatbestandsmerkmal prüfen!
K hat den Kühlschrank von V „gekauft“. Eine solche Beschreibung im Sachverhalt lässt den Schluss zu, dass damit ein Verhalten gemeint ist, das rechtlich den Abschluss eines Kaufvertrages erfüllt. Folglich ist ein Kaufvertrag wirksam zustande gekommen. Also hat V einen Anspruch auf Bezahlung des Kühlschrankes aus § 433 Abs.2
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Wiederholungsfragen
zum 2. Kapitel
8 Fragen
(Um die Antwort zur jeweiligen Frage zu erhalten, blättern Sie eine Seite vor.)