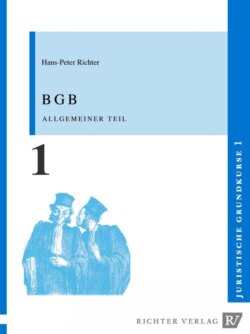Читать книгу Juristische Grundkurse 1 - BGB Allgemeiner Teil - Hans-Peter Richter - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Kapitel – Einführung, allgemeine Grundlagen und Grundbegriffe des BGB
ОглавлениеEinleitung
Warum dieses Buch?
Das Angebot an Lehr- und Lernbüchern und sog. Skripten ist inzwischen nahezu unüberschaubar. Wie sollen sich also Studierende orientieren, die einen Einstieg in das Sachenrecht suchen?
Während die Professoren überwiegend das klassische Lehrbuch empfehlen (am Liebsten natürlich das eigene!) und alle Arten von Skripten verteufeln, greifen Studierende zu Recht lieber zu leichterer und preiswerterer Kost. Diesem Bedürfnis der Studierenden nach einer knappen aber ausreichenden Darstellung trägt dieser Grundkurs BGB Allgemeiner Teil Rechnung. Es werden die wesentlichen Grundzüge des Allgemeinen Teils des BGB verständlich erläutert und an einfachen Fällen veranschaulicht. Durch Wiederholungsfragen wird schließlich eine Lernkontrolle ermöglicht.
So können Studierende wegen des überschaubaren Umfangs und der leicht nachvollziehbaren Art der Darstellung die wesentlichen Grundlagen des Stoffs in kurzer Zeit erarbeiten.
Um diesem Anliegen gerecht zu werden, wurde bewusst auf die Verarbeitung von Literatur und Rechtsprechung in Form von Zitaten weitgehend verzichtet und die sprachliche wie gedankliche Ausgestaltung sind ebenfalls diesem Zweck angepasst, um so ein möglichst unproblematisches Durcharbeiten zu gewährleisten.
Der Stoff wird nur soweit vertieft wie es nötig ist, so dass der „rote Faden“ zum ersten Verständnis erhalten bleibt. Dementsprechend werden Streitstände und abweichende Ansichten nur an unumgänglichen Stellen erwähnt (auch wenn dabei bewusst die sog. „Wissenschaftlichkeit“ des Werkes auf der Strecke bleibt!).
Dieses Buch will und kann das „klassische Lehrbuch“ oder eine gute Vorlesung nicht ersetzen sondern es soll diese Lehrangebote ergänzend vorbereiten.
Die Gebrauchsanweisung für dieses Buch
Das Buch enthält jeweils drei große Blöcke:
1. Stoffvermittlung
2. Fallbearbeitung
3. Wiederholung / Lernkontrolle
Die Stoffvermittlung enthält eine straffe Darstellung der wesentlichen Grundzüge des zu behandelnden Stoffes.
In der Fallbearbeitung wird die Anwendung dieses Stoffes auf einen einfachen Fall geübt.
Die Lernkontrolle / Wiederholung erfolgt anhand von Fragen zum vorangegangenen Stoff. Die stichwortartigen Antworten sollte man zunächst für eine ernsthafte Selbstkontrolle abdecken.
Zu Beginn sollte der Leser den jeweiligen Stoff gründlich erarbeiten, d.h. der Stoffteil muss gelesen, verstanden und gelernt werden! Sodann ist der Bearbeitungsfall selbständig zu lösen und anschließend mit der Musterlösung zu vergleichen. Am Ende des Kapitels sollen die Wiederholungsfragen unbedingt beantwortet werden.
Hat man auf diese Weise Kapitel für Kapitel durchgearbeitet, empfiehlt es sich, in einem zweiten Durchgang zunächst noch einmal die Fälle selbständig zu lösen. Auch die Wiederholungsfragen sollte man nochmals beantworten (aufschreiben, welche Fragen nicht gewusst wurden und im Stoffteil des Buches nacharbeiten!). Soweit Literaturangaben vorhanden sind, sollte der Leser diese vertiefende Literatur nunmehr durcharbeiten. Konnten die Wiederholungsfragen nicht beantwortet werden, sollten diese zum Schluss nochmals bearbeitet werden. Auf diese Weise ist ein optimaler Lerneffekt gewährleistet.
Die Arbeit der Studierenden
Regelmäßig beginnen Studierende das Studium an der Universität im Bereich des BGB mit der Erarbeitung des BGB, Allgemeiner Teil. Das ist nicht unproblematisch, weil gerade dies der abstrakteste Teil des BGB ist, denn die dortigen Regeln sollen eine möglichst große Vielzahl von Fällen erfassen, die den verschiedensten Bereichen zuzuordnen sind. Verständlich werden die Vorschriften des Allgemeinen Teils meist erst in Verbindung mit denen aus den anderen Büchern des BGB.
Das Lernziel besteht nun aber nicht nur aus der dogmatischen Erfassung und Durchdringung des dargelegten Stoffes „Recht“, sondern es sollte zumindest auch im Erlernen der Anwendung dieses Stoffes auf Fälle liegen. Ob in den Leistungsnachweisen während des Studiums, im Examen oder später in der Praxis, stets wird der Jurist mit einem Fall konfrontiert, den er zu bearbeiten und zu lösen hat.
Die Arbeit der Studierenden sollte daher zwei Bereiche umfassen: Erfassung des Stoffes und dessen Anwendung auf vorgegebene Fälle. Aus dieser Aufgabenstellung folgt auch der Aufbau dieses Skriptums.
Der vorliegende erste Band, BGB - Allgemeiner Teil, stellt einmal die elementaren Grundzüge des Allgemeinen Teils des BGB dar. Wenig relevantere Bereiche (z. B. Vereins-, Stiftungs- und Namensrecht usw.) bleiben stofflich weitgehend unbehandelt und sollten durch Lehrbücher zumindest im Überblick zu späterer Zeit im Eigenstudium erarbeitet werden. Der abstrakte Stoff wird sodann in Falllösungen und Beispielfällen angewendet. Dabei soll gezeigt werden, wann und wo die jeweilige Frage innerhalb eines Falles Bedeutung erlangt. Bei den Musterlösungen wird vor allem gezeigt, wie die Frage systematisch sauber in die Lösung einzuarbeiten ist. Daneben sollen die Falllösungen ganz allgemein die Technik und Methodik der Fallbearbeitung vermitteln.
Da der Stoff des Allgemeinen Teils des BGB sich isoliert kaum anhand von Fällen erläutern lässt, wird er zusammen mit den grundlegenden Normen des Schuldrechts und des Sachenrechts in den Falllösungen dargestellt. Dadurch ergibt sich neben einer eingehenden Behandlung des Allgemeinen Teils gleichzeitig die Vermittlung von Grundbegriffen des Schuldrechts und des Sachenrechts, so dass man insoweit auch von einem Grundkurs im BGB innerhalb dieses Skriptums sprechen kann.
Die Literaturhinweise dienen der Vertiefung des Stoffes oder der Erschließung von im Skriptum nicht dargestellten Bereichen.
Allgemeine Grundlagen
Kurzer Überblick über die Entstehungsgeschichte des BGB
Das BGB in seiner heutigen Form trat am 01.01.1900 in Kraft. Der Reichstag hatte es 1896 verabschiedet. Zur Schaffung des BGB kam es, weil durch die Reichsgründung 1871 die Basis für ein einheitliches Privatrecht geschaffen war. 1874 setzte man die erste Kommission zur Schaffung eines Entwurfes eines Bürgerlichen Gesetzbuches ein, die 1888 in den sog. Motiven ihre Arbeit darlegte.
Aufgrund der Kritik an diesem ersten Entwurf kam es 1890 zur Bildung einer zweiten Kommission. Die Ergebnisse dieser Kommission wurden dann später als Protokolle veröffentlicht. Der dritte Entwurf stellte lediglich noch die Umarbeitung des zweiten Entwurfs dar und verfolgte den Zweck, eine Reichstagsvorlage zu schaffen. Der Reichstag nahm dann auch noch einige kleine Änderungen vor.
Vorläufer des BGB waren diverse Landesgesetze, die mehr oder minder stark das Zivilrecht kodifiziert hatten. Bekanntestes Beispiel war wohl das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794. Aber auch Bayern, Rheinland, Baden und Sachsen verfügten über vollständige Kodifikationen des Zivilrechts.
Der Standort des BGB im Rechtssystem der Bundesrepublik
Das gesamte Recht zerfällt in zwei größere Bereiche: das Privatrecht und das öffentliche Recht. Aufgrund traditioneller Aufteilung wird das Strafrecht, eigentlich ein Teil des öffentlichen Rechts, stets so behandelt, als sei es eine dritte, selbständige Materie. Auf dieser Dreiteilung basiert auch die traditionelle Universitätsausbildung. Das in diesem Buch erörterte Bürgerliche Recht gehört zum Privatrecht. Dieses seinerseits zerfällt in das BGB (Allgemeines Privatrecht) und das Besondere Privatrecht. Die Regelungen im Besonderen Privatrecht haben fragmentarischen Charakter, d. h. sie treffen nur einige Sonderregeln für den jeweiligen Bereich, in dem sie Geltung erlangen sollen. Soweit in diesen Gesetzen eigenständige Normierungen fehlen, gilt sozusagen als „Lückenfüller“ das BGB. Dahinter verbirgt sich ein sehr wichtiger methodischer Grundsatz:
die speziellere Regelung
verdrängt die allgemeinere Regelung,
allerdings nur soweit der Regelungsbereich der spezielleren Norm reicht.
Die nachstehend im Überblick dargestellte Aufteilung hat auch praktische Relevanz, entscheidet doch die Einordnung bestimmter Fragen z. B. über die sachliche Zuständigkeit von Gerichten (Zivil-, Verwaltungs-, Straf- oder anderen Gerichten).
Die Systematik des BGB
Das BGB ist in fünf Bücher aufgeteilt:
Während im zweiten bis fünften Buch besondere Rechtsverhältnisse geregelt werden, weist der Allgemeine Teil solche Normen auf, die grundsätzlich für alle anderen Bücher (2. - 5.) des BGB gleichermaßen gelten. Der Gesetzgeber hätte die Vorschriften des Allgemeinen Teils auch jedem der Bücher selbst voranstellen können, hat aber das ökonomische Prinzip des „vor die Klammerziehens“ gewählt. Dahinter stand das Bestreben, das Gesetzeswerk möglichst knapp und klar zu halten und Wiederholungen zu vermeiden.
Freilich gibt es an den verschiedensten Stellen in den anderen Büchern Vorschriften, die die gleiche Materie wie entsprechende Paragraphen im Allgemeinen Teil regeln. Der Gesetzgeber war dort dann der Ansicht, dass für diesen speziellen Bereich eine vom Grundsatz des Allgemeinen Teils abweichende Regelung erforderlich sei. Mit der Schaffung einer außerhalb des Allgemeinen Teils liegenden Norm hat er insoweit dessen allgemeine Grundsätze verdrängt, denn die speziellere Norm verdrängt die allgemeinere.
Reformen des BGB
Leider blieb auch das BGB nicht von Reformen verschont. Grundlegend wurde schon vor längerer Zeit das Familienrecht reformiert, was zu jahrelangen Problemen in der Rechtsanwendung führte.
Zum 1.1.2002 kam die lange angekündigte Schuldrechtsreform. Dabei nahm man einige notwendige Ergänzungen zum Anlass, das Schuldrecht insgesamt neu zu gestalten. Die Neuregelungen sind für moderne Gesetzgebungstechnik gut gelungen (wenn man es z.B. mit den traurigen Gesetzgebungsversuchen im Steuerrecht vergleicht). Das neue Schuldrecht ist sehr systematisch, arbeitet jedoch mit einer Vielzahl von Verweisungen, was das erstmalige Verständnis nicht eben erleichtert. Aber: hat man die Systematik erst einmal verstanden, ist alles wegen des logischen Aufbaus sehr einfach zu beherrschen!
Grundbegriffe im BGB
Personen
Man unterscheidet im BGB zwischen natürlichen und juristischen Personen.
Natürliche Person ist jeder lebende Mensch
Die natürlichen Personen sind in §§ 1 - 12 geregelt
Wesentliches Element einer natürlichen Person ist, dass sie mit Vollendung der Geburt gem. § 1 Rechtsfähigkeit erlangt. Diese Rechtsfähigkeit und damit die Existenz der natürlichen Person endet mit dem Tod.
Die juristische Person ist ein Gebilde mit eigener Rechtspersönlichkeit und eigener Rechtsfähigkeit. Nicht die an ihr beteiligten oder zusammengeschlossenen Personen sind Träger der Rechte und Pflichten, sondern die juristische Person selbst.
Während es der natürlichen Person eigen ist, handlungsfähig zu sein, kann die juristische Person selbst nicht handeln. Vielmehr muss sie durch ihre Organe handeln.
Man unterscheidet zwischen juristischen Personen des privaten und des öffentlichen Rechts.
Zu den juristischen Personen des öffentlichen Rechts gehören Körperschaften, Anstalten und Stiftungen. Näheres dazu im öffentlichen Recht.
Zu den juristischen Personen des privaten Rechts zählen ebenfalls Körperschaften und Stiftungen. Körperschaften sind u.a. der Verein, die AG, die GmbH, die Genossenschaft.
Der Verein ist in §§ 21 ff geregelt. Er ist quasi die Grundform aller juristischen Personen. Beim sogenannten Idealverein, § 21, tritt Rechtsfähigkeit mit Eintragung ins Vereinsregister ein. Dagegen erlangt der wirtschaftliche Verein, § 22, Rechtsfähigkeit mit Verleihung.
Die Aktiengesellschaft (AG) ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Gesellschafter durch Einlagen am Grundkapital der Gesellschaft, das in Aktien aufgeteilt wurde, beteiligt sind. Die Gesellschafter haften nicht persönlich für Verbindlichkeiten der Gesellschaft, sondern nur im Rahmen ihrer durch Aktienerwerb geleisteten Anteile.
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist ebenfalls eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Gesellschafter mit einem ihrer Stammeinlage entsprechenden Gesellschaftsanteil am Stammkapital beteiligt sind. Auch sie haften den Gläubigern der Gesellschaft grundsätzlich nicht persönlich.
Bei der Genossenschaft (eG) handelt es sich ebenfalls um eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, die dazu dient, die Einzelwirtschaften ihrer Mitglieder zu fördern.
Stiftungen sind in §§ 80 ff geregelt und werden durch ein sogenanntes Zweckvermögen geprägt. Dieses muss zur Erreichung eines dauernden Zweckes eingesetzt werden und zu diesem Zweck muss die Einrichtung errichtet worden sein. Es gibt gemeinnützige Stiftungen und Familienstiftungen.
Zu unterscheiden von den juristischen Personen sind die verschiedenen Arten nicht rechtsfähiger Personenvereinigungen.
Hierzu zählen Personengesellschaften, nicht rechtsfähiger Verein, Erbengemeinschaft usw. Bei den Personengesellschaften haben besondere Bedeutung die Offene Handelsgesellschaft (OHG), vgl. §§ 105 ff HGB, die Kommanditgesellschaft (KG), vgl. §§ 161 ff HGB und die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), vgl. §§ 705 ff. Der nicht rechtsfähige Verein, z.B. Gewerkschaften, ist in § 54 geregelt.
Näheres zu Personen - und Kapitalgesellschaften im Band 24, Gesellschaftsrecht.
Die Rechtsfähigkeit
Die Rechtsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit einer Person, Träger von Rechten und Pflichten zu sein
Sie beginnt für natürliche Personen grundsätzlich gem. § 1 mit Vollendung der Geburt und endet mit dem Tod. Nur ausnahmsweise kann in bestimmter Hinsicht Rechtsfähigkeit bereits vor Vollendung der Geburt eintreten, z. B. im Hinblick auf das Erbrecht nach § 1923.
Die Handlungsfähigkeit
Die Handlungsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit, Rechte wirksam zu begründen, sie aufzuheben oder zu ändern. Man unterscheidet insoweit zwischen Geschäftsfähigkeit einerseits und Deliktsfähigkeit andererseits. Während die Geschäftsfähigkeit die Fähigkeit beschreibt Rechtsgeschäfte abzuschließen, vgl. dazu unten Kapitel 4, beschreibt die Deliktsfähigkeit die Fähigkeit, im Rahmen der §§ 823 ff zivilrechtlich für einen Schaden zur Verantwortung gezogen zu werden, siehe dazu Band 4, Schuldrecht BT 1.
Beachten Sie:
Hiervon ist die Strafmündigkeit des StGB, die stets mit dem vollendeten 14. Lebensjahr beginnt, zu unterscheiden!
Sachen und Tiere
Der Begriff der Sachen hat in §§ 90 ff eine Regelung erfahren. § 90 regelt hierzu:
Sachen sind alle körperlichen Gegenstände
Das Gesetz unterscheidet zwischen vertretbaren und nicht vertretbaren Sachen.
Vertretbare Sachen sind nach § 91 solche, die nach Maß, Zahl oder Gewicht üblicherweise bestimmt werden. Daher fallen hierunter Geld, alle gleichförmigen Massenartikel, Serienprodukte usw.
Im Übrigen finden sich in den §§ 92 ff noch weitere Begriffsbestimmungen für den Bereich der Sachen, so unter anderen: wesentliche Bestandteile (§§ 93, 94), Scheinbestandteile (§ 95), Zubehör (§ 97), Früchte (§ 99), Nutzungen (§ 100), die jedoch vorwiegend im Sachenrecht Bedeutung erlangen und daher auch dort näher besprochen werden.
Siehe dazu näher: RÜTHERS-Stadler, BGB Allg. Teil, § 11, Rn. 11 ff; RICHTER, JURISTISCHE GRUNDKURSE, Band 6, Sachenrecht 1.
Für Tiere gilt § 90a. Sie gelten zwar nicht als Sachen, aber die Vorschriften über Sachen sind auf sie grundsätzlich entsprechend anwendbar, sofern dem keine spezielleren Vorschriften entgegenstehen, wie z.B. Vorschriften aus Tierschutzgesetzen.
Wiederholungsfragen
zum 1. Kapitel
7 Fragen
(Um die Antwort zur jeweiligen Frage zu erhalten, blättern Sie eine Seite vor.)