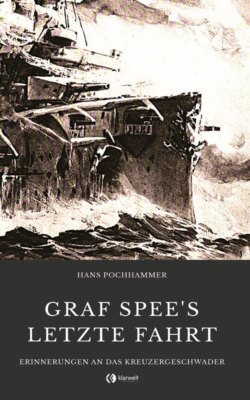Читать книгу Graf Spee's letzte Fahrt - Hans Pochhammer - Страница 4
I. In Tsingtau
ОглавлениеDer Ablösungsdampfer. Mannschaftswechsel. Übungen. Besuch des englischen Panzerkreuzers „Minotaur“. Unsere Kolonie Tsingtau. Das Kreuzergeschwader von 1914. Die Südseereise.
Ende Mai, Anfang Juni des Jahres 1914 prangte unsere ferne Siedelung Tsingtau im frischen Grün des kommenden Sommers. Der blaue, fast wolkenlose Himmel, die klare, durchsichtige Luft ließen sich die lieblichen Hügel mit den rotgedeckten Häusern, die scharfen Zacken der chinesischen Gebirge, die Bucht und das Meer zu einer herrlichen Landschaft zusammenschließen. Auf den Dampfern im Hafen rasselten die Winden unaufhörlich Tag und Nacht. Waren kamen und gingen, Chinesenkarren quietschten hochbeladen auf dem Wege zur Stadt, ringsum herrschte lautes geschäftiges Treiben.
Auch auf den Schiffen des Ostasiatischen Kreuzergeschwaders, denen Tsingtau als Stützpunkt diente, wurde lebhaft gearbeitet; denn der jährlich sich wiederholende Wechsel der halben Besatzungen stand unmittelbar bevor. Wo man hinsah, wurden Koffer gepackt, Kisten verlötet und zugenagelt, Bündel geschnürt; überall wurde Abschied gefeiert. Ehe die Heimkehrenden von Bord gingen, wurden sie ermahnt, auch weiterhin ihrem alten Schiffe Ehre zu machen. Sie mussten noch für einige Tage in Baracken an Land untergebracht werden, damit die Wohnräume für die Nachfolger instand gesetzt werden konnten. Dann kam der große Tag, der dem Leben da draußen immer einen Ruck vorwärts gab: Am 2. Juni lief der Ablösungsdampfer ein, diesmal die „Patricia“, mit etwa 1600 Köpfen an Bord. Von allen Seiten mit Hurra begrüßt, machte sie im Hafen fest. Nach wenigen Stunden stand die für „Gneisenau“ bestimmte Mannschaft mit ihren Kleidersäcken auf der Kohlenmole vor dem Schiffe angetreten, das ihr nun für zwei Jahre Heimat und Vaterhaus sein sollte; sah neugierig an dem grauen Rumpfe entlang und empor zu beiden Masten und den vier Schornsteinen, die aus solcher Nähe groß genug erscheinen mochten. Die Namen wurden aufgerufen, und jeder Mann erhielt eine kleine Papptafel ausgehändigt, auf der seine Schiffsnummer, sein Platz im Gefecht, im Boot, bei Reinschiff und allen Manövern verzeichnet war, wie auch die Division, zu der er jetzt gehörte. Die Vorgesetzten nahmen die ihnen zugewiesenen Leute in Empfang, ließen das mitgebrachte Eigentum in den Spinden verstauen, vorn in den Wohndecks der Mannschaft, und zeigten den Ankömmlingen, wo abends die Hängematten aufzuhängen seien, wo man das Essen holte, an welcher Back, welchem Tisch man es einnähme, und sorgten dafür, dass sie sich in der fremdartigen Umgebung bald heimisch fühlten. Die aus Deutschland eingetroffenen Offiziere und Deckoffiziere fanden sich schnell in ihrem Wirkungskreis zurecht, und der neue Kommandant S. M. S. „Gneisenau“, Kapitän z. See Maerker, übernahm von seinem Vorgänger, Kapitän z. See Brüninghaus, die Führung des Schiffes.
Endlose Mengen von Kisten und Ballen wurden in den nächsten Tagen zu uns cm Bord geschleppt, denn auch Vorräte für das vor uns liegende Übungsjahr waren herausgeschickt worden. Am Morgen des 9. Juni waren die Lösch- und Ladearbeiten beendet, und die abgelösten Offiziere und Mannschaften wurden auf der „Patricia“ eingeschifft. Als die Zeit der Abfahrt nahte, säumten sie die dem Lande zu liegende Steuerbordseite des Dampfers, standen dichtgedrängt auf den Promenadendecks und den, Bootsdeck und füllten die Wanten bis hoch zur Saling hinauf, während sich unten auf der Mole die Menge von den Schiffen und aus der Kolonie sammelte, um Kameraden und Freunden noch ein „Lebewohl!“ zuzurufen. Lange Heimatwimpel wehten von den Masten, ein jeder in blauer Schrift den Namen des Schiffes tragend, dessen nun scheidender Besatzungsteil ihn sich gefertigt hatte. Musik spielte hüben wie drüben und gab der fröhlich-ernsten Scheidestunde Wucht und Heimatstimmung. Um elf Uhr vormittags wurden an Bord die Leinen losgeworfen. Die Schlepper zogen an. Drei tiefe Töne des Dampfheulers forderten freie Bahn für die Ausfahrt. Während das riesige Schiff sich rückwärts langsam in Bewegung setzte, um weiterhin im geräumigen Hafen zu drehen, wechselten Heimkehrende und Zurückbleibende, die Mützen schwenkend, brausende Hurras, und „Holdrio, jetzt geht's zur Heimat!“, das unvermeidliche Abschiedslied der letzten Wochen, erklang noch einmal zwischen Schiff und Land, zum letzten Mal für ein Jahr — bis auch die anderen drankämen zur Fahrt ins Vaterland. —
Es galt nun, die neue Mannschaft mit der alten möglichst schnell zu verschmelzen, so dass die Bedienung des Schiffes in allen Teilen sichergestellt war. Zunächst mussten die Leute die „Gneisenau“ genauer kennenlernen. Dass unser Panzerkreuzer, wie sein Schwesterschiff, die „Scharnhorst“, 11 600 t Wasser verdrängte, 144 m lang und fast 22 m breit war, und dass er 7/5 m tief ging, hatten sie schon auf dem Ablösungsdampfer erfahren, denn die lange Ausreise war mit Unterricht nützlich ausgefüllt worden. Auch die Bewaffnung wussten sie anzugeben: Die schwere Artillerie bestand aus acht 21-cm Geschützen, von denen vier in je einem Doppelturm vorn auf der Back und hinten auf der Schanze, und vier in Einzelkasematten auf dem Oberdeck im mittleren Teil des Schiffes aufgestellt waren. Hier standen auch in ebensolchen Kasematten, aber eine Treppe tiefer, auf dem Batteriedeck, die sechs 15-cm Geschütze der Mittelartillerie. Alle diese waren, wie auch die Wasserlinie, durch starken Stahlpanzer geschützt. Die leichte Artillerie dagegen, achtzehn 8,8-cm-Geschütze, fand sich über das ganze Schiff verteilt, von dem Wohnraum der seemännischen Unteroffiziere im Vorschiff über die Kommandobrücke und das Aufbaudeck bis hinten zur Kommandantenkajüte. Vier Torpedorohre, je eins im Bug, auf jeder Breitseite und im Heck, vervollständigten unsere Waffen, und drei Schiffsmaschinen, die aus achtzehn, in fünf Heizräumen aufgestellten Kesseln ihren Dampf bekamen, konnten den Schiffen eine Geschwindigkeit von fast 23 Seemeilen in der Stunde geben.
Um Zweck und Lage der Räume und ihrer Einrichtungen nun auch durch den Augenschein zu erfassen? wurden die neuen Leute täglich in Gruppen durch das Schiff geführt und nach allen Richtungen in ihren neuen Pflichten unterwiesen. Dann folgten Übungen im Feuerlösch- und Verschlussdienst, auf den Gefechtsstationen, in den Booten. Nebenher gingen Instandsetzungsarbeiten am Schiffskörper und den Maschinen, Die neuen Vorräte wurden in Lasten und Hellegatts verstaut oder, soweit man sie erst später brauchen wollte, in Lagerschuppen an Land: der Platz ist ja an Bord ein bisschen beschränkt. Sobald wie möglich gingen die Schiffe zu kleineren Fahrten in See. Torpedo- und Artillerieschießübungen, Bootsmanöver, Rollenexerzieren, Landungsdienst wechselten ab, und in anregendem Eifer spielten Vorgesetzte und Untergebene sich schnell miteinander ein.
Mitten in diese erste Ausbildungszeit fiel der Besuch des englischen Panzerkreuzers „Minotaur“, mit dem Geschwaderchef Vizeadmiral Jerram an Bord. Was der gerade jetzt bei uns wollte, wo er eigentlich wissen konnte, dass es uns schlecht passte, so kurz nach dem Mannschaftswechsel, haben wir damals viel besprochen. Und im Lichte späterer Ereignisse glaube ich: wir gingen nicht fehl in der Annahme, dass er sich unsere Kriegsbereitschaft zu dieser Zeit ein bisschen ansehen wollte. Aber es war ja alles so friedlich in der Welt! Ein englisches Geschwader lag zu Besuch in Kiel, und dort wie hier freute man sich wohl, die Berufsgenossen begrüßen zu können, hatten wir doch alle in englischen Häfen viel Gastfreundschaft genossen. Im Sommer 1905 hatte ich mit dem Torpedoboot „D 6“ die Kaiserliche Jacht „Meteor“ nach Southampton gebracht, einige Tage dort gelegen und auch dem Einlaufen der französischen Verbrüderungsflotte zugesehen. Ein englischer Seeoffizier, den ich damals kennenlernte und dem diese plötzliche Freundschaft mit dem Erbfeinde nicht recht gefallen wollte, meinte halb scherzend, man sollte doch die Verständigung der Völker einmal ganz uns Seeleuten überlassen. Von jeder Nation sechs Schiffe, die sich zusammen in eine stille Bucht legten, die würden die strittigen Fragen schon regeln, so dass alle Teile dauernd zufrieden sein könnten. Ganz unrecht hatte er vielleicht nicht, denn das gemeinsame Element schafft zwischen Seefahrern ein Band, das nicht nur bei schönem Wetter hält, und Hilfe in Bedrängnis und Gefahr bis zum Einsatz des eigenen Lebens ist keine Seltenheit auf dem Wasser, gleichgültig, welche Landesflagge über dem Notsignal weht. Und wo Seestreitkräfte verschiedener Nationen gegen gemeinsame Widersacher zusammenwirken mussten, ist schnelle Verständigung über das Wo? und Wie? wohl die Regel gewesen. Gerade die beiden Ostasiatischen Geschwader, das englische und das deutsche, haben das wiederholt bewiesen, am schlagendsten in der Seymour-Expedition 1900 gegen Peking. So bestanden auch zu meiner Zeit freundschaftliche Beziehungen zwischen beiden. Waren wir nahe beieinander, so beglückwünschten wir uns durch Funkspruch zum neuen Jahr. Die deutschen Kanonenboote und Kleinen Kreuzer lagen viel mit englischen Schiffen zusammen, und die Großen Kreuzer pflegten nicht nach dem Süden zu gehen, ohne in Hongkong vorzusprechen, dem starken britischen Stützpunkte in China. Was wir daher auch über den jetzigen Besuch der „Minotaur“ denken mochten, es war klar, dass sie gut aufgenommen werden musste. Deshalb befahl unser Geschwaderchef, Vizeadmiral Graf von Spee, „Scharnhorst“ und „Gneisenau“ sollten zum Empfang an der Hafenmole liegen, wo für das englische Flaggschiff ein Platz freigehalten wurde. Am 12. Juni um 10 Uhr vormittags lief die „Minotaur“ ein.
Was man solchem Gaste an Hilfe anbieten konnte, war bereitgestellt worden: Boote zum Ausfahren der Leinen, Leute an Land, um sie festzumachen. Der Hafenmeister hatte sogar eine neue Flagge ausgegeben, die ein bezopfter Träger an der Stelle der Mole hochhalten musste, wo die Kommandobrücke des Schiffes liegen sollte. Die „Minotaur“ sah aus, wie eben ein Kriegsschiff aussehen muss, das in einen fremden Hafen kommt, schmuck- und tadellos. Nach der üblichen Begrüßung durch den Komplimentieroffizier tauschten die Admirale und Kommandanten und der Gouverneur der Kolonie Besuche aus; auch die Offizier-, Fähnrich- und Deckoffiziermessen sagten sich „Guten Tag“.
Für den ersten Abend hatte der deutsche Admiral zum Essen auf sein Flaggschiff, die „Scharnhorst", geladen. Im Anschluss daran sollte bei uns auf der „Gneisenau“ ein Bordfest stattfinden, zu dem auch die Bekannten von Land erwartet wurden; bot sich doch heute eine willkommene Gelegenheit, für die vielen Freundlichkeiten uns dankbar zu zeigen, die wir in der Kolonie genossen. Die Schanze, der Hauptfestplatz für solche Fälle, wurde mit Sand und Steinen gescheuert, denn Seemannsaugen sind scharf und kritisch. Bald prangte sie im bunten Schmuck von Flaggen und frischem Grün, und elektrische Lampen zogen sich am Geländer und unter dem Sonnensegel hin. Abends wird es auch im Sommer empfindlich kühl in Tsingtau, deshalb ließen wir an den Seiten die Segeltuchgardinen herunter, wodurch die Schanze den Eindruck eines großen Saales erhielt. In der hübsch und wohnlich eingerichteten Offiziermesse, die sich nach vorne in gleicher Höhe anschloss, wurden Erfrischungen bereitgestellt, und unser Koch übertraf sich in schmackhaften Schüsseln und einladenden Butterbrotbergen. Die Herren Nichttänzer wurden nicht vergessen. Das achtere Aufbaudeck gab ihnen Gelegenheit zu gemütlichem Schwatz beim Glase Bier, und in der Kajüte standen Bridgetische bereit für die älteren Herrschaften. Als die sternklare Nacht sich senkte, flammten auch innen die Lichter auf. Ein reicher Damenflor stellte sich ein, und lange wogte der Tanz unter den drohend gehobenen Mündungen der Geschütze des achteren Turms. Denn Ernst und Fröhlichkeit wohnen auf einem Kriegsschiff nicht weit voneinander, und die stummen Zeugen des heutigen Festes hatten auch Tage, an denen sie sprechen konnten. —
Der Handelshafen, dessen Anlagen selbst nach englischem Urteil die besten Ostasiens zu werden versprachen, wurde vor dem Kriege von Dampfern so zahlreich besucht, dass die „Gneisenau“ schon am folgenden Morgen ihren Platz an der Mole freigeben musste. Um für bevorstehende Übungen einen kürzeren Weg in See zu haben, gingen wir gleich auf die Außenreede und ankerten auf unserem angestammten Platz bei der Arkonainsel. Die großzügig angelegte Europäerstadt mit ihren hübschen Häusern und vielen hervortretenden Gebäuden war hier vor uns ausgebreitet. Ganz links stand die Deutsch-chinesische Hochschule, die junge gebildete Chinesen in die Geheimnisse deutscher Sprache, Wissenschaft und Technik einführte und in nächster Zeit erheblich vergrößert werden sollte. Dahinter lugte der Turm des Bahnhofs der Shantung-Eisenbahn hervor, die zu den deutschen Kohlengruben im Hinterlande führte und mit dem russischen Eisenbahnnetz verbunden war. Folgte der Blick der kräftigen Strandmauer des Kaiser-Wilhelm-Ufers, so traf er den Tsingtau-Klub, der auch unseren Gästen offenstand; dann das neuzeitlich eingerichtete Prinz-Heinrich-Hotel, das, wie das Strandhotel, von Engländern und Amerikanern gern besucht wurde, und das gelbe Haus der Deutsch-Asiatischen Bank, die für die wirtschaftliche Erschließung der Kolonie von großer Bedeutung war. Hinter beiden lag das weitflügelige Gouvernementsdienstgebäude, das auch die reichhaltige Kiautschou-Bücherei barg. Weiter rechts und höher sah man das vom Deutschen Flottenverein erbaute Observatorium und die schmucke Christuskirche, auf dem Diederichsberg die Signalstation und über dem grünenden Stadtpark das stattliche neue Wohnhaus des Gouverneurs. Am Strande entlang führte der Weg zum Rennplatz, auf dem heute für die Besatzung der „Minotaur“ ein Sportfest stattfinden sollte, denn was konnte man ihr Schöneres bieten als Sport in so einzigartiger Umgebung. Von Hügeln umrahmt, bespült vom Meer, hat dieser Platz den Bewohnern Tsingtaus jahraus jahrein Erholung von der Arbeit gegeben und das Leben in der Kolonie anziehend und erfrischend gemacht. Eine herrliche Luft wehte hier und der Geist friedlichen Wettstreits in körperlicher Übung. So maßen sich die englischen Blaujacken mit den Unseren im Tausendmeterlauf, im Lauf der Stafetten, im Ringkampf, Tauziehen, Turnen am Reck und Barren, im Hoch- und Weitsprung und natürlich auch im Fußballspiel. Dieses sagte ihnen besonders zu. Da hatten sie ihre eingespielte Mannschaft, die sie anfeuern und beloben konnten für einen guten Stoß. All das andere, was den deutschen Sport so abwechslungsreich gestaltet, lag ihnen augenscheinlich weniger. Und deutlich zeigte sich der Unterschied: bei uns Vielseitigkeit, damit viele sich beteiligen und ihren Körper stählen können, auch ohne immer Glanzleistungen zu erzielen; bei ihnen mehr das Herausarbeiten einzelner Eigenschaften zu möglichster Vollkommenheit, das Hervortreten weniger Leute, an deren Anblick dann die große Menge sich begeistern und ihr Sportbedürfnis befriedigen kann.
Auch zwischen den Offizieren und Fähnrichen waren mittlerweile kameradschaftliche Beziehungen geknüpft worden, und kleine Einladungen in die Messen und zu Ausflügen in die Umgebung füllten aufs angenehmste die Tage. Auf breiten, von Akazien beschatteten Straßen fuhr man im Auto an freundlichen Heimstätten der Europäer und blühenden Gärten vorbei, durch neu angelegte, gesunde Chinesendörfer und wohlbestellte wellige Felder; ließ die kräftigen Mongolen-Ponnies ausgreifen auf weichen Reitwegen im Tsingtauer Forst, den die deutsche Verwaltung mit so großem Fleiß und Erfolg in diesem waldarmen Lande hatte erstehen lassen. Besonders der Lauschan zog die Gäste an, jener verwitterte, sagenumwobene Gebirgsstock, auf dessen kühlen Höhen es sich so herrlich wandern und klettern ließ, über grüne Matten und wildes Granitgeröll zu scharfkantigen Felsspitzen, oder gar auf den Lauting, der dem Brocken an Höhe fast gleich kommt. An Sturzbachen und stufenförmig ansteigenden Gärten mit veredeltem Obstbau entlang führten Wege und Pfade zu kiefernumrauschten Buddhatempeln und ehrwürdigen Klöstern, deren kahlköpfige Priester dem Fremden zu kurzem Imbiss gern Obdach gaben. Friedlich der Landschaft sich anpassende Bergdörfer wechselten mit Bambushainen, Seen und Pflanzungen des Maulbeerbaumes, auf dem die Seidenraupe ihren Lebensfaden spann. An einem der schönsten Punkte des Lauschan war das Mecklenburghaus errichtet worden, ein Genesungsheim für Erholungsbedürftige aus der Kolonie, und manch hübsches Sommerhaus stand daneben zu längerem Aufenthalt in dieser Hochgebirgswelt. Eine prächtige Fernsicht hatte man von hier über das Pachtgebiet, sah Dschunken segeln, Schiffe ein- und auslaufen und in den emsigen Betrieben der Hafenstadt von Tsingtau die Schornsteine rauchen. Der Nachmittag fand unsere Gäste dann wohl am heiter belebten Badestrand der Auguste-Viktoria-Bucht. So wurde nichts versäumt, um ihnen den Aufenthalt angenehm zu machen und zu zeigen, was deutsche Schaffensfreude, Umsicht und Tüchtigkeit in dem kurzen Zeitraum von siebzehn Jahren aus einem schmutzigen Fischerdorf und seiner verwahrlosten Umgebung gemacht hatte. Bei solcher Gelegenheit fiel auch das von uns damals viel belachte Geständnis eines älteren englischen Offiziers: „Very nice place indeed! Two years more, we have it!” (Wirklich sehr hübscher Ort, in zwei Jahren gehört er uns!) Ob der wohl Bescheid wissen mochte? Die jungen Midshipmen, die mit der Offenheit, die den einzelnen Engländer auszeichnet, sich natürlich auch zur Frage unserer beiderseitigen Zukunft äußerten, waren jedenfalls anderer Meinung. Sie neigten entschieden dahin, dass ein Krieg zwischen England und Deutschland ein Wahnsinn sei und dass wir lieber zusammen die anderen verhauen sollten.
Sonntag, den 14. Juni, habe ich in besonders fröhlicher Erinnerung, denn man beglückwünschte zum Geburtstage nicht nur den Ersten Offizier, sondern auch die „Gneisenau“, die vor acht Jahren vom Stapel gelaufen war, nachdem Generaloberst Graf Schlieffen sie getauft hatte. Die englischen Offiziere folgten an diesem Tage einer Einladung des Gouverneurs, Kapitän z. See Meyer-Waldeck, und am 15. Juni gaben sie ihr Dank- und Abschiedsfest. Ich benutzte diese Gelegenheit, meinem Kollegen, dem Commander, ein Bild der „Gneisenau“ zu überreichen als Gegengabe für die „Minotaur“, die von einem früheren Zusammentreffen her in unserer Messe hing. Im Übrigen wurde ich lebhaft an ein Bordfest erinnert, das uns im Jahre vorher auf einem englischen Schiff in Hongkong gegeben worden war. Wie damals, war man auch jetzt sehr liebenswürdig, „so glad to see you“, „sehr erfreut“, dass wir kamen, aber wehe dem Gast, der etwa tanzen wollte! Er wurde kurzerhand zur Bar geschleppt und lag da vollkommen auf „Leegerwall“; und versuchte er, sich freizukreuzen, so wurde er prompt zurückgebracht. Als tanzende Gäste galten nur die Damen, und die Wirte waren die Herren des Tanzsaales. Bei uns ist das anders, aber jedes Volk hat eben auch hierin seine Eigenart, und wenn man sie erst kennt, kann man sich ja vergnügt damit abfinden. Auf alle Fälle bekam man doch einen kleinen Eindruck von einem Schiff, dem man auch unter anderen Umständen einmal begegnen konnte. Die „Minotaur“ stammte aus derselben Zeit wie die „Gneisenau“, war aber etwa 3000 t größer und auch artilleristisch ihr überlegen. Doch gerade weil — oder obgleich — wir von früher her gute Bekannte waren, betrachteten wir sie immer so ein bisschen als unseren besonderen Gegner, ein Gedanke, der von der anderen Seite aufrichtig erwidert wurde. Da sieht man sich denn gern, so gut es möglich ist, seinen Freund etwas genauer an.
Am 16. Juni verließ das englische Flaggschiff das gastliche Gestade von Tsingtau. Von der Außenreede, wo wir noch lagen, signalisierte der Admiral Jerram nochmals seinen Dank für die freundliche Aufnahme. Dann war auch dieses Zwischenspiel vorüber, und wir konnten uns wieder ernsteren Aufgaben zuwenden, wie sie die Vorbereitung für eine dreimonatige Reise in die Südsee mit sich brachte.
Das Ostasiatische Kreuzergeschwader bestand vor dem Kriege aus drei verschiedenen Gruppen von Schiffen. Das Rückgrat bildeten die beiden Panzerkreuzer „Scharnhorst“ und „Gneisenau“, denn sie waren die Gefechtsstärksten. Beide waren im Bau noch nicht beeinflusst worden von der Größensteigerung gepanzerter Schiffe, die von England ausgegangen war und deren erste Vertreter das Linienschiff „Dreadnought“ und der Schlachtkreuzer „Invincible“ gewesen sind. Da sie in ihrem schweren Eisenkleide letzten Endes für den Kampf bestimmt waren, so Kennten sie sich auch im Frieden nur vorübergehend voneinander. Der Geschwader-chef besuchte mit ihnen in ziemlich regelmäßigen Fahrten die einzelnen Teile seines Stationsgebietes, je nachdem die Jahreszeit oder die besonderen Umstände es wünschenswert oder notwendig machten. Anders die Kleinen Kreuzer „Emden“, „Leipzig“ und „Nürnberg“. Sie waren ohne wesentlichen Panzerschutz, daher leichtfüßiger und in ihrer Zufuhr anspruchsloser, aber doch genügend kampfkräftig, um selbständig auftreten zu können. Sie bevorzugten solche Plätze, die die Großen Kreuzer ihres Tiefganges wegen nicht oder nur bei günstigem Wasserstande anlaufen konnten, oder wo die Entwicklung politischer Verhältnisse, wie Unruhen in China oder Mexiko oder Aufstände wie der in Ponape 1910, schnelles Erscheinen von Kriegsschiffen erforderlich machte. Im Kriege waren sie die gegebenen Handelszerstörer. Die dritte Gruppe bestand aus kleineren Fahrzeugen, den seegehenden Kanonenbooten „Iltis“, „Jaguar“, „Tiger“, „Luchs“ und den Flusskanonenbooten „Tsingtau“, „Otter“ und „Vaterland“, sowie dem Torpedoboot „S 90“. Sie waren die eigentlichen Stationsschiffe, die planmäßig die Hafenplätze der ostasiatischen Küste besuchten, besonders solche, die auch du Kleinen Kreuzer nicht anlaufen konnten. „S 90“ lag meist in Tsingtau und wurde zum Dienst bei den Kreuzern und zeitweise auch als Stationär verwendet. Schließlich gehörte zum Geschwader noch der Begleitdampfer „Titania“, der deutsche Offiziere, aber chinesische Besatzung hatte, den Schiffen Kohlen und Vorräte nachführte und zu allerlei sonstigem Hilfsdienst herangezogen wurde.
Im Frühjahr pflegten die Schiffe, die irgend abkömmlich waren, in Tsingtau zusammenzukommen, um, wie wir sahen, die halben Besatzungen zu wechseln. In diesem Jahre fehlte dabei die „Nürnberg“, die seit längerer Zeit zum Schutze der deutschen Interessen an der mexikanischen Westküste kreuzte. „Leipzig“ war am 7. Juni in See gegangen, um sie abzulösen; dann sollte „Nürnberg“ über Honolulu und die Südsee nach Tsingtau zurückkehren zu gründlicher Überholung auf der Werft.
„Scharnhorst“ und „Gneisenau“ hatten schon im Sommer 1913 eine Reise in die deutschen Schutzgebiete des Stillen Ozeans angetreten, waren aber, kaum dort angelangt, zurückgerufen worden, weil in China eine neue Revolution ausgebrochen war. Jetzt sollte diese Reise wiederholt werden und über die Marianen und Karolinen bis nach Samoa führen, wo wir mit der „Nürnberg“ zusammentreffen wollten. Auf der Rückfahrt sollte das englische Suva auf den Fidshi-Inseln, dann Kieta auf der deutschen Insel Bougainville und der Bismarckarchipel besucht werden. „Emden“, die unsere Reise im vorigen Jahr mitgemacht hatte, war dazu bestimmt, mit den Kanonenbooten und „S 90“ während unserer Abwesenheit den Dienst an der ostasiatischen Küste zu versehen.
Es war ein schöner Reiseplan, den wir da vor uns hatten, und alle Hände rührten sich, die letzten Vorbereitungen zu treffen. Nach Beendigung der Schießübungen gingen wir für einige Tage an die Werftmole und packten noch ein, was wir an frischem Proviant und sonstigen Vorräten brauchten. Den Schluss machten die Kohlen, die man so leicht dort nehmen konnte. Stellings führten vorn und hinten auf das Schiff. In der Mitte hob der große Bootskran immer zehn große Körbe auf einmal über, und mit viel Geschrei und großer Geschwindigkeit trugen chinesische Kulis an wippenden Bambusstangen die schöne heizkräftige, rauchlos brennende Shantungkohle an und in das Schiff, während auf der anderen Seite unsere eigene Mannschaft aus Prähmen arbeitete. Wir haben uns später oft nach diesen bequemen Einrichtungen zurückgesehnt.