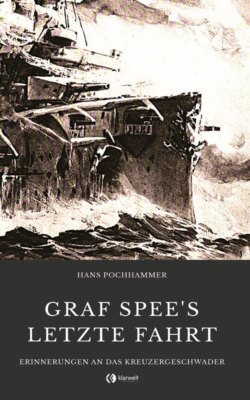Читать книгу Graf Spee's letzte Fahrt - Hans Pochhammer - Страница 5
II. Von Tsingtau nach Truk.
Оглавление„Gneisenau“ tritt die Reise an. Nagasaki. Letzte Post. Die Marianen. Urakas. Pagan. Saipan. Rota. Das Trukatoll. „Scharnhorst“ trifft ein. Kohlennehmen. Tänze der Eingeborenen.
Am 20. Juni 1914 ging. S. M. S. „Gneisenau“ in See. Unter den Klängen des Liedes „Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt“ legten wir bei herrlichem Sonnenschein morgens um 8 Uhr von der Kohlenmole ab. Der Geschwaderchef sah uns zu; er konnte erst in einigen Tagen mit der „Scharnhorst“ folgen. Langsam drehten wir im Hafen und glitten hinaus in die Bucht. Beim Hufeisenriff wurden die letzten Boote eingesetzt, dann ging's am Leuchtturm Ju-nui-san vorbei, der ähnlich dem von Friedrichsort Innen- und Außenreede trennt. Nachdem wir bei der Arkonainsel noch ein Signal mit dem Lande gewechselt hatten, schieden wir von dem herrlichen Fleckchen Erde in der Hoffnung, am 29. September wohlbehalten zurückzukehren von der Reise, die für mich und die Herren Leutnants die letzte sein sollte auf diesem Schiff. Wollten wir doch im Herbst 1914 nach zweijähriger Auslandszeit durch Sibirien in die Heimat fahren und das Weihnachtsfest mit unseren Angehörigen verleben. Schnell schwanden Stadt und Hügel. Die drei Spitzen der Prinz-Heinrich-Berge traten zurück; der Kaiserstuhl verblasste; nur der jäh aus dem Meer aufragende Lauschan schaute uns wie ein trutziger Wächter noch lange nach, das letzte, was wir von Tsingtau gesehen haben. Aber zum Nachdenken war nicht viel Zeit, denn im Schiff gab‘s für einen Ersten Offizier genug zu tun. Der hat sich auf das Inseegehen schon deshalb lange gefreut, weil er endlich einmal den Landschmutz loswerden kann, der im Hafen ihm trotz allen Füßeabtretens täglich und stündlich an Bord geschleppt wird. Nach der Kohlenübernahme am Tage vorher war eine gründliche Schiffsreinigung ohnehin vonnöten. Überall wurde Farbe gewaschen, Holzwerk gescheuert, wurde von der Arbeit der letzten Tage aufgeräumt. Wo irgend die Feuerlöschleitung einen Stutzen hatte, sprudelte das Wasser in die Decks; bald war kein trockenes Plätzchen mehr im Schiff, und die Herren „Badegäste“ flüchteten hierhin und dorthin vor der unerbittlichen Sintflut. Fröhlich schafften die Leute, teils in Reih und Glied taktmäßig den Besen schwingend, um das reine Deck noch reiner zu machen, teils in luftiger Höhe auf einer Stelling oder einem Bootsmannsstuhle sitzend, natürlich mit Tauwerk fest- gebunden, um sich vor Fall zu sichern; alle barfuß, heiter und frei von „Sorgen, Last und Not um Brot“ und, besonders die Jungen, erwartungsvoll den Wunderdingen entgegensehend, die sich ihnen „in Berg und Tal und Strom und Feld“ und im weiten Weltmeer auftun sollten. Schließlich war es ein Sonnabend, der auf dem Wochenplan eines Kriegsschiffes bekanntlich mit „Reinschiff“ verzeichnet steht. Man kann sich also vorstellen, dass am Sonntag, als die Wasser sich verzogen hatten und auch das Messing geputzt war und wir bei schönem Wetter in leichter Dünung südlich von Korea an der Insel Quelpart vorbei unsere friedliche Straße zogen, unser Meerschloss leidlich sauber war.
Doch sollte die Herrlichkeit nicht lange dauern, denn es ließ sich nicht vermeiden, den letzten Hafen anzulaufen, den wir auf unserem Wege fanden, um die bis dort verbrannten Kohlen zu ergänzen. Als es eben hell wurde am Montag, den 22. Juni, standen wir in der Einfahrt von Nagasaki. Auf der Lotsenstation wehten bunte Flaggen, die in der kurz angebundenen Sprache des Internationalen Signalbuches uns sagten: „Stoppen Sie, wo Sie sind!“ Dann kam der japanische Arzt an Bord und prüfte unseren Gesundheitspass, und der Lotse brachte das Schiff in den Hafen.
Ich bin immer gern in Nagasaki gewesen. In dem tief ins Land greifenden Fjord liegt man wie in Abrahams Schoß, kann an einer Boje festmachen, was in Ostasien selten vorkommt, und hat als Erster Offizier das geringste Maß von Kümmernissen. Der Bootsverkehr wickelt sich leicht ab; man ist schnell an Land und kann der Mannschaft viel Urlaub geben. Nagasaki ist auch trotz seines Schiffsverkehrs immer noch ein japanischer Ort voll eigenartigen Lebens in den Straßen, wenn man die Gässchen einer japanischen Stadt so nennen darf. An der Landungsstelle warten schon, in langer Reihe aufgefahren, die hochrührigen Rikishas, um uns schnell für 50 Cent zu Sato zu bringen, dem Kunsthändler, oder zum Lackladen, oder zu Daimio, wo es Krepp und Seide gibt und japanische Niedlichkeiten. Es ist eben ein richtiger Einkaufhafen, in dem man nie ohne einen Arm voll Pakete an Bord kommt. Im Oktober 1913 hat die „Gneisenau“ hier sechs Tage gelegen, so dass wir die schönsten Weihnachtsbesorgungen haben machen können. In der hübschen Umgebung bieten sich manche Ausflugsziele, kurz, es ist einer der wenigen Plätze in Ostasien, wo alle an Bord, Mannschaften wie Offiziere, auf ihre Kosten kommen.
Außer den 400 t, echter Japankohle, die bald übergenommen waren, erwarteten wir hier noch etwas sehr Wichtiges, und das war die Post. Ist man zu Hause gewohnt, dass Briefe kaum älter sind als 24 Stunden, so brauchten sie zu uns, solange wir an die Sibirische Bahn Anschluss hatten und nicht südlicher lagen als Shanghai, durchschnittlich 14 Tage, ein großer Gewinn gegen den früheren Weg mit dem Dampfer „untenherum“ von etwa 5 Wochen, auf dem jetzt nur noch die Drucksachen befördert wurden.
Auf unserer Reise hatten wir Aussicht, wenn ich nicht irre, nur zweimal Post zu bekommen. So lag uns ganz besonders daran, diesen letzten Gruß aus der Heimat nicht zu missen. Mit dem Abendschnellzug traf er ein und reichte bis zum 8. Juni. Frohgemut warfen wir bei strömendem Regen von der Boje los und wiegten uns bald wieder auf langer Dünung im Ostchinesischen Meer. Wie steuerten an Kiuschiu entlang, der südlichsten der japanischen Hauptinseln, und gingen in der Colnettstraße durch die Riu-Kui-Inseln in den Stillen Ozean. Er blieb zunächst seinem Namen treu, und schönes Wetter begleitete uns auf unserem Wege nach Südost. Stetig wurde es wärmer. Immer höher kletterte die Sonne des Mittags, hatte sie doch vor kurzem erst ihren nördlichsten Stand gehabt. Immer schneller entstieg sie morgens dem Meere als großer feuriger Ball und senke sich ebenso des Abends, nachdem sie uns ordentlich durchgewärmt und uns schon manchen Schweißtropfen abgenötigt hatte.
Am 26. Juni überschritten wir den Wendekreis des Krebses in ungefähr 140 Grad östlicher Länge und waren nun in den Tropen. Sonnensegel überspannten das Schiff. Die Mannschaft setzte Strohhüte auf und wurde über die Gefahren belehrt, die die Tropensonne dem Menschen bringen kann, wenn er sich ihr unvorsichtig aussetzt.
Die Marianen, die unser erstes Ziel waren, sind wie die Karolinen im Jahre 1899 durch Kauf von Spanien an Deutschland gekommen, Urakas, die Vogelklippe, die nördlichste von ihnen, sichteten wir am 27. Juni und gingen ziemlich dicht heran, um sie uns anzusehen. Eine wilde, unbewohnte Insel mitten im Weltmeer, macht sie einen merkwürdigen, fast unheimlichen Eindruck. Der rotbraune Vulkankegel, auf dem eine leichte Rauchfahne schwebt, ragt über 300 m hoch aus dem brandenden Wasser, kahl und ohne Leben.
Nur die Reste einer älteren Insel, die ihn umgeben, zeigen einen Ansatz von Pflanzenwuchs, und unzählige Vögel, die in verwitterten Höhlen nisten, treiben hier ihr Wesen.
Ein Sirenenton brachte sie in größere Bewegung, und sie umschwebten mit Geschrei die Insel und das Schiff, ärgerlich über die Störung und neugierig den großen Wallfisch musternd. Wir fuhren dann weiter an der Inselreihe entlang nach Süden, tagsüber näher heranstehend, nachts in größerem Abstande, da es ja Leuchtfeuer hier nicht gibt.
Am Sonntag, den 28. Juni, ankerten wir vor Pagan, einer der wichtigeren Inseln der Gruppe, die bewohnt ist und Kopra liefert. Wehmütige Erinnerungen erweckte sie uns, denn im Jahre vorher hatten wir hier einen hoffnungsvollen, jungen Seeoffizier verloren. Angelockt von der herrlichen Tropennatur, die sich unter den beiden steilaufstrebenden, mächtigen gelben Vulkankegeln ausbreitet, war er mit einigen Freunden an Land gegangen.
Auf dem Rückwege zum Boot verfehlte er den Weg und ist dann im dschungelartigen Unterholz den Anstrengungen erlegen, die der mühsame Marsch und die unerbittliche Sonne ihm schufen. An die 200 Mann rückten damals unter Leitung des Kommandanten aus, um ihn zu suchen, und man fand ihn, friedlich und scheinbar schmerzlos entschlummert mitten im dicksten Gestrüpp; der Tod musste schnell eingetreten sein.
Ich hatte nicht mit an Land gehen können, aber unvergesslich ist mir der Trauerzug, als die Trage an den Strand kam, und dann das Boot, das sie zum Schiff brachte, die Flagge halbstocks führte. Und als wenn die Insel unseren Schmerz empfände, schlug, während der Tag schnell zur Neige ging, feurige Lohe zum Himmel empor, denn ein Leuchtsignal, das die Auffindung anzeigen und die Mannschaften hatte zurückrufen sollen, hatte im dürren Schilf gezündet.
Der Geschwaderchef mit seinem Stabe und den Kommandanten.
Der Verfasser in seiner Kammer an Bord S. M. S. „Gneisenau”.
Die ganze Nacht hindurch arbeiteten unsere Leute, um die kleine Niederlassung und die jungen Kokospalmen vor dem Brande zu schützen, während an Bord die Leiche in einer Kasematte aufgebahrt und dann in einen Zinksarg gelegt wurde, den unser Maschinenpersonal schnell fertiggestellt hatte. Acht Tage lang stand der Sarg auf dem Steuerbord achteren Außendeck, mit einem Posten davor, bis wir ihn nach erhebender Trauerfeier in Rabaul auf die letzte Reise in die Heimat schicken könnten. —
Als wir jetzt wiederkamen, fanden wir noch allerlei Spuren des Feuers, das ein gut Stück Land für die Vergrößerung der Pflanzung freigelegt hatte, gleichsam als Entschädigung dafür, dass doch mancher Baum hatte dran glauben müssen. Die Aus- und Einschiffung durch die Brandung war nicht ganz einfach, und unsere Rückkehr an Bord glückte erst, nachdem eine Jolle breitgeschlagen und gekentert war. Archer einem unfreiwilligen Bade hatten die Beteiligten aber keinen Nachteil davon. Es will eben alles gelernt sein.
Als die Sonne schon tief stand und die Insel und den leichtbewölkten Himmel in alle Farben tauchte, lichteten wir Anker und setzten unsere ruhige Fahrt fort. Schnell kam die Dunkelheit, und eine klare Tropennacht umfing uns wieder auf weitem Meer. Hell leuchteten die Sterne. Das südliche Kreuz stand schon über der Kimm, und ein strahlender Planet, die Venus, schickte sich an, durch die Mondscheibe zu wandern. In ruhigem Geplauder saßen wir beisammen, die Mannschaft auf der Back und dem Aufbaudeck, die Offiziere auf der Schanze, und genossen die erquickende Kühle nach heißem Tag. Hier und da wurde wohl ein friedlicher Kampf auf dem Schachbrett ausgefochten. Eine Dorfgeschichte oder heimatliche Lieder trugen die Gedanken fern hinweg zu den Lieben, wo im schönen Sommer die Felder jetzt reiften. Wie sonst schwatzten auch heute drahtlose Funken durch die Nacht; wir waren noch in guter Verbindung mit Tsingtau und hörten seit einiger Zeit auch schon Yap, die neue deutsche Station auf den West-Karolinen, die Kabelanschluss hatte nach Shanghai, Niederländisch-Indien und über Guam nach Nordamerika. Wenn die Sonne nicht scheint, ist die Verbindung zuverlässiger und weitertragend. So bekamen wir fast jeden Morgen eine Art Ozeanzeitung, die neuesten Telegramme aus aller Welt. Aber was wir am 29. Juni lasen, war ergreifend, die Meldung: Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin in Sarajewo ermordet! Wir wussten, welche Hoffnungen man in Österreich-Ungarn auf diesen Fürsten setzte und welche Stücke auch unser Kaiser auf ihn hielt. Und zu tiefem Abscheu vor feigem Verbrechen kam uns sofort die Empfindung, dass hier etwas geschehen war, was seine Kreise ziehen musste; dass eine so schwere Beleidigung, ja Herausforderung unseres Verbündeten auch Deutschland und damit uns selbst hier draußen nicht unberührt lassen könnte. Dass Russland rüstete, war uns bekannt. Mir hatte mein Vater schon im März geschrieben, wir gingen in nicht mehr zu übersehender Weise einem Kriege mit Russland entgegen. Frankreichs Stimmung gegen uns war nicht zweifelhaft, und England? — Aber nicht doch! Wir hatten doch eben noch die herzlichsten Freundschaftbeteuerungen gehört. Der englische Admiral, der Kiel besuchte, hatte ein so aufrichtiges Danktelegramm geschickt, ganz zu schweigen von unserer eigenen kleinen Begegnung in Tsingtau. So kamen wir schließlich überein, dass wohl auch dieses Begebnis sich mit Ehren würde begleichen lassen, ohne dass die Welt darüber in Brand geriete. Die wirtschaftlichen Beziehungen der Völker schienen uns so verwickelt und so unlösbar, dass wir an gewaltsamen Bruch, jedenfalls aus solcher Veranlassung, nicht recht glauben wollten. Immerhin: „Bereit sein ist alles!“ Kriegsschiffe im Auslande müssen stets damit rechnen, ganz plötzlich auf sich selbst gestellt zu sein. Unser Gefechtsdienst, den wir in dieser ganzen Zeit ohnehin schon eifrig betrieben, bekam doch eine Spur ernsteren Beigeschmacks, und so eine Art Unterbewusstsein, dass wir einer schweren Zeit entgegengingen, hat uns seit diesem Morgen nicht mehr verlassen.
Doch wie zu Hause behielt der Alltag noch die Oberhand, und jetzt steuerten wir gerade Saipan an, wo die Verwaltung der deutschen Marianen ihren Sitz hatte. Lang streckt es sich von Nord nach Süd, wie fast alle Inseln dieser Kette; ein erloschener Vulkan, der Tapotschau, krönt ihre Mitte. Zu seinen Füßen liegt der Hauptort Garapan, vor dem wir nachmittags zu Anker gingen. Obwohl wir auf der Westseite der Insel lagen, schlingerte das Schiff doch stark in der um ihre Enden laufenden östlichen Dünung, und das Aussetzen der Decksboote war schon etwas schwieriger als zu Hause in Tsingtau. Aus dem kleinen Hafen, den die Korallenriffe hier bilden, kam ein weißes Ruderboot. Wir schickten ihm eine Dampfpinass entgegen, und bald waren der Stationsleiter und der Regierungsarzt bei uns an Bord. Beide Herren hatten unser Schiff, als wir noch weit ab gewesen waren, für einen Franzosen gehalten und schon an Sicherheitsmaßnahmen gedacht. Sie mussten immer auf so eine Art Überfall gefasst sein, denn sie bekamen nur alle acht Wochen Post und wussten daher noch nichts von unserer Reise. Die „Germania“, der Dampfer der Jaluit-Gesellschaft, war noch dazu wegen Taifuns überfällig. Umso größer war die Freude über unsere Ankunft, und bereitwillig halfen die Herren uns in den nächsten Tagen, ihr kleines Reich kennenzulernen.
Sie herrschten über zwei ganz verschiedene Volksstämme, die Chamorros und die Karolinier. Die Chamorros, die ursprünglichen Einwohner der Marianen, sind ziemlich hellfarbig, gehen europäisch gekleidet und legen Wert darauf, als etwas Besseres zu gelten. Sie wohnen in einstöckigen Holzhäusern und machen überhaupt den Eindruck einer gewissen Wohlhabenheit. Ihr geistiges Haupt war zur Zeit unseres Besuches ein Jüngling namens Ata, der in Hamburg die Seemannsschule besucht und sich wohl auch sonst nicht ohne Nutzen in Deutschland aufgehalten hatte. Sein Geschäft schien gut zu gehen. Er handelte hauptsächlich mit Kopra nach Japan, besaß aber auch einen Laden und war besonders stolz auf seine Seifenfabrik, in der wir spaßeshalber etwas frische Palmölseife kauften. Doch hatte er auch modegerecht tanzen gelernt, und man wird unser Staunen begreifen, als wir zu einem richtigen kleinen Ball eingeladen wurden. Die jungen — und älteren — Chamorrodamen wollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, sich mal wieder nach den Klängen des Klaviers im Walzertakte zu wiegen. Ihre Balltoilette stammte, wie uns erzählt wurde, aus dem „Kaufhaus des Westens“ — vorletzte Saison. Deutsch konnten sie auch, jedenfalls genug für eine Ballunterhaltung; kurz, es war „fast wie zu Hause“. Ehe das Fest begann, gaben die Karolinier, die sehr viel dunkler sind und den paradiesischen Zustand noch ziemlich bewahrt haben, vor dem Hause eine Tanzvorstellung etwas urwüchsigerer Natur. Auf den braunen, fettglänzenden Leibern, die mit Gelbwurz angemalt waren, spiegelte sich das Licht von Palmblattfackeln, während sie, in Reihen aufgestellt, nach eintönigem Gesang ihre Bewegungen ausführten.
Chamorro- und Karolinierdorf liegen friedlich neben- einander links und rechts des Weges, der von der Landungsstelle kommt. Er führt direkt zur Schule, die beiden gemeinsam ist. Der Kommandant besuchte sie mit einigen von uns gleich am nächsten Vormittag. Wenn wir in eine der drei Klassen traten, stand das junge Volk auf und sagte „Guten Morrgen!“ Wir hörten allerlei Weisheit von den kleinen Leuten. Sie konnten deutsch lesen, aufsagen, Fragen beantworten und sprachen dabei merkwürdig eintönig und mit scharfem Zungen-„Rr“. Ein dunkler Lehrer fragte ab: „Was tut der Vater?“ „Derr Vaterr arrbeitet.“ „Wo arbeitet der Vater?“ „Den Vaterr arrbeitet auf derr Pflanzung.“ „Was pflanzt der Vater?“ „Derr Vaterr pflanzt Bananen.“ „Und?“ „Derr Vaterr pflanzt Kokospalmen.“ „Und?“ „Derr Vaterr pflanzt Yam“, und so fort, kurz, es ging auf den Wert der Arbeit hinaus, sicher ein guter Weg zur Erziehung zur Arbeit, dem Hauptziele gesunder Eingeborenenpolitik. Zum Schluss hörten wir noch einen frischen deutschen Sang.
Die Schule stand, als Regierungsschule, unter der Leitung eines deutschen Lehrerehepaares, und so zahlreich waren die Schüler, dass von morgens bis abends unterrichtet werden musste. Ihr angegliedert war eine Dolmetscherschule, auf der ältere Knaben im Deutschen weitergebildet wurden. Einige besonders anstellige Chamorros waren nach Tsingtau geschickt worden, um auf der Werft in der Tischlerei ausgebildet zu werden.
Außer diesen beiden Stämmen beherbergte Saipan noch zwei fremde Dörfer, Samoaner. und Oleai-Leute. Die Samoaner, der alte Lauaki mit seinem Anhange, warm Verbannte, die nach dem Aufstande 1911 hierher gebracht worden waren. Sie empfingen uns in ihrer kleinen Ansiedlung und bewirteten uns in heimischer Weise mit Kawa und schönen Reden. Sie kamen später auch vollzählig an Bord, brachten Kokosnüsse und Strohmatten mit und holten sich Geschenke. Die Männer und die Dorfjungfrau tanzten und fangen, nachdem sie sich zu meinem Schrecken auf der Schanze mit Palmöl eingerieben hatten. War es auch nur ein Abglanz ihres fröhlichen Treibens daheim, wir freuten uns doch, diesen Eindruck zu haben. Schon im vorigen Jahre war uns das sagenhaft schöne Samoa durch die Lappen gegangen; wie leicht konnte das jetzt wieder geschehen.
Die Oleai-Leute, zu denen mich der Regierungsarzt eines Morgens mitnahm, hielten sich in Saipan nur vorübergehend auf. Ihre Insel in den West-Karolinen war vor kurzem von einem Taifun heimgesucht worden. Sie sollten bald wieder südlicher ziehen, weil sie hier allzu sehr froren. Wir überraschten die weibliche Jugend des Dorfes, als sie im lichten Palmenwald in einer Reihe stand und unter Anleitung gestrenger Großmütter eine Tanz- und Gesangprobe abhielt. Ihre anmutigen, dunklen Gestalten, die mit nichts anderem als einem Lendenschurz aus frischen Blättern bekleidet waren, hoben sich scharf von der grünen, sonnendurchspielten Umgebung, während die Mädchen singend im leichten Takt den Oberkörper, den Kopf und die Arme bewegten: ein heiteres, naives Bild.
So gut die Zeit es erlaubte, wurde auch unserer Mannschaft Gelegenheit gegeben, etwas von der Insel zu sehen. Der Bootsverkehr weit draußen von der offenen Reede durch die gewundene, enge Hafeneinfahrt war aber nicht ganz einfach, und einer unserer Dampfpinassen gefiel es auf der Korallenbank so gut, dass sie erst nach längerem Zureden zu bewegen war, an Bord zurückzukehren; die braunen Bootsleute unserer Wirte und der endlich eingetroffene Dampfer „Germania“ halfen kräftig, sie flott zu machen.
Am Abend des 2. Juli verabschiedeten wir uns von unseren Landsleuten in Saipan, standen die Nacht über in See, und ankerten am nächsten Morgen, um Hirsche zu schießen, vor der Insel Rota. Diese trägt nur eine kleine Chamorro-Ansiedlung, die vor einigen Jahren in einem Taifun ebenfalls schwer gelitten hat. Der katholische Missionar, mit einem Laienbruder die einzigen Weißen, zeigte uns noch Spuren davon; auch besuchten wir eine große Tropfsteinhöhle, in der sie mit ihrer Gemeinde vor Sturm und Flut Schutz gefunden hatten. Mit guter Jagdbeute verließen wir abends das einsame Eiland und fuhren an Guam vorbei, das allein von den Marianen einen guten natürlichen Hafen hat und den Amerikanern gehört, unserem nächsten Ziele zu, dem großen Truk-Atoll auf den Mittelkarolinen. Das Wetter verschlechterte sich jetzt. Es wurde diesig; Böen setzten ein, und die Sonnensegel mussten geborgen werden. Wind, See und Barometerstand ließen keinen Zweifel darüber, dass ein Taifun nördlich von uns vorbeieilte. „Scharnhorst“, die etwa zwei Tagemärsche hinter uns stand, hat seine Nähe noch deutlicher zu spüren bekommen. Zum Glück hatten wir am 5. Juli ein gutes Mittagsbesteck, mit dem wir auch in etwas unsichtigem Wetter die Olol-Inseln ansteuern konnten, ein großes Atoll, das auf unserem Wege lag. Gegen 4 Uhr nachmittags erschien es hinter Wolkenschleiern am Horizont: man sah, als wir näher daran waren, eigentlich nur Palmengruppen über weißem Gischt der am Ufer sich brechenden See. Solches Insichtkommen wird auf der Kommandobrücke immer mit einiger Freude begrüßt, denn es löst die Spannung, mit der es erwartet wurde. Besondere Bedeutung gewinnt es in einem Inselgewirr wie dem der Südsee, wo die Korallenwände fast senkrecht aufsteigen, wo kein Lotwurf dem Navigations-Offizier die Nähe des Landes anzeigen kann und oft nur die Brandung verrät, wo die Gefahr liegt. Gelingt es da nicht, vor Dunkelheit die Landmarken auszumachen, die man sucht, so bleibt nichts übrig, als in den freien Seeraum zu halten und bis zum nächsten Morgen zu warten. — Wir konnten diesmal unseren Weg ruhig fortsetzen und richteten uns so ein, dass wir am folgenden Tage, dem 6. Juli vormittags, vor der Nordosteinfahrt von Truk standen.
Die Trukinseln werden von einem Wallriff umgeben, das bis zu 40 Seemeilen Durchmesser hat. Wie eine Mauer steht es fast kreisrund im Wasser. Die Wogen des Ozeans rennen dagegen und stoßen sich die Köpfe ein, dass der Schaum hoch aufspritzt; ein weißer Streifen zeigt seinen Verlauf. Dahinter ist es ruhig, und weit dehnt sich die Lagune um die Kuppen des unterseeischen Basaltgebirges, die nun einzelne Inseln sind. Will man einlaufen, so ist gute Sichtigkeit Vorbedingung, und gern hat man die Sonne im Rücken, um flache Stellen vermeiden zu können, die sich von dem dunklen Blau der Tiefe hellgrün abzeichnen. Wir mussten warten, bis zwischen Böen, die uns den Regen ins Gesicht peitschten, eine Pause eintrat; dann hielten wir auf Wela zu, deren Höhen über 300 m ansteigen. In der Einfahrt biegt sich das Riff formvoll nach innen und lässt fast vergessen, dass die Natur es gebaut hat. Wir laufen hindurch wie zwischen Molen, ändern Kurs und ankern nach einer Stunde in Eten-Hafen, einer freundlichen Bucht zwischen Toloas und Eten. Hier lagen wir besser als vor Saipan, wenn auch noch auf 40 m Wasser, aber geschützt gegen Dünung, und der Anker hielt gut, nachdem er sich an langer Kette in Korallen festgelegt hatte. Bald stellten sich auch hier die ersten Besucher ein: der Stationsleiter, der Arzt, die Herren der Jaluit-Gesellschaft, Missionare. Und der junge Kommandant des neuen Peilbootes, das auf der Tsingtauwerft gebaut und erst vor kurzem von der „Titania“ hierher gebracht worden war zur Vermessung der Insel, meldete sich bei dem Unsrigen. Anderen Tags kam die „Scharnhorst“, Kommandant Kapitän z. See Felix Schultz, und abends auch die „Titania“ mit dem für die Reise gemieteten japanischen Kohlendampfer „Fukoku-Mar“. So konnte die schmutzige und doch so notwendige Arbeit gleich beginnen. Kohlen nehmen ist an sich schon kein leichter Dienst, besonders in den Tropen, wo die Sonne so hoch steht und das Quecksilber auch auf dem Wasser gerne bis 30 Grad und darüber klettert. Deshalb nutzt man nach Möglichkeit die kühleren Stunden, auch wenn es dunkel ist, und lässt die Arbeit während der Mittagshitze ruhen. Kann man nur von einer Seite kohlen, so wird die Sache noch schwieriger, weil dann die Hälfte der Last auf die andere Seite des Schiffes geschleppt werden muss. Schließlich Kot die Übernahme aus einem Dampfer, an dessen Schätze man nicht immer leicht heran kann, unserer jungen Mannschaft überhaupt einiges Neue. So scholl, nachdem die „Scharnhorst“ ihren Hunger befriedigt hatte, fröhlicher Zuruf vom Hellwerden bis fast zum anderen Morgen, klirrten die Ketten, zischte weißer Dampf aus den Heißwinden, stiegen die Staubwolken, füllten, schleppten und leerten schwarze Gestalten die Kohlensäcke, und ein gesunder Wetteifer zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen förderte die Leistungen. Große elektrische Lampen und die Scheinwerfer der „Scharnhorst“ erhellten, nachdem die Sonne untergegangen war, das ganze Arbeitsfeld, auf dem für Faulenzer kein Platz war, wo jeder zugreift und mithilft, damit das Schiff schnell wieder fahrbereit wird. Nur wer gar nichts mit dem Kohlen zu tun hatte, machte besser dass er an Land kam oder flüchtete auf die „Titanic,“, deren liebenswürdiger Führer, Oberleutnant z. See d. R. Vogt, immer einen bequemen Stuhl und kühlen Trunk für solche Gaste bereit hatte.
Als die Kohlenschlacht geschlagen und das Schiff wieder sauber war, suchten wir, unsere Umgebung näher kennen zu lernen. Doch war über Land, wenn man nicht in den Urwald eindringen wollte, nicht viel zu unternehmen, das Wegenetz noch bescheiden. Der Verkehr ging meist über Wasser, und wer die Natur belauschen wollte, bat den Ersten Offizier um ein Boot, segelte nach Herzensluft zwischen den Inseln herum und landete, wo es ihm gefiel. Da konnte man auf flachem Wasser den Bau der Korallen bewundern, auch Fische und anderes Getier in allen Formen und Farben, dann wieder Mangroven und Palmen, bunte Vögel und große Schmetterlinge und taufend Arten tropischen Wachsens. Die Menschen dazwischen — Truk ist stark bevölkert — erschienen noch sehr ursprünglich: auch die planmäßigen Arbeiten zur Verbesserung der Gesundheitsverhältnisse steckten noch in den Ansängen. Wir sahen eine Musterhütte auf Pfählen, die die Leute lehren sollte, gesunder und sauberer und nicht in ihrem eigenen Schmutz zu wohnen, denn allerlei Krankheiten plagten sie; die Sprechstunde des Arztes war sehr besucht. Und doch boten die Eingeborenen ein hübsches Bild, als sie eines Nachmittags in ihren geschmückten Ausliegerbooten von allen Seiten herankamen und sich um die „Scharnhorst“ scharten. Sie wollten tanzen vor dem Großen deutschen Häuptling, dem Admiral, und lagerten mit viel Geschrei, nach Stämmen geordnet, auf Bastmatten, die sie auf der Schanze ausgebreitet hatten, bis die Reihe an sie käme. Dann ordneten sie sich auf dem kleinen Raum, der für die jeweiligen Tänzer freigelassen war, und die mit Palmöl eingeriebenen sehnigen Gestalten bewegten sich rhythmisch im Sonnenlicht. Jeder Stamm tanzte seinen eigenen Tanz. Der Vorsänger gab den Takt; die anderen fielen ein, klatschten in die Hände, schlugen die Arme gegeneinander, auf die Schenkel, unter die Achseln, dass es einen hohlen Ton gab. Manche Gruppen saßen und wiegten nur die Oberkörper und warfen die Köpfe, dass die Schildpattohrringe klapperten und die Halsketten aus Zähnen des fliegenden Hundes rasselten. Ändere sprangen umeinander. Die letzte und beste Gruppe tanzte mit langen dünnen Keulen, die sie geschickt um den Körper wirbelte oder mit lautem Knall auf das Deck stieß.
Immer aber schloss der Tanz mit einem kurzen, hundeartigen Gebell aus rauen Kehlen. Auch Mädchengruppen waren dabei, hübsche Erscheinungen zum Teil, in feingeflochtenen Baströcken, die sie erst kurz vorher im Busch mit den Alltagskleidern vertauscht hatten.
Muschelketten schmückten Hals und Handgelenke; der Oberkörper war wieder mit Gelbwurz verschönt, und kein Kopf ohne Blume im schwarzen Haar. Die Mütter saßen hinter den Mädchen mit wachsamem Auge und lobten und tadelten Haltung und Gebaren, denn eine guttanzende Tochter mehrt das mütterliche Ansehen und steht höher im Preise, wenn der Mann kommt und sie kaufen will.
Es war an diesem Nachmittag auf der „Scharnhorst" ein luftiges, wenn auch fremdartiges Treiben, das der Mannschaft viel Spaß machte. Im schmucken weißen Tropenanzug hielt sie den achteren Turm und das Aufbaudeck besetzt bis in den Großmars hinauf, oder wo jeder sonst ein Plätzchen hatte erhaschen können. Auch der Geschwaderchef zeigte sich sichtlich erfreut.
Freundlich begrüßte er einzelne Häuptlinge und ließ sich vom Stationsleiter über sie berichten. Mit Lärm und Gesang zog gegen Abend die dunkle Gesellschaft von dannen und hat zu Hause beim Fackelschein wohl noch lange weiter getanzt. Denn wenn diese Leute der Freudenrausch einmal gefasst hat, tanzen sie tatsächlich, bis sie umfallen. Ein friedliches Spiel der Scheinwerfer leuchtete ihnen auf der Heimfahrt nach. — Wieder aber zitterten elektrische Wellen durch die Luft, erzählten von Bestürzung und Empörung über ruchlosen Fürstenmord und mahnten zur Vorsicht.
So war es geraten, von nun an zusammenzubleiben. Wir mussten vereint marschieren, „Scharnhorst“ und „Gneisenau“, um, falls es nötig würde, vereint schlagen zu können.