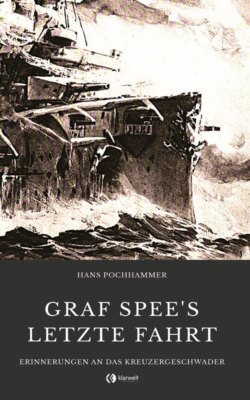Читать книгу Graf Spee's letzte Fahrt - Hans Pochhammer - Страница 6
III. In Ponape.
ОглавлениеGefechtsbesichtigung. Verlängerter Aufenthalt. Der Dschokadsch. „Drohende Kriegsgefahr“ Kriegsvorbereitungen. Kriegserklärungen. Ansprache des Grafen Spee. Schießübung. Kohlennehmen.
Am Mittwoch, den 15. Juli, um 4 Uhr nachmittags gingen die Panzerkreuzer in See. Während wir am folgenden Tage Schießübungen abhielten, fuhr der Geschwaderchef, der ein großer Naturfreund war, mit seinem weißen Motorboot in das unbewohnte Oroluk-Atoll. Statt der gesuchten Schildkröten fand er aber nur einen japanischen Schoner, der angeblich dort fischte und sehr unschuldig tat, als er entdeckt wurde. Westlicher Wind wuchs, während wir weiterfuhren, über Nacht zum Sturm, und Pforten und Fenster mussten im Achterschiff geschlossen werden, weil die See hoch auflief. Doch konnte unser Kommandant am 17. Juli, während wir die Insel Ponape ansteuerten, die Mannschaft auf den Gefechtsstationen besichtigen, womit die Ausbildung planmäßig zum ersten Abschluss kam. Wir hatten fleißig geübt und freuten uns der Anerkennung, die er uns aussprach.
Als wir gegen Mittag an Deck kamen, fesselte uns ein herrliches Bild: Im Süden standen im hellsten Sonnenlicht die wuchtigen Höhen von Ponape, und rings um uns, soweit das Auge reichte, war das Meer bedeckt von weiß- schäumenden, geschwinde mit uns laufenden Ketten von Wellenbergen, Bald drehten die Schiffe auf die Einfahrt zu und schlingerten nicht unerheblich in der nun querein kommenden See. Die grünbraune Masse der Berge löste sich allmählich in Wälder und Felsen auf, die ein einziger weißer Kranz umgab. Das war wieder das Außenriff, an dem der Stille Ozean in hohem Gischt seine Wogen sich brechen ließ, ein schon bekannter Anblick, aber immer neu, unaufhörlich, gewaltig. Mitten durch das Getöse der Brandung liefen wir in ruhiges Wasser. „Scharnhorst“ ankerte vor der kleinen Insel Langar, wo die deutsche Flagge über Palmen von den Gebäuden der Jaluit-Gesellschaft zu uns herüber grüßte, „Gneisenau“ unter dem langgestreckten Dschokadsch-Felsen. Das Korallenbecken, in dem wir lagen, war eng und tief, und wenn der Anker auch schließlich fasste, so hatten wir doch Riffe nicht weit vom Heck, wie wir uns auch in der nächsten Zeit auf den Wind legen mochten. Da das Wetter während unseres ganzen Aufenthalts in Ponape unbeständig blieb und starke Böen unsere ständigen Besucher waren, so mussten beide Schiffe in mehreren Kesseln Dampf behalten, damit die Maschinen nötigenfalls in kurzer Zeit angehen konnten. „Scharnhorst“ verlegte bald ihren Ankerplatz weiter nach draußen, wo sie aber auch noch mehrfach ins Treiben geriet.
Unsere Zeit hier hatte nur kurz sein sollen, aber der gesprächige Apparat erzählte wieder allerlei Erfreuliches und Unerfreuliches. Österreich wollte nun Ernst machen mit Serbien. Rüstung und Kriegsgeschrei klang durch die Welt, und bald war kein Zweifel mehr, dass wir da, wo wir waren, die Entwicklung der Dinge in Europa abwarten mussten. Priesen wir auch trauernd die Vorsicht, die uns nun wieder um Samoa zu bringen drohte, so hofften wir im Stillen doch weiter auf eine friedliche Lösung. Die Schöpfung rings um uns war wirklich zu schön für blutigen Krieg, und allerhand Aufgaben stellten sich ein.
Die Mannschaft hatte in den letzten Wochen recht heran gemusst, und es lag nahe, ihr auf diesem sauberen und gesunden Fleckchen Erde etwas Zeit zur Erholung zu gönnen. Gute Wege führten nach allen Richtungen ins Land. Besonders die Ansiedlung der Europäer bot hübsche Spaziergänge, ein kleiner Fluss, dreimal zu Becken gefasst, Gelegenheit zum Baden und Zeugwaschen. Der Schießstand der Polizeitruppe zeigte sich brauchbar zur Fortsetzung der Übungen mit dem Gewehr, und auf dem Exerzierplatz in der alten spanischen Zitadelle, der von schattigen Palmen und Hartholzbäumen eingefasst war, konnten die Seebeine wieder gerade gezogen werden. All dies in verschiedenartiger Vereinigung fand unsere Leute in der nun kommenden Woche viel an Land. Oft schickte ich ihnen das Mittagessen nach, und zwischen Dienst und Wasserplantschen verging ihnen sorglos der Tag.
Auch einige Ausflugsziele fanden sich. Ein Teil der Offiziere und Fähnriche besuchte die Ruinen von Metalanim. Ich konnte leider nicht mit dorthin, aber nach der Erzählung der anderen muss es eine beschwerliche Reise gewesen sein. Erst wanderte man zu Fuß mehrere Stunden auf guten Wegen; dann kam eine längere Wasserfahrt im Einbaum, der, wenn man nicht aufpasst, trotz des Ausliegers auch mal umschlagen kann, und das letzte Stück ging's bis zu den Knien durchs Wasser, weil die Flut schon eingesetzt hatte. Aber es lohnte sich wohl der Mühe, denn mannshohe dicke Mauern, kunstgerecht aus gewaltigen Basaltblöcken gefügt, ließen, wenn auch überwuchert von tropischem Grün, doch die Grundrisse einer weitläufigen alten Wohnungsanlage erkennen. Man kann sich vorstellen, wie das, so weit ab vom Wege der uns sonst bekannten alten Kulturen, auf einer kleinen Insel mitten im Stillen Ozean, auf den Beschauer wirken muss. Auf und ab geht es in der Geschichte der Menschheit, und Kampf, Sieg und Untergang folgen sich nach ewigem Gesetz. Ein Volk, das schwach wird, muss zurücktreten, damit ein stärkeres sich durchsetzen kann.
Von Kampf, wenn auch aus jüngerer Zeit, sprachen auch die anderen Orte, die wir aufsuchten, der Dschokadsch-Felsen und der Nankjov-Kegel, beide bekannt aus dem großen Eingeborenenaufstand 1910, den unsere Schiffe „Emden“, „Nürnberg“, „Cormoran“ und „Planet“ niedergeschlagen haben. Besonders der Dschokadsch zog uns an, denn wir hatten ihn täglich vor Augen. Er steht vereinzelt auf einer kleinen Insel, die er fast ganz ausfüllt, und die neuerdings durch einen Erddamm mit der Hauptinsel verbunden ist. Eines Morgens, kurz vor Sonnenaufgang, machten wir uns auf, ihn zu erklettern, einige Offiziere und Fähnriche und ein paar Matrosen. Vom Wege, der rings um den Felsen führt und die Dörfer der dort jetzt angesiedelten Mortlock-Leute verbindet, arbeiteten wir uns durch dichtes Unterholz empor. Dann ging's in einem steilen Felsspalt in die Höhe, und wieder durch dichtes Gestrüpp auf den Kamm, auf dem die aufständigen Dschokadsch-Leute sich damals festgesetzt hatten. Die Beschießung durch die Schiffe hatte ihnen nicht viel anhaben können, da sie in Höhlen Schutz fanden. Es musste daher gestürmt werden, und auf diesem Wege brachten die Landungsabteilungen der Schiffe ein Maschinengewehr hinauf, warfen den Feind und säuberten den Felsen. Über einen noch deutlich erkennbaren Schützengraben der Aufständischen erreichten wir schließlich durch hohes Gras die Kuppe, auf der ein Holzkreuz an die tödliche Verwundung eines Obersignalgasten erinnerte. Leider konnte nicht die ganze Mannschaft hierhergeführt werden; aber man muss solche Erinnerungen doch möglichst ausnutzen, um den kriegerischen Geist zu beleben, darum schickte ich später wenigstens das Signalpersonal hinauf. Der Geschwaderchef bestieg den Felsen in Begleitung seines Chefs des Stabes, Kapitän z. See Fielitz, und der Kommandanten. Auch manche andere Ausflüglergruppe fand sich durch den herrlichen Rundblick belohnt, der sie da oben erwartete. Im Norden der weite blaue Ozean, durch das weiß überschäumte Außenriff scharf abgeschnitten von den Korallenbecken, denen man fast bis auf den Grund sieht; im Süden die hohen Basaltberge von Ponape, und zu unseren Füßen, zwischen Mangroven und Palmen versteckt, braune Hütten und Häuser mit rotem Dach; auf dem Wasser hier und da ein Einbaum mit fischenden Eingeborenen, und friedlich zu Anker unsere stolzen grauen Schiffe. Darüber am Tropenhimmel ziehen weiße Wolken. Die Sonne, fast senkrecht über uns, lässt alles im grellsten Lichte erscheinen. Ruhig und andächtig wird der Mensch, wenn er von hoher Warte so ein Stück herrlicher Gottesnatur vor sich liegen sieht, und auch bei uns stellten sich ernste Gedanken ein, denn wir wussten, dass Österreich vor der Entscheidung stand und dass damit auch unser Schicksal sich bald erfüllen musste. Dann würden wir auch um diesen Boden zu kämpfen haben, der durch deutsches Blut geweiht war. Wurde doch während unseres Aufenthaltes drüben auf dem Kirchhof ein Denkmal errichtet, das „Scharnhorst“ mitgebracht hatte und das an den Gräbern der Gefallenen der Nachwelt erzählen sollte, wer hier in ehrenvollem Kampfe für sein Vaterland den Tod gefunden hatte. In Gegenwart von Abordnungen der Schiffe und der Polizeitruppe übergab es der Geschwaderchef persönlich dem Schutze der Kolonie.
Der Nankjop-Kegel, der fern aus dem Urwalde aufragte, und an dem die Aufständischen in fast unzugänglicher Stellung den deutschen Stürmern die meisten Verluste beigebracht hatten, war schwerer zu erreichen. Auch wuchsen nun die dienstlichen Anforderungen, so dass ein geplanter Übungsmarsch des Landungskorps dorthin schließlich unterbleiben musste. Nur eine kleine Gruppe schickte ich aus, die den Weg erkunden sollte. Aber noch manch fesselnde Einzelheit aus der Aufstandszeit hörten wir vom Regierungsarzt, der nach der Ermordung des Bezirksamtmannes, unterstützt von seiner Gattin, mit treugebliebenen Häuptlingen die Kolonie gehalten hatte, bis Hilfe kam.
Jetzt war es auf der Insel ruhig. Die Häuptlinge kamen zu Besuch in die Ansiedlung und auf die Schiffe, und der „König von Metalanim“, ein freundlicher, bejahrter Mann, erbot sich, Ruinenbesucher bei sich zu beherbergen. Der Rest der Dschokadsch-Leute lebte in Verbannung auf Yap. Wir sahen auch wieder allerlei Tänze, im Schein der Fackeln beim Bezirksamtmann oder nachmittags vor den gastlichen Hallen der Jaluit-Gesellschaft auf Langar, wobei auch unsere Geschwaderkapelle spielte. Ein Genuss ganz eigener Art aber zog sich durch diese Zeit, das war das Baden in dem Staubecken oben auf der Höhe. Täglich, wenn die größte Hitze vorbei war, fand sich dort eine lustige Gesellschaft zusammen, darunter auch oft der Geschwaderchef. Man konnte ein Stückchen flussaufwärts schwimmen, Kopfsprunge machen oder unterhalb des Wehres unter armdickem Wasserstrahl lalle Massagen haben; alles Freuden, die es an Bord nicht gibt, denn da ist „Frischwasser" ein kostbarer Artikel, dessen Abgabe genau geregelt wird. In verschiedener Güte, je nachdem es zum Waschen, zum Speisen der Kessel oder zum Trinken und Kochen bestimmt, wird es in den Zellen des Doppelbodens mitgeführt und so oft wie möglich ergänzt. In Tsingtau nahmen wir es an der Mole aus der Leitung der Stadt; in anderen Häfen bekommt man es in Prähmen längsseit, und manchmal fällt es auch vom Himmel. Wie es in den Tropen regnen kann, lässt sich schwer schildern. Geschwind zieht da eine Böe herauf, und aus dunkler Wolkenbank stürzt das Wasser hernieder, nicht in Bindfaden, wie zu Hause, es sind schon eher kleine Manila-Leinen. Schnell müssen die Steerte der Sonnensegel gelockert werden, damit sie nicht ausreißen, und die Wache, die dazu gepfiffen wird, erscheint praktischerweise gleich im „Anzug Badehose“, um mit munterem Lachen das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden. Es wäre schade, das köstliche Nass so einfach abfließen zu lassen. Deshalb wird es in Baljen und Pützen aufgefangen und vom Pumpenmeister schmunzelnd vereinnahmt. Auf langer Fahrt reicht aber auch das nicht aus. Letzten Endes könnte man natürlich Seewasser verdampfen. Das kostet aber Kohlen und geschieht in der Regel nur, solange man einwandfreies Wasser zum Trinken oder zum Gebrauch in den Kesseln anders nicht beschaffen kann. Auch hier kam uns wieder die Natur zu Hilfe, und in kaum unterbrochener Fahrt waren unsere Boote beschäftigt, um Süßwasser aus einer kleinen Bucht zu holen, in die es so reichlich floss, dass wir es schöpfen konnten. Einfach war aber auch das nicht, wegen des wechselnden Wasserstandes. Nur die Jollen konnten weit genug hinaufgelangen, und mit ihnen mussten die großen Boote weiter draußen gefüllt werden.
An unsere Boote wurden in dieser Zeit überhaupt starke Anforderungen gestellt, denn außer dem Wasserholen gab's täglich einige hundert Menschen hin und her zu befördern und zwischendurch noch manche unvorhergesehene Fahrt zu machen. Am besten bewährte sich, wie auch in den früheren Häfen, die große Motorbarkass. Sie war nicht schnell, fasste aber über 90 Mann oder entsprechend andere Lasten. Doch blieb es ihr, wie den anderen schweren Booten, der Ruderbarkass, Ruderpinass und den beiden Dampfpinassen, nicht erspart, ab und zu festzukommen, denn der Weg zur Landungsbrücke war flach und umständlich. Meist gingen dann die Leute ins Wasser und schoben: genügte das nicht, so musste Hilfe vom Schiff geschickt oder das Einsetzen der Flut abgewartet werden. Unser Stolz aber war der „Schwan des Ostens“, unser flinkes, weißes Motorboot, das allen Booten anderer Schiffe vorbeilief und in den Häfen Ostasiens ein wohlbekannter Gast war. Wie vom Auftreten des einzelnen Mannes auf die Besatzung, so wird, besonders im Auslande, vom Aussehen und der Führung der Boote auf das ganze Schiff geschlossen. Schließlich, wenn der alte Seemann auch sagt, „Was soll ich denn am Lande gehen? Ich kann dem Land vom Borde sehen!“ so nützt uns doch der schönste Hafen nichts, wenn wir ihn nicht näher in Augenschein nehmen können. Auch kommt mit dem Boot der frische Proviant an Bord, wofür jedermann ein großes Verständnis hat. Daher die Liebe und Fürsorge, die den Booten auf einem Kriegsschiff von allen Seiten zuteilwird.
Während wir so den verlängerten Aufenthalt aufs Beste zu nutzen suchten, um in diesem irdischen Paradies Körper und Geist zu stärken, festigte sich uns die Überzeugung, dass bald das Höchste von uns verlangt werden würde. Die Nachrichten aus der Heimat nahmen immer ernstere Form an, und eines Tages kam vom Flaggschiff der Befehl, die Schiffe gefechtsbereit zu machen „zur Übung“. Es sollte noch einmal geprüft werden, was für den Fall des Krieges vorgesehen war, aber: „Kosten dürfen nicht entstehen!“, wurde bestimmt; der Rahmen einer Friedensübung sollte nicht überschritten werden. Nun, das hatten wir ja gelernt, und bald türmten sich an einigen Stellen des Schiffes solche Gegenstände, die im Kriege hinderlich oder entbehrlich sind und daher vorher von Bord gegeben werden müssen. Andere wechselten ihren Platz, kamen hinter Panzerschutz oder wurden an Stellen niedergelegt, wo sie im Gefecht gebraucht werden. Die Geschütze wurden gründlich nachgesehen und viele andere Vorbereitungen getroffen. So arbeiteten wir am 28. Juli von morgens bis abends und am 29. Juli, bis wir fertig waren. Nachmittags kam dann der Geschwaderchef, der wohl schon mehr wusste als wir, zu einer kurzen Besichtigung an Bord. Der 30. Juli verging in Ruhe mit Aufräumungsarbeiten, und erst der 31. Juli machte Ernst aus der Übung, denn der Befehl „Drohende Kriegsgefahr!“ war in der Nacht aus Berlin eingegangen und bedeutete für uns zunächst „Auspacken, Sachen zur Jaluit-Gesellschaft auf Langar bringen!“
Da hob denn gleich wieder geschäftiges Treiben an. Leichter von Land kamen bei den Schiffen längsseit. Unsere Boote halfen mit, und über die Außendecks und mit den beiden großen Kränen wanderte von Bord, was sich da schon angehäuft hatte, und vieles mehr, was man bei Friedensübungen gern auf seinem Platz lässt, um es nicht zu beschädigen, was aber im Gefecht nicht minder die Splitter- und Brandwirkung einschlagender Geschosse vermehren kann, Raum wegnimmt, oder was man sonst gern los sein will. Kisten und Kasten, Sonnensegelstützen, Trossenrollen, Tauwerk, Inventarien aller Art, Abkommkanonen, überflüssige Geländerketten und -stützen, die beiden Backspieren, alte Rosteisen, die Modelle des Schiffes und der Maschinenanlage und taufend und aber tausend Dinge aus Lasten und Hellegatts verschwanden nach und nach. Besonders auf Holzwerk war es abgesehen. Alle hölzernen Spinde mussten von Bord. Der Speiseraum des Kommandanten wurde ausgeräumt; der Silberschrank, Bilder, Stühle, Teppiche kamen an Land. In den Kammern der Offiziere und Deckoffiziere blieben an Holzsachen nur der Schreibtisch und ein Stuhl. Auf dem Mitteldeck hatten wir einige Holzkammern, die für vorübergehende Zwecke eingebaut worden waren. Sie wurden den erschreckten Bewohnern gleich des Morgens fast über den Köpfen abgebrochen. Hei, wie die Äxte der Zimmerleute flogen! Es war Ernst diesmal mit dem Auspacken des Schiffes. Das große Wort war gesprochen, und nichts brauchte mehr angedeutet zu werden.
Nach den „Kaiserlichen“ Sachen ging‘s an die „Privatsachen“. Jeder Mann und jeder Offizier stellte eine Liste seines Eigentumes auf, die später mit der letzten Post zurückgelassen werden sollte. Es wurde genau befohlen, was an Bord zu behalten war, und das war kaum mehr, als die notwendige persönliche Ausrüstung, dazu Briefe und Bilder der nächsten Angehörigen und einige Bücher. Auf einem Heimatschiff ist das alles viel einfacher. Da führt man weniger Gegenstände mit sich und kann die überflüssigen leicht hilfreichen Händen an Land übergeben. Im Auslande dagegen füllt die kleine Kammer, was alles an warmen und leichten Sachen, an Wäsche und Kleidern, an Uniform und Zivil in Gesellschaft, beim Sport und auf Wache, in größter Hitze und größter Kälte gebraucht wird. Auch die Mannschaft hat da viel Zeug, und ihre Spinde müssen geschickt gestaut sein, wenn sie ausreichen sollen. Nun half das aber nichts. Gala und Goldstreifenhosen, Frack und schöne Sommeranzüge und manch anderes wohl behütetes, liebes Ausrüstungsstück war jetzt entbehrlich, und nur, was der Krieg erforderte, behielt eine Freistatt an Bord. Wobei natürlich auch an kühleres Klima gedacht werden musste, was bei unserer Lage — 30 Grad Celsius im Schatten — einiges Nachdenken er- forderte. Kap Horn? Brrr! Bis wir dahin kommen, ist der Krieg — überhaupt — längst — zu Ende! —
Übergibt man schon seine Garderobe nicht gern einem so ungewissen Schicksal wie der Lagerung in den Tropen, wo sie in Hitze und Feuchtigkeit verstockt und den weißen Ameisen zum Fraße dient, wieviel schwerer trennten wir uns von all den Einkäufen aus China und Japan, Manila, Hongkong und Java, die wir an Bord hatten. Mit welcher Umständlichkeit und Sorgfalt der Mann sein bisschen Geld da draußen in Mitbringsel für die Lieben daheim umsetzt, muss man wissen, um zu verstehen, dass es manchmal eines sehr ernsten Nachdruckes bedurfte, um ihn zur Hergabe seines Eigentums zu bewegen. Und uns Offizieren ging's nicht viel besser. Allmählich sammelt sich da allerlei in der Kammer an: schöne Vasen aus Porzellan und Bronze, japanische Tempellaternen, Elfenbeinschnitzereien, Seidensachen, Buddhas in jeglicher Ausführung, Lackrahmen und Schachteln, Bogen, Pfeile, Speere und andere Seltenheiten aus unseren Kolonien, Bilder aus Nord und Süd des Pazifischen Ozeans. Die ganze schöne Zeit, die wir auf der „Gneisenau“ verlebt hatten, zog noch einmal an uns vorüber, während wir all dies Hab und Gut in schnell zurechtgemachten Gemäßen unterbrachten. Manch stiller Wunsch ist da miteingepackt worden an Eltern und Geschwister, Gattin und Kinder, und die Hoffnung schlich sich ein, dass man beim Auspacken zu Hause doch dabei sein könnte!
Überhaupt die Heimat! Wir haben ihrer viel gedacht, und vor dem Gewaltigen, das dort sich vollzog, trat uns unser eigenes kleines Schicksal zurück. Konnten wir auch nicht jubeln und jauchzen im Zuge der Menge, die unter dem Eindruck des schnöden Angriffs sich zusammenschloss und, Vaterlandslieder singend, die Straßen füllte, so fühlten wir doch den Geist der Stunde, ruhig und gemessen zwar, denn wir arbeiteten schwer im glühenden Tag. Und wenn es dunkel geworden, war es still um uns her. Kein Lichtschein drang nach außen. Die Wache spähte in die sternklare Nacht, und Scheinwerfer und Geschütze waren besetzt. Wohl leuchteten auch bei uns die Augen, wenn man mit den Leuten sprach; aber es war mehr eine stille, innere Glut, die den einzelnen erfüllte, das Bewusstsein, bald etwas Bedeutendes erleben zu sollen, das noch nicht ganz zu fassen war. Zu einer anhaltenden, großen Freude, zu einer „Begeisterung, größer als 1870“, die aus Deutschland zu uns herüberklang, hatten wir offen gestanden in diesen Tagen keine Zeit, weil wir nach Weltmeerbegriffen, noch ehe der Krieg recht begonnen hatte, am Feinde waren. Wir hörten seine Funkenzeichen und schlossen daraus, dass er nicht allzu fern an uns vorüberzog, und wir mussten sorgen, dass er uns nicht entdeckte dort zwischen den Riffen, wo emsiges Schaffen uns noch festhielt.
Auf diese Art erlebten wir auch den 2. August. Der Sonntag hatte keine Ruhe gebracht; Gottesdienst abzuhalten war nicht möglich gewesen. Ich wollte gerade zur Koje gehen, als der Adjutant hereinstürmte und meldete: „Mobilmachung gegen Russland und Frankreich befohlen!“ Da hatten wir endlich die Gewissheit, nach der jeder sich sehnte. Die Mannschaft zusammenzurufen, war es zu spät; sie brauchte den Schlaf, um morgen wieder frisch zu sein. Aber in den Messen war man noch auf oder kam wieder zusammen, um sich die Hand zu drücken; es war eine ernste, gehobene Stimmung. In der Frühe vor Beginn des Arbeitsdienstes hieß es dann „Alle Mann auf die Schanz‘!“ Der Kommandant gab der Besatzung den Mobilmachungsbefehl bekannt und schloss seine markige Ansprache mit „Drei Hurras für Seine Majestät den Kaiser!“ Und mittags kam der Geschwaderchef an Bord und ermahnte in feurigen Worten die Leute, jetzt ihren Treuschwur wahr zu machen im Dienste für Kaiser und Reich. „Vorläufig sind nur Russland und Frankreich unsere Gegner. Englands Haltung ist noch ungewiss, aber doch unfreundlich. Wir müssen daher auch englische Schiffe als Feinde betrachten!“ Hochaufgerichtet stand der Admiral zwischen den gehobenen Mündungen der Geschütze des achteren Turms, und die buschigen Brauen zogen sich zusammen, als er das sagte. Voll Vertrauen schauten wir auf zu unserem Führer, blickte der Sohn auf zum Vater, denn sein Jüngster, Gras Heinrich, war ja einer von uns. —
Am 4. August gingen „Scharnhorst“ und „Gneisenau“ zu einer kurzen Kaliberschießübung in See. Gegenseitig schleppten wir uns die kleine Scheibe, die auf der Dünung tanzte, dass sie manchmal kaum zu sehen war. Vor Dunkelheit waren die Schiffe wieder zu Anker auf ihren Plätzen, denn morgen sollte noch einmal gekohlt werden. Ob die „Fukoku-Maru“ sich über unser Gebaren schon Gedanken gemacht hatte, weiß ich nicht. Jedenfalls hatte sie keine Funkentelegraphie, und es wurde aufs strengste dafür gesorgt, dass sie in Unkenntnis der Lage blieb. Ein Beauftragter der Firma, die den Dampfer für uns gemietet hatte, ein Deutscher, war darauf eingeschifft. Ihm fiel es zu, wenn wir erst ausgelaufen wären, mit dem Japaner nach Samoa zu gehen, was ja nach dem Vertrag für die Friedensreise vorgesehen war, und dadurch nach Möglichkeit zu verhindern, dass über unseren Aufenthalt in Ponape zu früh etwas in der Welt bekannt werden könnte. Beneidet haben wir ihn nicht um diese Fahrt, denn er hatte auf dem Schiffe schon vorher allerlei Erlebnisse gehabt. Die Mannschaft wollte ihm nicht wohl und hatte einmal sogar angedeutet, dass sie ihn ganz gerne über Bord werfen würde, was er mit nicht misszuverstehender Handhabung seiner Mauserpistole beantwortete. Er ist aber in Apia angekommen und hat sich mit der Erledigung seines Auftrages fraglos ein großes Verdienst erworben. Später ist er leider den Engländern in die Hände gefallen, und die Briefe, die er zur Besorgung über das amerikanische Tutuila mitgenommen hatte, sind bis heute nicht angekommen.
Vormittags am 5. August kohlte „Scharnhorst“, und nachmittags füllte „Gneisenau“ die Bestände auf. Während die Arbeit im Gange war, kamen die Väter der Kapuzinermission an Bord. Die katholischen Mannschaften versammelten sich unter der Back, schwarz wie sie waren von der Arbeit, und gingen zur Beichte im seemännischen Unteroffizierraum. Wir benutzten diesen Tag auch, um endlich die Offiziermesse kriegsmäßig herzurichten. Holzwerk und Tapetenverkleidung, die Hitze und Kälte uns abgehalten, flog über Bord, und es entstand ein Bild der Zerstörung. Wo wir in fröhlichem Kreise auf schönen Sofas gesessen, stolperte man über Schienen und Winkel; rotgestrichene Eisenwände starrten uns an und die kahle Decke, von der die Drähte der elektrischen Beleuchtung lose herunterhingen. Das Büfett ersetzten wir durch Blechschränke aus dem Schiffslazarett. Außer Tischen und Stühlen behielten wir nur das Klavier zurück; etwas Musik musste man gelegentlich doch machen können. Als einziger Schmuck blieb das Bild unseres Kaisers hängen. Es war aber gut, dass Platz geschaffen wurde, denn unsere zwölf Fähnriche grüßten seit zwei Tagen mit der Hand an der Mütze und waren nun Mitglieder der Offiziermesse; der Krieg hatte ihnen vorzeitige Beförderung gebracht. Sie waren wohl diejenigen unter uns, die am sorgenfreiesten und frohesten in die Zukunft "schauten; unsere Leutnants, auch die älteren, haben sich bis zum Schluss dies heitere Vorrecht der Jugend bewahrt.
Unser Abendbrot nahmen wir etwas feldmäßig auf der Schanze ein, während Eingeborene in ihren Ausliegerbooten das Schiff umkreisten, um ein Stück weißlackierten Holzes, gelber ober blauer Tapete zu erhaschen als Schmuck für ihre Hütten. Der scharfe Rücken des Dscholadsch verschwamm im Dunkel der Tropennacht, und statt des Sonnensegels wölbte sich über uns das klare südliche Sternenzelt. Von vorne drangen der Lärm des Kohlens, das Rasseln der Winden, zischender Dampf und abgerissene Teile der Musik, und wir sprachen, was uns bewegte, und welchen Lauf die Dinge nun wohl nehmen würden. Mancher glaubte noch immer, dass England sich des Kampfes enthalten würde, um wieder im Trüben zu fischen wie schon so oft. Doch wurden wir bald aller Zweifel enthoben, denn mitten in dies Kriegsleben hinein kam die Nachricht, dass die Briten sich unseren offenen Feinden zugesellt hatten. Wieder konnten wir der Mannschaft nichts davon mitteilen, weil der Japaner noch längsseit lag; aber die Offiziere versammelten sich doch, schwarz vom Kohlenstaub, für einen Augenblick in der Messe, und wir tranken einen kräftigen Schluck darauf, dass dieser Raubzug unseren Herrn Vettern schlecht bekommen möge! Jetzt wussten wir, woran wir waren, wenn es auch noch nicht alles war, was uns bevor- stand. Und wieder gingen die Gedanken heimwärts, wo meine Mutter Geburtstag hatte — ein schönes Geschenk fürwahr —, zum alten Vater, der in drei Kriegen mitgeholfen hatte, das Reich zu bauen, dessen Voraussagen aber, dass es einmal so kommen müsste, ich nie recht hatte glauben wollen; zu Frau und Kindern. Frankreich und Russland, das wäre ein fröhlicher Krieg gewesen, mit denen wären wir auch hier draußen schnell fertig geworden. Jetzt, von Übermacht umgeben, wohin wir auf dem Weltmeer blickten, überkam uns alle ein merkwürdiges Gemisch von Stolz und Wut: von Stolz ob der großen Meute, die man für nötig hielt, um Deutschland niederzubeißen, und von ingrimmiger Wut über die Tücke, mit der man sie auf uns hetzte! Und ohne den Wunsch, sein Leben so teuer wie möglich herzugeben, ist wohl keiner von uns an diesem Abend zur Ruhe gegangen. „Two years more, we have it!”, es war schon etwas dran. —