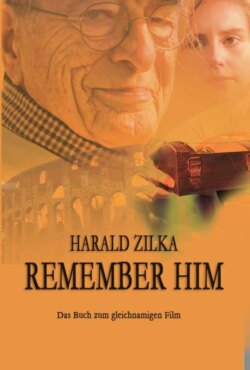Читать книгу REMEMBER HIM - Harald Zilka - Страница 6
KAPITEL 2 Der Mann mit dem Trenchcoat
ОглавлениеAlbrecht bog wie fast jeden Tag vom Hauptweg zu den Ehrengräbern ein, um auf die Hügelspitze des Friedhofs zu gelangen, wo das Grab seiner Familie lag. Er war dreiundsiebzig Jahre alt und sein Gesicht war tief zerfurcht, wie die Rinde eines alten Baumes. Als hätte sich jedes Lebensjahr in sein Gesicht eingegraben. Er hatte einen starken, aufrechten Gang und strahlte etwas aus, das man durchaus als Stärke bezeichnen konnte. Eine abgenutzte, graubraune Lederkappe bedeckte den Kopf und der Knoten seines Schals war nach moderner Art geschlungen. So modern, wie man es bei einem Mann in Albrechts Alter gar nicht erwartet hätte. In seiner rechten Hand hielt er die Plastiktasche fest im Griff, ein billiges Werbegeschenk von einer Ferienmesse. Albrecht hatte einige Zeit lang diese Messen besucht und sich Angebote bei verschiedenen Destinationen angesehen, ohne je den Mut aufzubringen, alleine eine Reise zu buchen. Die einzige Reise, die er seit einiger Zeit wieder auf sich nahm, war ein täglicher Spaziergang zum Friedhof. Er kam inzwischen fast jeden Tag. Das war nicht immer so gewesen. Hinter dem aufrechten Gang und dem kräftigen Blick verbarg sich das Herz eines Menschen, dem im Leben nichts geblieben war. Er hatte viele Rückschläge und Enttäuschungen verkraftet, sogar den Tod seiner großen Liebe überlebt, ohne daran zu wachsen. Die wenigen Freunde, die er hatte, waren gestorben. Einer nach dem anderen. Kontakt mit diesen Menschen hatte er zuletzt wenig gehabt, meistens erfuhr er von ihrem Tod durch Zufall. Und es wurden immer mehr. Sein Leben war wie ein Ausflug auf eine Insel geworden. Nachdem er sich durch das dichte Gestrüpp zum Strand zurückgekämpft hatte, musste er feststellen, dass sein Schiff am Horizont davonsegelte. Der Gedanke, ein Leben gelebt zu haben, das praktisch keine Spuren hinterließ, gab ihm den Rest. In dieser Situation befinden sich viele alte Menschen, nur denkt man nicht oft darüber nach. Nicht allzu viele sind in der glücklichen Lage, das Alter in einem wohlbehüteten Familienverband zu verbringen. Das war eine Sache, die Albrecht stets in südlichen Ländern bewundert hatte. Die Vorstellung, dass mehrere Generationen im Schatten der Olivenbäume ein einfaches Mahl zu sich nehmen, wie Oliven aus Sizilien, Wein aus der Toskana oder Tomaten aus Umbrien, entsprach einem romantischem Ideal. Es entsprach nicht ganz der Wahrheit, sowenig wie das Leben in Venedig mit all den Fluten und feuchten Palazzos romantisch oder das Auskommen der Familien in Italien oder Griechenland leicht zu ertragen ist. Als Tourist bemerkt man das meist gar nicht. Aber natürlich funktionierte in diesen südlichen Ländern ein Generationenvertrag, der in Resteuropa lange nicht mehr galt. Gerade die italienische Kultur, sofern man die unterschiedlichen Regionen überhaupt zu einem Land zusammenfassen kann, hatte die starke Familienzugehörigkeit aus der Not heraus gebildet, zu überleben. Das war in Albrechts Familie nicht anders gewesen, weil er vom Land kam. Wenn man Ende der dreißiger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts geboren war, hatte man durch den Krieg sowieso schon die Hälfte des Lebens verloren und musste froh sein, wenn man den Wahnsinn überlebt hatte. Als die wirklich Besten seiner Jahre hätte Albrecht die Siebziger und Achtziger bezeichnet, allerdings versanken auch diese längst im Schleier der düsteren Erinnerung. Es war erschreckend, wie schnell man so lange leben konnte, dass man Teil der Geschichtsbücher und Ereignisse eines ganzen Jahrhunderts sein konnte. Albrechts Großmutter war in ihrer Kindheit noch nach Wien gefahren, um den Kaiser Franz Josef in seiner Kutsche zuzuwinken. Mit ihm schloss sich der Kreis eines Jahrhunderts. Wenn man auf dem Friedhof spazierte, rückte dieses Gefühl stärker ins Bewusstsein. Die Fotos auf den Gräbern und die eingravierten Namen erzählten vom Leben und Leiden. Der Friedhof, fand Albrecht, war ein Ort, an dem alle Schicksale gleichgemacht wurden. Wie die Flut den Strand glättet und die Sandburgen des letzten Urlaubstages wieder abträgt, spielte es am Ende des Lebens wenig Rolle, was man erduldet und erlebt hatte. Die Leiden und das Lachen des Lebens, die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten, die lauen Sommerabende wie die knirschend kalten Winternächte - alles wurde ausgelöscht vom Tintenkiller des Lebens. Das gab dem Leben eine andere Bedeutung. Es machte vergänglich, wie ein Umsteigebahnhof, in den man einstieg, ein paar Stationen fuhr und dann wieder ausstieg, ohne sich an Begegnungen zu erinnern. Bei den täglichen Spaziergängen verbrachte Albrecht viel Zeit damit, sich die Namen und die Bilder auf den Grabsteinen anzusehen und darüber nachzudenken, was diese Menschen wohl erlebt hatten. Bei manchen Inschriften, die Details über schweres Leiden oder langer Krankheit offenbarten, war das möglich. Andererseits gefiel Albrecht nicht, einem Menschen auf die letzte Tafel nichts anderes zu schreiben, als die vielleicht schlimmsten Leiden seines Lebens. ›Nach langem Leiden‹ und ›nach langer, schwerer Krankheit‹ verwischten die fröhlichen Momente eines Lebens und zeugten nur mehr von einem Martyrium.
Der Gedanke an den Tod erschreckte Albrecht nicht. In gewisser Weise fühlte er sich bußfertig, ›fertig zum Abholen‹, wie er lakonisch sagen würde. Wenn man darauf wartete, dass es Abend wird und den nächsten Tag erwartete, um es wieder Abend werden zu lassen, ist der Zyklus überschaubar. Dabei war er nicht der Ansicht, dass er viel verpasst hatte oder Dinge erledigen musste. Er wollte keine Tour durch die Sahara machen und niemals den Jakobsweg, den Camino de Santiago bewältigen. Obwohl das nicht geschadet hätte. Menschen, die nicht besonders religiös sind, werden die Vorstellung, tagelang den spanischen Pilgerweg zum Grab des Apostels Jakobus zu wandern sowieso lachhaft finden. Von jenen Menschen, welche die Reise machten, hört man aber auch, dass nicht der Glaube sondern die Zeit mit sich selbst, eigene Gedanken und die Natur die innere Reinigung bewirkten. Wahrscheinlich hätte sich Albrechts Leben also verbessert, wenn er sich den Dämonen seines Lebens gestellt hätte. Der biografische Horizont eines Menschen reicht fünfzehn Jahre zurück in die Vergangenheit und fünfzehn Jahre nach vorne, sagt man. Wer fünfzig ist, teilt eine Menge Generationserfahrung – zum Beispiel Erinnerungen an Filme, Hits und Fernsehserien – sowohl mit den 35-Jährigen als auch mit den 65-Jährigen. Mit noch jüngeren und noch älteren Menschen hat man in dieser Hinsicht nicht mehr viel gemeinsam.
So mag die heutige Generation vielleicht noch Dallas oder Knight Rider auf einer Erinnerungsseite entdeckten, aber kaum Grace Kelly, Audrey Hepburn oder Deborah Kerr kennen. Mit Fünfzig erreichen die meisten im Beruf den Höhepunkt ihrer Laufbahn. Die Jugend ist vorbei, aber noch in Sichtweite und das Ende gleichzeitig schon bedrohlich nahe. Danach kommt es häufiger vor, dass man in einen Raum tritt und der Älteste ist. Zu diesem Zeitpunkt muss man Frieden mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten geschlossen haben, sonst hat man keine Möglichkeit, noch glücklich zu leben. Die Spuren im Sand, sagt man, verwischt das Meer mit jeder Welle der Flut, selbst die Spuren im Schnee schmelzen, wenn das Licht der Sonne stärker wird, als die Winternächte kalt sind. Keine Spuren hinterlassen zu haben, wirft die Frage auf, wofür man gelebt hat. Albrecht, der in seiner Beziehung der Ältere gewesen war, hatte gar nicht damit gerechnet, dass er noch jemanden zu Grabe tragen würde. Er hatte ganz im Geheimen, gehofft, dass er als Erster gehen würde. Das liegt daran, weil er ein empfindsames Gemüt hatte und sich zu schwach sah, als Erster einen derartigen Verlust zu überstehen. Sein Wunsch ging nicht in Erfüllung. Seine Liebe starb völlig unerwartet, völlig bescheuert und viel zu jung. Er dachte immer, dass es nichts Schlimmeres gibt, als einen geliebten Menschen zu verlieren. Es stellte sich heraus, dass es nicht so ist. Viel schlimmer als der Verlust ist das Leben danach.