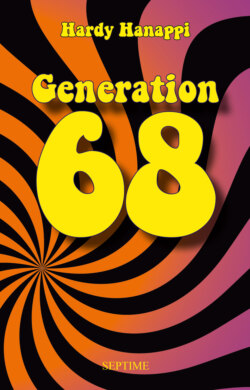Читать книгу Generation 68 - Hardy Hanappi - Страница 5
ОглавлениеII. Musik
Wie Menschen sich zu Gruppen verbinden, ist immer mit ihren Möglichkeiten zur Kommunikation verbunden. Was sie teilen und gemeinsam als Schablone zur Gruppenidentität annehmen, ist Sprache der Gruppe. Sie tritt in vielen Formen auf, Musik war für die 68er-Generation die wichtigste davon.
Musik kam aus dem Radio, Musik kam von der Schallplatte – und zwar in dieser Reihenfolge. Die unsichtbare Botschaft der kulturrevolutionären Internationale wurde über die Insidern bekannten Radiostationen erforscht, etwa Radio Luxemburg, und »unsere Musik« als neues Idiom in den Sprachschatz der künftigen 68er aufgenommen. Radiowellen kennen keine Grenzen, und der englische Gesang brauchte auch gar nicht so gut verstanden zu werden, Lautmalerei reichte, solange der Beat stimmte. Daher war die Identifikation des »Beat« das Zentrale. Es gab nur einen Beat der 68er, doch er hatte unzählige originelle Variationen. Und offensichtlich war die Sprache des Beat der älteren Generation völlig verschlossen. Sie reagierte mit Kopfschütteln, verlangte das Reduzieren der viel zu hohen Lautstärke und verwies auf das Fremde in dieser »Negermusik«. Es war klar, dass diese Feindschaft in Bezug auf »unsere Musik« die 68er einte, nichts verbindet mehr als ein gemeinsamer Feind. Der Nachteil von Radiosendungen ist die Flüchtigkeit ihrer Existenz, hat man sie gehört, so sind sie verpufft. Das entspricht zwar dem Wesen von Musik, und mit Erinnerungsvermögen begabte Wesen können ja einiges in sich wachhalten, die Vergänglichkeit des Erlebnisses schmerzte aber doch. In genau diese Kerbe unbefriedigten Bedürfnisses rückte denn auch das erste Bataillon der Firmen vor, das die anschwellende Kulturwende erahnte: die Plattenindustrie. Durch den Erwerb der schwarzen Vinylscheiben war man im Besitz der Musik, konnte sie sich nach Belieben vorspielen und darin – allein oder in Gruppen – schwelgen.
Es war ein welthistorisch neues Phänomen, dass sich eine globale Kulturrevolution über das Medium der Musik ausbreitet. Gesprochene und geschriebene Sprache eint diejenigen, die sie teilen, – und trennt sie zugleich von anderen Sprachgemeinschaften. Die über viele Generationen reichende Sprachgemeinschaft ist der Nährboden nationaler Kultur, ja die wesentlichste Komponente der Herausbildung dessen, was als Nation Geltung beansprucht. Bei Musik ist die Sachlage einigermaßen anders: Zwar spielen auch hier die über lange Zeiträume tradierten und geographisch beschränkten musikalischen Hörgewohnheiten eine Rolle, sie über Bord zu werfen ist aber wesentlich leichter, da Musik immer schon ein Element der Muse war. Selbst – und gerade – der Blues, den die Baumwollpflücker während ihrer Arbeit sangen, konterkarierte die Eintönigkeit ihrer beschwerlichen Arbeit, hob deren Rhythmus in sein dialektisches Gegenteil. Musik kann geographische Grenzen stets leichter überqueren als Sprache, weil sie, zumindest in ihrer instrumentalen Form, nicht übersetzt zu werden braucht. Und die Lyrics bleiben Beiwerk, nationales Beiwerk, beim Beat der nichtanglophonen 68er oft auch nicht einmal verstandenes Beiwerk. Im Mittelpunkt der Musik steht nicht wie sonst im Leben der Arbeitsprozess und die Regeneration davon, sondern der Gegensatz zwischen Rhythmus (Struktur) und Melodie (Freiheit von Struktur). Das Paar »Rythm and Blues« fängt das insofern ein, als der auf Repetition, Wiedererkennung und orientalische Mystik derselben setzende Rhythmus ein Gefühl freisetzt, eben den Blues, den man hat, der in einer über den Rhythmus gelegten Melodie seinen Ausdruck findet. Beide Elemente durchdringen einander, der Rhythmus stolpert stellenweise in frei generierte Spannungsfelder, die Melodie gefällt sich in eitlen Wiederholungen. Schon beim Wiener Walzer ging der Zauber seiner Wirkung von diesem Wechselspiel aus; von ihm führt ein direkter Weg zum Swing der frühen 50er Jahre. Doch Beatmusik ist anders als dieses Abheben vom Alltag, das in Walzer und Swing so präsent ist. Es ist keine Verzierung für Mußestunden, es ist Kampfansage an diesen Alltag, Kampfansage an die Trennung zwischen entfremdeten Arbeitsstunden und Freizeit, in der das wahre Leben zugleich Erholung vor dem nächsten Arbeitstag sein soll. Dieses Aufbegehren gegen den gesamten herkömmlichen Lebensstil war daher vor allem den Jungen – Schülern, Studenten und jungen Arbeitslosen – vorbehalten. Der Pariser Mai und die Schülerrevolten in Italien zeigen beides, dass befreiende Radikalität auch ein gewisses Maß an jugendlicher Naivität erfordert und dass diese dann auch wegen dieser erfrischenden Unbedarftheit im kulturellen Bereich versandet.
Die Phrasen vom jugendlichen Mick Jagger und John Lennon, ob musikalisch oder im Interview, sind hingerotzte Kommentare und keine Symphonien, keine Weltentwürfe. Letztere hätten ihren Fans auch sicher nicht gefallen. George Harrison war ein Meister des zum kurzen Gitarrensolo gewordenen, einprägsamen Understatements. Damit schienen sie zwar nahtlos an die cooleren Typen der 50er Jahre anzuschließen, doch das konnte nur jenen so vorkommen, die damals nicht dabei waren: Elvis Presley war kein Beat, Beatles und Rolling Stones waren Beat! Die gefühlte Trennlinie war so scharf, dass sich die Beatles erlauben konnten Besame Mucho zu intonieren.
In den frühen Jahren war es auch selbstverständlich, dass Beatmusik von einer kleinen Gruppe, von vier oder fünf Musikern, gespielt wurde. Das ermöglichte das einfache Heraushören des Beitrags jedes einzelnen Bandmitglieds. Hierarchie, wie die des Dirigenten bei einem Orchester, war nicht nötig. Stattdessen gab es außerhalb der Musik einen Leithammel für die Vermarktung, den Bandleader. Der klassische Nukleus bestand auch in Bezug auf die Instrumente aus einem fixen Set: Rhythmusgitarre, Sologitarre, Bass und Schlagzeug – Ausnahmen bestätigten die Regel. Ganz entscheidend war auch die gesteigerte Lautstärke, Beatmusik musste laut sein, sehr laut. Man musste die Schallwellen körperlich spüren. Gespräche im Publikum gab es nicht, was es gab, war die Identifikation mit der Band, mit deren Musik, mit der Umsetzung des Erlebten in Tanz. Der Tanz zum Beat ist das Gegenteil des hergebrachten, regelgebundenen höfischen Tanzes, er ist spontan und entspricht der Persönlichkeit der Ausführenden im Zusammenspiel mit dem Ausdruck der gehörten Musik. Weil er im Kollektiv geschieht, ist er in aller Regel auch kein Paartanz. Im Beatkeller wogt die Masse, das gesellschaftlich abgesegnete, peinliche Balzritual zwischen Mann und Frau, wie es vom Menuett bis zur Polka tradiert wurde, ist plötzlich meilenweit entfernt. Beat und Tanz sind genauso untrennbar verbunden wie die Band und die Zuhörer, die sie bewegt.
Musik existiert nur in der Zeit, in der sie geschieht. Man kann sie zwar wiederholen, aber sie ist wie der sprichwörtliche Fluss, in den man nicht in gleicher Weise zweimal steigen kann. Ihre Verbundenheit mit den sich fortlaufend ändernden Musikern und ihren Zuhörern zwingt ihr ebenfalls stete Veränderung auf. Weil das besonders beim Beat auftritt – bei klassischer Musik hingegen hat die perfekte Reproduktion des immer gleichen Musikstücks, i. e. Werktreue, höchste Priorität –, entspringen daraus zwei interessante Phänomene. Zum einen wird die Virtuosität der Musiker weniger an ihren technischen Fähigkeiten als vielmehr daran gemessen, wie gut es ihnen gelingt, ihr Publikum in den Bann ihres Beat zu ziehen. Zum anderen bewirkt die Identifikation von Zuhörern und Musikern, dass eine ganze Generation beginnt die zentralen Instrumente des Beat – Gitarre, Bass und Schlagzeug – zumindest ansatzweise zu erlernen. Und so laufen heute noch Scharen von 68ern herum, die mit diesen Instrumenten etwas anfangen können. Auch darin unterscheiden sie sich von jenen, denen von den Eltern Klavier- oder Geigenunterricht aufgezwungen wurde oder die am Land zur Blasmusik vergattert wurden. Wo uns das als Kind drohte, sind wir davor in unsere eigene Musik geflüchtet.
Der frühe Beat der Beatles und der Rolling Stones war aber erst der Anfang. Wo vor allem bei den Beatles zunächst noch recht lieblich vom Händchenhalten und dem Liebesbekenntnis gesungen wurde, da brach sich schon bald der Brunftschrei nach Befriedigung, die Satisfaction Jaggers, seinen Weg. Die Beatles reagierten unverzüglich und überraschend: Sie hoben das Thema Liebe vom traditionellen Niveau des Schmachtens eines Mannes nach der Liebe einer bestimmten Frau auf das Niveau breiter, alle Menschen umfassender Liebe. Der »Summer of Love« in Kalifornien war in ihrer Hymne All You Need Is Love inkludiert. Ihre Musik blieb zwar stets ein wenig Zuckerlmusik, wenn auch mit originellen und oft gewagten Accessoires garniert, aber gerade dadurch gelang es ihr, mit parapolitischem Inhalt in die Gehirne der jungen 68er einzudringen. Bei den Stones hingegen bilden das Brechen von Widerstand, also Gewalt, und das frivole Spiel mit dieser das Einfallstor in die Seelen der Jugend. Sie erscheinen dem Establishment deshalb viel rascher als Feindbild, sie sprechen dessen Sprache. Die Stones haben als Band bis heute überlebt, die Beatles sind mit dem Tod John Lennons von der Bühne verschwunden. Zwei Heldensagen, die aus musikalischer Sicht die zwei komplementären Pfeiler des Beat widerspiegeln:
Das eine Fundament ist das gemeinsame Lied, das die Beatles mit ins Ohr gehenden Melodien und Texten dem Beat eingepflanzt haben. Voll mit Überraschungen, neuen musikalischen Wendungen, originellen Ideen. Letztlich zeigt sich in den wenigen Jahren ihrer Entwicklung (1962–1970) eine ungeheure Vielfältigkeit bis hin zum Zerfall in vier Individualisten – sie stehen für die offene, unverfrorene Suche bis hin zum raschen Aufgehen in zielloser Diversität. Parallel dazu steht bereits am Beginn der Stones das puritanische Streben nach dem wahren R&B. Aus dem Drang, der Wurzel möglichst nahezukommen, entspringt der Begriff des eigenen, unverkennbaren Stils. Die Stones sind eine Kerntruppe (Jaggers–Richards–Jones) mit zwei nahen Trabanten (Watts–Wyman). Sie sind der Inbegriff von Identität, wenn sie überhaupt irgendetwas entdecken, dann ist das nur noch mehr von ihrem Stil. Dieses zweite – nur scheinbar entgegengesetzte – Fundament des Beat, das Kontinuierliche, ist ebenso wichtig wie das Explorative.
Auf eben diesem zweifachen Element explodierte schließlich in der zweiten Hälfte der 60er Jahre das Elementarereignis Jimi Hendrix. Im Bewusstsein derer, die von ihm erfasst wurden, nimmt seine Musik eine absolute Sonderstellung ein. Dabei kam sie vielen 68ern im ersten Moment etwas unverdaulich vor. Der leichte Schwung der fast schon allzu vertrauten Kadenzenmusik der frühen Beatgruppen hatte es sich in den Ohren bequem gemacht. Selbst wenn die Beatles ein wenig LSD-inspiriert neue Klangerlebnisse ausprobierten und die Stones auf mehr Härte pochten, so blieb ihre Musik doch stets im Rahmen, stellte nur beschränkte Ansprüche an die Aufmerksamkeit. Die Droge Hendrix war da ein grundlegend anderes Kaliber. Er vereinte gleich mehrere Träume der Zeit und verschmolz sie in einem Tornado musikalischen Exzesses. Hendrix ist Solist, auch wenn er seinen Leuchtturm auf einem Teppich aus Akkorden und Rückkopplungen errichtet. Er hatte ein Leben voller Erfahrungen – die Jimi-Hendrix-Experience, die Band of Gypsys – hinter sich, als er starb. Als Hintergrundmusiker hatte er durch den Süden der USA getingelt, in Vietnam war er gewesen, in seinen Adern floss schwarzes und indianisches Blut, ebenso der unbändige Drang nach Freiheit, der so viele junge Amerikaner aller Hautfarben in dieser Zeit bewegte.
Der Weg vom anonymen Bandmitglied zum Zentrum seiner Powergroup war aber auch ein Beispiel für eine etwas allgemeinere Entwicklung musikalischen Zusammenspiels. Die Bands vor den 60er Jahren spielten gerne bekannte Nummern, deren Wiedererkennungswert ihnen jedenfalls Aufmerksamkeit im Publikum garantierte. Das galt insbesondere auch für die Bigbands des Jazz. Während dort dann einzelne Solisten zwischenzeitlich glänzen durften, existierte parallel die Welt der prominenten Musikstars. Schlagerstars produzierten Hits, die sie bald gemäß ihrem Rang in Hitparaden als Stufen ihrer persönlichen Karriereleiter benützten. In der Welt der Musikstars war der einzelne Song dem Schlagerstar nachgeordnet. Stand hingegen der bekannte Song im Vordergrund, so wurde die Band gemäß der Qualität ihrer Interpretation beurteilt. Damit man sich dennoch einen Namen merkte, gab es einen Bandleader, der das Ensemble repräsentierte. Die frühen englischen Beatbands funktionierten ähnlich. Sie waren zwar prinzipiell kleiner als die Bigbands des Jazz oder die Rembetiko-Gruppen Griechenlands, aber wie dort diente meistens auch der extrovertierteste Musiker als Kopf der Gruppe, während darunter weitgehend Gleichberechtigung herrschte. Die Demokratie des Jazz ging aufgrund der Betonung freier Improvisation noch einen Schritt weiter. Üblicherweise wurden jedem Bandmitglied einige Takte zum ganz persönlichen Ausleben und Darbieten seiner musikalischen Ideen, seiner Interpretation eingeräumt. Interessant ist, dass während eines solchen Solos die anderen Bandmitglieder nicht unbedingt still bleiben mussten. Die Kunst des Beitragens von Akzenten im Zuge des Zuhörens zeichnete gute Musiker aus, selbst wenn sie gerade nicht im Vordergrund standen. Im Idealfall konnte dann eine zum Dialog ausgewachsene musikalische Konversation zweier Bandmitglieder zum nächsten Solo führen – oder die Wiederaufnahme des Themas einläuten. Musik als Sprache hebt menschliche Kommunikation in eine neue Sphäre, die Dialektik des Miteinander in der Musik ist eine ganz spezielle Erfahrung. Fast scheut man sich, darüber in profaner Sprache zu schreiben. In der Generation 68 ist der Funken dieser speziellen Erfahrung auf das Publikum übergesprungen, alle haben sich mit den Musikern identifiziert, alle sind Musiker geworden. Die englischen Beatbands haben das ermöglicht, indem sie die hohen technischen Ansprüche der Jazzer auf ein tieferes Niveau heruntergeholt haben. Der wichtigste Hebel dafür war schlicht und einfach der laute und eindringliche Beat selbst. Kein kompliziertes Geflecht von Rhythmen, kein Regelsystem des Taktes oder der Tanzschritte, einfach nur »the beat goes on«. Da verwundert es auch nicht, dass über dem lauten Beat zunächst kinderliedartige Melodien ausreichten. Erst mit der den amerikanischen schwarzen Bluessängern entlehnten Tiefe und Eindringlichkeit der einfachen Motive entwickelte sich der Beat zum Aufschrei einer Generation. Die Technik der Jazzer mutierte zu Geschwindigkeit und Lautstärke der Gitarrenhelden, zum Einfallsreichtum des Drummers, zur hypnotisierenden Unbeirrbarkeit des Bassisten. Die Entwicklung zum Trio der Supergroups wie Cream und Band of Gypsys war vorgezeichnet. Die zwei Gitarren, Rhythmus und Lead, der klassischen Beatbands wurden vom einsamen Helden (etwa Eric Clapton) zusammengefasst. Doch das war bereits das Ergebnis einer Vermarktungsstrategie, die eine multiplikative Wirkung einer Kombination großer Namen in den Gehirnen der Fans erwartete. In weiterer Folge hat diese Entwicklung dem Beat nicht gutgetan: Die Jazzer (etwa Miles Davies) wandten sich wieder ab, die Fangemeinde degenerierte in den Punk.
In gewisser Weise stand Jimi Hendrix 1970 bereits am Höhepunkt und am Ende der Entwicklung des Beat, als er starb. Fast wäre er kurz vor seinem Tod auch Miles Davis begegnet. Es wäre ungerecht, nicht auch noch an die gar nicht so kleine Minderheit an 68ern zu denken, die später über den Jazzrock zum Jazz emigrierte. Wie es Miles Davis in den 60er Jahren vorgezeichnet hatte, war die Befreiung des Jazz von seinen antiquierten Formen nicht unbedingt der Schritt zum Free Jazz. Die Befreiung zu scheinbar völlig ungebundener individueller Improvisation barg die Gefahr des Auseinanderfalles der Gruppe ebenso wie die des Wegdriftens von den Zuhörern. Das war nicht nur ein musikalisches Phänomen; ganz generell geriet bei manchen, die zu sehr auf die eigene Freiheit schielten, die Revolte gegen die starren Regeln der alten Generation zu einem ungenießbaren Egotrip. Für die wilden Free-Jazz-Truppen kein Problem – sie lösten sich auf und verschwanden rasch. Die besten Musiker unter ihnen tauchten später in allen möglichen neuen Musikstilen wieder auf.
Im Gegensatz dazu hatte Beatmusik als Weltsprache einen neuen kulturellen Kontinent erschlossen. Gewöhnliche Sprache verweist in letzter Konsequenz auf Außersprachliches, ordnet Beobachtetes mithilfe von Symbolen in kommunizierbare Systeme und wirkt dann zurück auf das Handeln des Beobachters. Beatmusik ist in erster Linie kein Verweis, sondern nur sie selbst. Schwach kann der angeheftete Text auf Gefühle der Musiker – aktive und sich identifizierende – Bezug nehmen, in Trance gelallte Wörter können hängen bleiben. Eine Geschichte kann in einem Song erzählt werden, sie ist aber kein Narrativ, dazu ist der Moment, in dem sie aufblitzt, zu kurz. Was in der poetischen Literatur zu einem Problem wird – wie kann ein in einer Sprache verfasster Text adäquat in eine andere übersetzt werden –, das wird in der Beatmusik zum entscheidenden Vorteil: Da alles im Moment, besser (und für Physiker) gesagt im Momentum, bleibt, ist Übersetzung unnötig. Dieser ungeheure Vorteil birgt aber auch schon den Nachteil, der den 68ern bis heute nachhängt. Weil diese Weltsprache keine analytische Potenz erlaubte, blieb es bei einer unverstandenen Kulturrevolte. Daraus erklären sich manch krampfhafte Versuche in den 70er Jahren, dieser Kulturrevolte eine Theorie aufzupfropfen. Nicht ganz ohne Erfolg, doch bis heute – siehe die Occupy-Bewegung – immer noch ohne globalen Durchbruch.