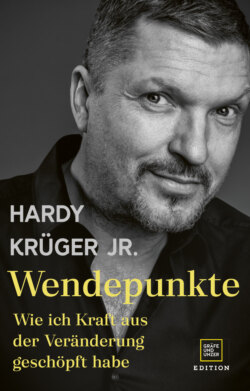Читать книгу Wendepunkte - Hardy Krüger jr. - Страница 11
Kapitel 2
ОглавлениеS3°03'32.7" E37°22'27.4"
Momella, Tansania
Ich bin ein Naturmensch. Am liebsten würde ich den ganzen Tag an der frischen Luft und im Freien verbringen, irgendwo da, wo Wiesen, Wälder oder Wüsten sind. Deswegen habe ich mich in Afrika auch immer wohlgefühlt. Bis heute ist es so, dass mich ein beruhigendes Gefühl des Ankommens ergreift, sobald mein Fuß das erste Mal nach langer Zeit wieder afrikanischen Boden berührt.
Afrika lässt einen nicht kalt – man liebt es oder man hasst es. Dazwischen ist nicht viel. Mich fasziniert dieser Kontinent voller Widersprüche. Schön und hässlich, laut und leise, ablehnend und willkommen heißend. Nirgendwo sonst klingt die Stille so wie in Afrika. Es ist niemals wirklich leise, selbst wenn nichts zu hören ist. Irgendwo rollt eben doch ein Mistkäfer seine Kugel zusammen, knackt ein Zweig, ruft ein Vogel, bricht ein Elefant durchs Unterholz oder zerreißt der Ruf einer Wildkatze die Nacht. Afrika spricht alle Sinne an. Es stinkt, blendet, kreischt, aber duftet auch, erfüllt und begeistert.
Sieben Jahre vor meiner Geburt, im Sommer 1961, übernahm mein Vater die männliche Hauptrolle in Zwei unter Millionen, einem deutschen Film, der die Geschichte von Karl und Christine erzählt. Der junge Mann aus dem Westen verliebt sich in Berlin in eine Ostdeutsche und hilft ihr, das Land zu verlassen. Mein Vater wollte in diesem Film seiner Heimatstadt ein Denkmal setzen – nur leider kam ihm der Mauerbau dazwischen. Denn mitten in den Dreharbeiten beschloss die sozialistische Führung, das Land abzuriegeln, allen »Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten«-Dementis zum Trotz.
Aber wie heißt es so schön? Ein Dementi ist der verzweifelte Versuch, die Zahnpasta zurück in die Tube zu bekommen. Es begann mit einem Stacheldrahtzaun, nur wenige Tage später folgten die ersten Mauersteine. Für meinen Vater war dies ein einschneidendes Erlebnis und derart traumatisierend, dass er Berlin nach Ende der Dreharbeiten für Jahrzehnte nicht mehr besuchte. Er verließ jedoch nicht nur die Stadt – er verließ auch Deutschland. Stattdessen ließ er sich in der Schweiz nieder, reiste durch die Welt, stürzte sich in die Arbeit und drehte in den Vereinigten Staaten, in Frankreich und in Afrika.
Im selben Jahr, in dem Zwei unter Millionen gefilmt wurde, übernahm mein Vater eine Rolle in einer internationalen Produktion mit Stars wie John Wayne und Elsa Martinelli im ostafrikanischen Tanganjika, dem heutigen Tansania. Mein Vater verliebte sich Knall auf Fall in die Region Momella am Rande des Arusha-Nationalparks. Dicht bewaldete, sanft geschwungene Hügel erheben sich dort über die weitläufige Ebene. Alle Schattierungen von Grün und Blau sind in diesem Bild wie in einem Ölgemälde da Vincis komponiert: Im Hintergrund, kaffeebohnenbraun, fast schwarz, erheben sich die Konturen der Hochebene, davor breitet sich ein fruchtbarer, satter Teppich aus unterschiedlichsten Blattwerken aus. Wenn die in Ostafrika allgegenwärtige Wolkendecke am Himmel wie ein Bühnenvorhang aufreißt, verwandeln sich die Sonnenstrahlen in riesige Filmscheinwerfer und bringen die Farben im Tal zum Leuchten. Auftritt für den eigentlichen Hauptdarsteller: Gegenüber den Hängen ragt das Kilimandscharo-Massiv in den Himmel, gekrönt vom höchsten Gipfel Afrikas, dem Kibo, auf dem das ganze Jahr über Schnee liegt.
Das Momella-Tal hat schon viele in seinen Bann gezogen. 1906 entdeckte die deutsch-britische Margarete Trappe aus Schlesien das Gebiet östlich des Kilimandscharo für sich und beschloss, hier eine neue Heimat zu finden. Sie gründete eine Farm und wechselte nach dem Ersten Weltkrieg sogar die Staatsbürgerschaft, um in Tansania bleiben zu dürfen. Weil sie sich, im Gegensatz zu den meisten anderen Weißen, die Afrika kolonisierten, der einheimischen Bevölkerung gegenüber sehr gerecht verhielt, wurde sie im Land bekannt. Bald nannte man sie die »Mutter der Massai«.4
Ihre Farm war es, die Paramount Pictures 1961 für die Produktion von Hatari! kaufte. Hier spielt sich im Film das Leben der harten Männer ab, die tagsüber auf der Jagd nach Elefanten, Nashörnern, Löwen und Giraffen sind, um sie in amerikanische Zoos zu bringen, und sich nach Feierabend vorrangig von Whiskey und filterlosen Zigaretten ernähren und über junge Damen philosophieren, die langsam zur Frau heranwachsen. Das Rangerleben, das der Film proklamierte, war hart, es roch nach Schweiß, Draufgängertum und Gefahr. Hatari eben, was auf Suaheli nichts anderes als »Achtung, Gefahr!« heißt (wobei ich mich zeit meines Lebens gefragt habe, ob die Gefahr von der Wildnis, dem Whiskey oder den harten Kerlen ausging).
Noch während der Dreharbeiten erwarb mein Vater die Momella Game Lodge. Er wollte sichergehen, immer wieder an diesen bezaubernden Flecken Erde zurückkehren zu können. Gemeinsam mit seinem Freund, dem Briten Jim Mallory, baute er die Lodge zu einem Hotel um, indem sie acht weiße Rundhütten mit Bananenblattdächern rund um das große Farmhaus errichten ließen. Auch für das leibliche Wohl war dank Hühner- und Schweineställen sowie eigener Schlachterei gesorgt. Da kurze Zeit später ein Flughafen in unmittelbarer Nähe eröffnete, kamen die Urlauber aus Deutschland in Scharen. Die Lodge war berühmt, denn Hatari! war Kult geworden, und jeder, der es sich leisten konnte, flog nach Afrika. Die fremde Kultur lockte, noch dazu hoffte ein mancher, den Eigentümer der Lodge nach einem aufregenden Tag voller Safari, Staub und Sonnenschein an der Bar anzutreffen und seine Trinkfestigkeit herauszufordern.
Oberhalb der Momella Lodge lagen die Privathäuser von Mallory, seiner Frau Ulla und Tochter Tanja sowie der Familie Krüger. Wir waren in meiner frühesten Kindheit häufig in Tansania, meist für mehrere Wochen oder gar Monate. Ich erinnere mich an vieles, obwohl ich noch so jung war, gebe jedoch zu, dass es auch der Bildberichterstattung der damaligen Zeit und den Erzählungen meiner Eltern geschuldet sein kann, die sich mit meinen tatsächlichen Erinnerungen vermischen.
Vieles aus meiner Kindheit wurde dokumentiert, gefilmt und in Wort, Bild und Ton in die weite Welt hinausgetragen. Das meiste aus meinem Leben war bekannt, bevor ich es selbst verstehen konnte – ein tragisch-komischer Nebeneffekt des Berühmtseins, in das ein junger Mensch erst hineinwachsen muss. Man begegnet nicht nur Leuten, die einen schon kennen, seitdem man laufen kann, sondern kommt auch an Orte, die dich nie vergessen. An manchen Tagen fühlte es sich für mich an, als wenn ich in mein eigenes Leben hineingestolpert wäre, das ein anderer bereits für mich gelebt hatte. Ein verwirrendes Spiel, besonders wenn man jung ist und die eigene Identität sucht. Andauernd feiert man ein Wiedersehen mit Menschen oder Orten, die sich schon mit dir verbunden fühlen und als Teil deines Lebens betrachten, bevor dein Verstand begreifen kann, was gerade passiert. Jeder meint, dich zu kennen, doch in Wahrheit kennt dich kaum jemand.
Was ich noch ganz genau weiß: Wenn wir in Afrika waren, hatten wir stets Spielkameraden aus dem Volk der Massai. Wir vergnügten uns, unabhängig von Sprachbarrieren oder kulturellen Unterschieden, stunden-, ja tagelang an einem großen Baum auf dem Gelände nahe den Gemüse- und Kräutergärten, kletterten auf ihm herum, fesselten uns an seinen Stamm beim Räuber-und-Gendarm-Spiel und dösten im Schatten seiner ausladenden Äste. Zwei weißblonde Kinder unter vielen dunklen mit krausem Haar. Wir waren den ganzen Tag an der frischen Luft, jedoch stets in Rufweite zum Farmhaus, denn Afrika ist gefährlich. Überall lauern wilde Tiere, giftige Insekten, angriffslustige Schlangen, Gefahren eben, Hatari! Auch um den Geparden Sonya, der nach Beendigung der Dreharbeiten auf der Lodge geblieben war, machten wir immer einen großen Bogen. So zahm Sonya auch war und sosehr ihr geflecktes Fell in der Sonne glänzte: Unsere Eltern hatten uns eingeimpft, dass der Gepard immer noch ein Raubtier war und kleine Kinder in seiner Nähe nichts zu suchen hatten. Immerhin eine Sache, an die wir uns hielten – wohl auch aus Furcht und dem unbestimmten Gefühl, dass Mutter und Vater mit ihrer Warnung ausnahmsweise einmal recht haben könnten.
Ein einheimischer Junge wuchs mir in Momella besonders ans Herz. Er hieß Saidu, was so viel wie »der Glückliche« heißt. Und tatsächlich, ich habe nie einen glücklicheren Menschen als Saidu gesehen. Eines Tages nahmen wir ihn für ein paar Wochen mit nach Brixen in Südtirol. Dort hatte mein Vater ein paar Jahre zuvor eine kleine Skihütte gebaut, in der wir häufig mehrere Wochen im Winter verbrachten. In den norditalienischen Alpen gab es oft so viel Schnee, dass nur noch das Dach und der Schornstein unter den zentnerschweren Massen hervorragten.
In Brixen hatten wir Skifahren gelernt. Zuerst zwischen den Beinen meines Vaters, später im Kurs. Jeder Kurs endete mit einem kleinen Rennen, und natürlich gab es bereits unter den Kindern Konkurrenz. Alle wollten den ersten Platz belegen. Das gefiel meinem Vater, denn ich glaube, er hatte vor, einen Siegertypen aus mir zu machen. Doch ich war eher ein Schöngeist – und vermutlich das einzige Kind im Skikurs, das sich nicht für das Rennen interessierte. So kam es, dass ich bei einem Wettbewerb zwar von der Starthütte oben auf dem Berg vielversprechend startete, unten aber nie ankam. Die Sorge meiner Eltern war groß. War ihrem kleinen Jungen etwas passiert? Hatte er einen Unfall gehabt? Man machte sich auf die Suche nach mir und fand mich schließlich unter einem Baum liegend. Die Skier hatte ich abgeschnallt und in den Boden gesteckt, das Gesicht in Richtung Himmel gerichtet. Die Wolken faszinierten mich mehr als der Wettkampf mit den anfeuernden Eltern seitlich der Skipiste. Ich bekam an diesem Tag einen unglaublichen Ärger. Einerseits, weil sich meine Eltern solche Sorgen gemacht hatten, andererseits vielleicht auch, weil ich meinen Vater mit meinem mangelnden Ehrgeiz enttäuscht hatte.
Einmal begleitete uns wie gesagt Saidu nach Brixen. Obwohl er am Fuße des Kilimandscharo aufgewachsen war, hatte er noch nie in seinem Leben Schnee berührt. Als wir nun am Morgen nach der langen Reise von Tansania bis nach Norditalien vor die Haustür traten und Malaika und ich uns in den zentimeterhohen Neuschnee warfen, der über Nacht gefallen war, um Schneeengel zu machen, blieb der kleine Massai wie angewurzelt stehen und starrte auf die weiße Pracht. Später schrieb er seiner Mutter in einem Brief: Mama, du wirst es nicht glauben, aber sie haben mich in eine Zuckerfabrik gebracht!
Ich weiß noch, wie sehr wir alle lachen mussten, als Saidu uns von seinem Brief erzählte. Und ich erinnere mich daran, wie laut er selbst lachte, als er eines Tages der Berichterstattung eines Triathlons im Fernsehen beiwohnte. Das Fernsehen war für Saidu sowieso eine ziemliche Sensation, so etwas gab es nicht in seinem Dorf. Als er nun also in Brixen vor der Flimmerkiste hockte und wie hypnotisiert auf die Sportler starrte, brach er urplötzlich in schallendes Gelächter aus.
»Was ist los?«, wollte mein Vater von ihm wissen. »Was ist denn so komisch?«
Saidu konnte kaum an sich halten. Er hielt sich den Bauch und kicherte weiter. Dann zeigte er auf einen der Triathleten, der gerade sein Rad geschultert hatte und eine kleine Anhöhe hinaufrannte. »Wieso hat ihm niemand gesagt, dass man auf Fahrrädern fahren kann?« Er schüttelte den Kopf. Es war ihm deutlich anzusehen, dass er die weißen Menschen manchmal sehr merkwürdig fand.
Saidu war mir als Kind ein wahrer Freund. Manchmal werde ich heute gefragt, ob es mir schwerfiel, die Kameraden, die ich in jungen Jahren hatte, immer wieder zu verlassen, weil sich die Krüger-Karawane, wie meine Eltern unsere kleine Reisegesellschaft nannten, in Bewegung setzte, auf einen anderen Kontinent reiste, in einem anderen Land ihre Zelte aufschlug, in einen anderen Alltag eintauchte.
Tatsächlich war es für mich keine besondere Sache. Ich war es gewohnt, immer wieder den Ort zu wechseln und neue Menschen kennenzulernen. Vermutlich war ich deshalb auch früh selbstständig und darin geübt, auf eigenen Beinen zu stehen. Mir fiel der Abschied nicht schwer, denn ich hatte ja immer mich selbst dabei – und so gern ich andere Kinder mochte, war ich doch sehr gern allein mit mir und meinen Gedanken. Ich hatte nie, in meinem ganzen Leben nicht, den Wunsch, an einem Platz heimisch zu werden und Wurzeln zu schlagen. Selbst wenn ich heute mit meiner Frau Alice in einem Haus lebe, sind wir stets unterwegs und auf der Suche nach neuen Begegnungen und Inspirationen. Neben all den Marazzi-Genen gibt es eben doch eine ordentliche Portion Krüger-Unrast in mir.
Mein Vater bewirtschaftete gemeinsam mit seinem Freund Mallory die Momella Lodge für viele Jahre. Im Jahr 1967 jedoch wurde in Tansania, das seit April 1964 zusammen mit Sansibar eine unabhängige Republik bildete, die sogenannte Arusha-Deklaration5 beschlossen, was im Grunde nichts anderes bedeutete, als dass das Land innerhalb der kommenden Jahre sukzessive in ein sozialistisches System überführt werden sollte. Ujamaa bezeichnet den afrikanischen Sozialismus,6 welcher, genau wie die Erlangung der Eigenständigkeit, Ziel des politischen Richtungswechsels war. Damit wurde auch die Bewirtschaftung der Farm immer schwieriger, denn mit einem Mal legte der Staat fest, wie teuer eine Übernachtung in der Lodge oder der Verkauf von Schweinefleisch war – und kassierte natürlich ordentlich mit. Ausländische Grundbesitzer waren darüber hinaus nicht mehr gern gesehen, und große Teile der freien Wirtschaft wurden zwangsenteignet. 1973 wurde die Lage schließlich unerträglich, und mein Vater beschloss schweren Herzens, dem Drängen der dortigen Politik nachzugeben und das Land zu verlassen. Es war bereits das zweite Mal innerhalb von zehn Jahren, dass er einen Ort hinter sich lassen musste, den er als Heimat bezeichnet hatte: erst Berlin, dann Momella. Beide Male, weil der Sozialismus den Staat von rechts auf links krempelte. Ich weiß, wie sehr meinen Vater der Verlust der Momella Lodge schmerzte. Hier war er zum ersten Mal in seinem Leben wirklich zur Ruhe gekommen. Hier hatte er die Langsamkeit entdeckt – und eine alte Schreibmaschine, auf der er seine ersten Bücher verfasste und seine Vergangenheit sowie die Erlebnisse in Afrika verarbeitete.
Heute ist Tansania, dieses wunderschöne Land, nach unzähligen politischen Desastern, diversen Kolonisten und modernen Krankheiten zu einer Nation geworden, die sich gerade so um die wesentlichen Dinge des Überlebens kümmern kann. Wie ein Sinnbild dafür steht die Momella Lodge, die nach dem Weggang der Krügers, dem Abzug der Karawane, durch viele Hände ging. Doch niemand hatte den Traum meines Vaters, und für eine lange Zeit hatte auch niemand Mittel, Möglichkeit und Muße, die Farm wieder zu alter Größe zu führen.
Im Jahr 2014, mehr als vierzig Jahre nach meiner letzten Reise nach Tansania, arbeitete ich schon seit langer Zeit für Film und Fernsehen und wurde darum gebeten, für eine Dokumentation ins Land zu fahren. Es war das erste Mal, dass ich wieder an den Kilimandscharo kam – natürlich auch, um zu sehen, was aus meines Vaters Traum geworden war. Doch was ich fand, ließ mein Herz schwer werden. Die Momella Lodge war heruntergekommen und marode, Gärten, Beete und Bäume waren vom Anwesen verschwunden, der alte Glanz war nicht mehr als eine Erinnerung an bessere Zeiten. Unweit des Haupthauses hatten sich einst Schlachterei, Ställe und Werkstätten befunden. Nun hausten in den alten Kühlhäusern und Räucherkammern Familien, die mich vom Gelände vertrieben, als sie mich und das Filmteam sahen. Wir flüchteten in unsere Jeeps und machten, dass wir wegkamen, bevor noch mehr passierte. Was war aus dem Ort meiner Kindheit nur geworden? Das Ereignis schockierte mich zutiefst, und ich war beinahe froh, das Land nach einigen Tagen wieder verlassen zu können.
Doch der Kontinent ließ mich noch nicht gehen. Afrika, die vertraute Fremde. Wunderschön verwirrend, abstoßend und anziehend zugleich, vorherbestimmt und doch immer wieder überraschend. Häufig denkt man beim ersten Blick auf eine afrikanische Landschaft, kein Leben würde sich darin regen. Wenn man aber nur ein paar Augenblicke innehält und abwartet, bemerkt man plötzlich, dass alles in Bewegung ist. Kleine Vögel, die von Ast zu Ast springen, eine Schlange, die über den Boden zischt, Erdmännchen, die wie erstarrt vor ihren Höhlen stehen und lauschen, sich jedoch blitzschnell verziehen, wenn eine Gefahr auf sie zukommt. Und auch: Löwen, die Jagd auf eine Herde Gnus machen. Zebras, die vor einem Geparden Reißaus nehmen. Aasgeier, die über dem abgenagten Gerippe einer Giraffe ihre Kreise ziehen. Der Tod ist in Afrika allgegenwärtig. Da, wo das Leben einst seinen Ursprung nahm, in der Wiege der Menschheit, gehört das Sterben unweigerlich zum Alltag dazu.
Als ich viele Jahre später als UNICEF-Botschafter wieder einmal auf den Kontinent kam, fuhren wir mit dem Konvoi durch ausgestorbene Dörfer, in denen das Aidsvirus gewütet hatte. Die einzigen Menschen auf den Straßen waren noch keine zwölf Jahre alt: Kinder, die sich selbst versorgten, weil alle anderen gestorben waren. Es war ein Bild des Schreckens.
Nicht nur Aids, auch Krankheiten, die in Europa mithilfe von Medikamenten leicht behandelt werden können, werden in Afrika schnell zur Lebensgefahr. Jedes dreizehnte Kind auf dem Kontinent südlich der Sahara stirbt noch vor dem fünften Lebensjahr. Nirgendwo sonst auf der Welt ist die Kindersterblichkeit so hoch wie dort.7 Und wenn es nicht Krankheiten sind, sorgen Bürgerkriege und bewaffnete Auseinandersetzungen, Warlords und Milizen dafür, dass man sich seines Lebens nie wirklich sicher sein kann.
In Afrika lernte ich vieles über das Leben und über das Sterben. Dass der Tod ein ständiger Begleiter ist und ich ihn nicht zu fürchten brauche. Dass das Leben immer eine Gefahr bedeutet. Und dass in jedem Ende, so schrecklich es auch sein mag, ein neuer Anfang liegt. Denn wenn du mit der Natur lebst, spielen Zeit, Leben und Tod eine andere Rolle. Alles kommt und geht, wie eine Welle, ist in Bewegung, im Fluss. Manche nennen es Schicksal. Ich nenne es Leben. Wir alle müssen diese Erfahrung machen. Doch wenn etwas geschieht, ist es immer der Anfang von etwas Neuem.
Im Jahr 2017, drei Jahre nach meinem letzten Besuch, gab ich mir und dem Land eine weitere Chance. Ich kam spät am Tag mit dem Flieger am Kilimandscharo an und stieg in einen Jeep, dessen Fahrer mich über holprige, regenüberschwemmte Pisten bis zur Momella Lodge fuhr – hinein in den Sonnenuntergang und die einbrechende Dunkelheit. Immer wieder blitzten in der Dämmerung die Augen der wilden Tiere auf, die am Rand der Schotterpiste im Dickicht lauerten. Wer Afrika kennt, weiß: Der Busch schläft nie. Alles ist miteinander verbunden, nicht nur die Menschen. Pflanzen und Tiere haben ein ausgeklügeltes Nachrichtensystem. Die einen sagen, es seien die Buschtrommeln, die anderen munkeln, es wäre der Wind.
In meinem Fall waren es wohl die afrikanischen Götter, die auf dem Gipfel des Kilimandscharo leben. Denn an diesem Tag, als ich nach so langer Zeit endlich wieder in Richtung Momella unterwegs war, verzogen sich mit einem Mal die Wolken vom Gipfel des Kilimandscharo-Massivs. Die Wolken und dieser Gipfel sind eine kaum zu trennende Einheit – es geschieht nur sehr selten, dass der Berg unbedeckt, ja vielleicht ungeschützt daliegt. Ein unmissverständliches Zeichen für die Einheimischen, dass ein wichtiges Ereignis bevorsteht. Während ich also im Jeep durch die Nacht rumpelte und das Felsmassiv mich im Mondlicht zu beobachten schien, verbreitete sich die Nachricht in Momella: Der verlorene Sohn kehrt zurück!
Als wir in der Lodge ankamen und die kleine Auffahrt zur Farm hochfuhren, wartete ein Empfangskomitee aus Einheimischen und alten Freunden in traditioneller Kleidung auf mich – obwohl ich kaum jemandem Bescheid gegeben hatte, dass ich unterwegs war. Sie sangen ein Willkommenslied in ihrer Sprache, und mir liefen die Tränen über die Wangen. Ich hatte das Gefühl, nach langer Zeit wieder nach Hause zu kommen.
Es war vollends um mich geschehen, als dann auch noch Saidu, der kleine Junge von früher, der in Brixen die Zuckerfabrik gefunden hatte, auf mich zukam, mich umarmte und mir einen Zettel zusteckte, auf dem stand: Du hast einen Freund am Kilimandscharo, der immer für dich da ist! Afrika hatte mich wieder, hatte mich mit Haut und Haar gepackt, ergriff mich mit allen Sinnen. Stunden später, denn so leicht hatte sich mein Empfangskomitee nicht abwimmeln lassen, legte ich meine müden Knochen endlich ins Bett und schlief auf der Stelle ein. Das Letzte, was ich hörte, waren die Affen, die auf dem Dach einen Freudentanz aufführten.
Am nächsten Morgen wachte ich auf, öffnete die Fensterläden und blickte auf den langen Hals einer Giraffe. Es war wirklich wie im Film, ich konnte es nicht glauben. Bei meinem morgendlichen Rundgang über das Anwesen stellte ich fest, dass Jörg und Marlies, die neuen Eigner der Lodge, ganze Arbeit geleistet hatten. Nach Jahren der Verwahrlosung und andauernd wechselnden Besitzern hatten sie vor einiger Zeit die Momella Lodge gekauft und in Hatari Lodge umbenannt. Hohe Zypressen säumten wieder das Land, umgaben die hübsch hergerichteten Gästehäuser und die herrlichen Gärten.
»Guten Morgen! Hast du gut geschlafen?« Jörg begrüßte mich mit einem breiten Lächeln und fragte, ob ich später mit ihm einen kleinen Ausflug machen wolle.
Ich sagte begeistert zu, denn ich wollte alles sehen und verstehen, jetzt, wo die Lodge wieder zu alter Pracht gekommen war. Doch etwas an Jörgs Gesichtsausdruck ließ mich stutzig werden. Er trug ein wirklich unerhört breites Grinsen zur Schau.
»Was ist los?«, wollte ich von ihm wissen.
Er streckte den Arm aus und zeigte auf die Grundstücksgrenze. »Erinnerst du dich an den alten Baum, der dahinten stand?«
Ich folgte seinem ausgestreckten Finger und sah in die Richtung, in die er zeigte. Dann erinnerte ich mich. Dort hinten, am Ende des Geländes, war noch vor drei Jahren der riesige Baum gewesen, der uns in der Kindheit Schattenspender, Spielplatz und Räuberhöhle in einem gewesen war. Nun sah ich lediglich ein riesiges Gewirr aus Ästen und Blättern auf dem Boden in der Ferne liegen.
»Was ist passiert?«, fragte ich verblüfft.
Jörg zuckte mit den Schultern. »Er hat sich letzte Nacht niedergelegt. Ganz still und leise. Er ist einfach umgefallen, und keiner hat es gehört. Du kannst dir ja denken, was die Leute deswegen sagen.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, wovon du sprichst.«
»Sie sagen, es ist ein Zeichen, wenn ein so großer, alter Baum einfach umkippt. Die Massai sind davon überzeugt, dass der verlorene Sohn diesmal bleibt. Alles wird so wie früher.« Jörg legte den Kopf in den Nacken und lachte laut. »Ich schätze, dein Schicksal ist besiegelt.«
Auch ich musste lachen. Für so manchen Mitteleuropäer sind die afrikanischen Sitten und Gebräuche mehr als befremdlich. Die meisten Menschen des Kontinents glauben daran, dass die Natur ihnen Zeichen übermittelt, in denen sie vorhersehen, was passieren wird. Egal, ob der Kilimandscharo wolkenlos ist oder drei Hühnerbeine über Kreuz vor der Tür der Rundhütte liegen: Die Götter sprechen immer mit dir. Es ist nur die Frage, ob du gut genug zuhörst. In Afrika lebt man mit der Magie der Natur und dem Übersinnlichen. Ich habe oft erlebt, dass die Schamanen und Medizinmänner mit ihren Prophezeiungen richtiglagen. Nur diesmal taten sie es nicht, denn ich wusste bereits an jenem Morgen: Ich würde nach Deutschland zurückkehren, wo mein Zuhause war.
Ich blieb mehrere Wochen in Afrika und auf der Lodge, unternahm mit Jörg Ausflüge in den Busch, besuchte Familien, die früher auf der Farm gearbeitet hatten, lief mit den Massai und den Buschmännern tagelang durch die Wildnis und saß über Stunden am Lagerfeuer, um dem nächtlichen Treiben zu lauschen. Wenn du im Dunkeln in Afrika an einem Feuer hockst, mit nichts zugedeckt als dem unendlichen, funkelnden Firmament über dir, und du die Hand nach oben ausstreckst, hast du das Gefühl, du kannst die glitzernden Punkte einfach vom Himmel pflücken. Niemals in meinem Leben habe ich solche Sterne gesehen wie in Tansania. Die Milchstraße tritt in der Schwärze der Nacht so deutlich hervor, dass man sich nicht nur unendlich klein vorkommt, sondern auch mit allem verbunden. Plötzlich ist alles sehr leicht, die Dinge scheinen an ihren Platz zu fallen – ein erhebendes, befreiendes Gefühl. Bei dieser zweiten Reise nach Afrika verstand ich zum ersten Mal wirklich, was meinen Vater einst dazu brachte, die Lodge und das umliegende Land zu kaufen und zu bewirtschaften, allen Widrigkeiten zum Trotz. Dennoch wurde mir auch klar, dass ich niemals hierher zurückkehren und die Farm betreiben könnte, auch wenn sich die Einheimischen das wünschten. Der Traum von Afrika war meines Vaters Traum – nicht meiner. Ich hatte eine andere Aufgabe. Und auch wenn ich mich wie das Kind dieser wunderbaren Region fühlte: Mein Leben hatte etwas anderes mit mir vor.
So fremd ich mir in vielen Momenten in Afrika auch vorkam, so vertraut war das meiste doch auch für mich. Ich hatte das Gefühl, nicht nur in einer Heimat, sondern auch in mir angekommen zu sein. Das Leben hatte eine neue Saite aufgezogen, deren Klang mir so bekannt vorkam, als hätte ich sie schon mein Leben lang gehört. Ich bewegte mich in dieser eigentlich unbekannten Welt, dieser unbegreiflich schönen Umgebung, als wäre ich immer Teil von ihr gewesen.
Die Menschen, denen ich in Tansania begegnete, starrten mich manchmal an wie eine Erscheinung. Natürlich war und ist mir bewusst, wie ähnlich ich meinem Vater sehe. Für die Einheimischen muss es jedoch wie eine Fata Morgana gewesen sein: Fünfzig Jahre später kommt derselbe Mann wieder nach Momella, ein wenig größer, ein bisschen weniger schlaksig, doch optisch könnte man sie kaum auseinanderhalten – vor allem nicht nach all der Zeit.
Das Verrückteste war: Selbst wenn sie mich als jemanden wiedererkannten, der ich niemals war, war es zu keinem Zeitpunkt meines Lebens gleichgültiger, was ich bislang getan hatte. Mein bisheriger Lebensinhalt spielte an diesem Ort keine Rolle. Es war egal, woher ich kam und wohin ich gehen wollte, wer ich war, was ich tat, welchen Film ich drehen würde, welche Premiere anstand, was mein Agent zu mir sagte oder die Presse über mich schrieb. Nichts war von Bedeutung. Das Einzige, was zählte, waren Afrika und ich.
Am deutlichsten spürte ich dies, als ich gemeinsam mit Jörg an einen magischen Ort fuhr, den die Einheimischen Shu'mata nennen, was so viel heißt wie »dem Himmel so nah«. Er liegt zwischen dem Kilimandscharo und dem Mount Meru, nördlich des Arusha-Nationalparks. An diesem Punkt, wo sich die alten Trampelpfade der Elefanten kreuzen, saßen Jörg und ich die ganze Nacht zusammen, bis die Sonne in den frühen Morgenstunden die Dunkelheit vertrieb. Am Horizont schälten sich die Umrisse einer Hügelkette aus der einsetzenden Dämmerung des Tages, die Seven Sisters, und vor ihnen lag eine breite Savanne, die bis nach Kenia reicht. In der Ferne bewegten sich zwei Gestalten. Männer der Massai, in rot-schwarze Stoffe gekleidet, langsam und bedächtig, im Gleichklang mit der Welt. Ich hatte in diesem Augenblick das Gefühl, am absolut richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein. Dieses Leben war so wahnsinnig schwer zu begreifen – und dennoch hatte es mich noch nie losgelassen, sosehr ich es mir zuweilen auch gewünscht hatte. In dieser Morgendämmerung begriff ich: Es liegt in deiner Hand, ein außergewöhnliches, inspirierendes und einzigartiges Leben zu führen in der Zeit, die dir hier geschenkt wird.