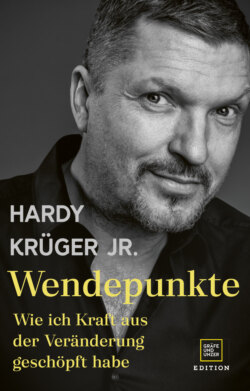Читать книгу Wendepunkte - Hardy Krüger jr. - Страница 13
Kapitel 3
ОглавлениеN40°25'02.5" W3°41'00.8"
Madrid, Spanien
Wenn ich an meine Kindheit denke, fallen mir als Erstes all die spannenden und aufregenden Reisen ein, die wir unternahmen, um meinen Vater zu Drehs zu begleiten. Besonders ein Aufenthalt in Madrid ist mir in Erinnerung geblieben. Es muss im Jahr 1975 gewesen sein, als mein Vater die Hauptrolle in einem Westernfilm übernahm, der in der spanischen Wüste von Tabernas gedreht wurde. Damit meine Schwester und ich schulisch nicht auf der Strecke blieben, schickte man uns zur International School Madrid, die mit einem weltweiten Netz aus Privatschulen verbunden war, an denen einheitliche Lehrpläne unterrichtet wurden. So konnte man als Schüler durch die Welt tingeln, einen Monat in den Staaten, einen anderen in Paris und den nächsten in Madrid die Schulbank drücken, verlor nie den Anschluss und war am Ende des Schuljahrs auf demselben Niveau wie die Mitschüler, da die Unterrichtsinhalte überall gleich waren. Eine tolle Sache – wenn man mit dieser Form des Lebens vertraut war.
Für Malaika und mich war das Vagabundendasein nichts Merkwürdiges. Wir kannten nichts anderes als unseren kleinen Zirkus, die Krüger-Karawane. Stets in Bewegung, von einem Abenteuer ins nächste. Alles, was wir zurückließen, machte Platz für eine neue Erfahrung an einem anderen Ort, in einem anderen Land, in einer anderen Stadt. Wir lernten früh, uns nicht zu sehr an Dinge, Freunde und Orte zu gewöhnen oder an sie zu binden. So war ich mir selbst nach wie vor der beste Freund. Das tat mir nicht weh. Ich hatte vielmehr das Gefühl, das Leben sei eine gewaltige, große Spielwiese, die jeden Tag neue Erlebnisse für mich bereithielt.
In Madrid blieben wir mehrere Monate. Es war eine bewegte, unsichere Zeit, denn damals war die ETA, eine baskische Terrororganisation, im Land aktiv. Immer wieder kam es zu Bombendrohungen – sogar an unserer Schule. Ich kann mich noch genau an eine Szene aus dem Klassenzimmer erinnern. Wir hatten gerade Unterricht, als plötzlich ein ohrenbetäubender, durchdringender Laut erklang. Ich war mal wieder in einem meiner Tagträume versunken gewesen, doch das Geräusch ließ mich aufschrecken. Es klang so ganz anders als die Pausenglocke. Ich sah mich um. Meine Mitschüler schienen mit einem Mal in helle Panik verfallen zu sein. Sie waren aufgesprungen, rannten umher, zum Fenster, zur Tür – die Lehrerin versuchte, Herrin der Lage zu werden, aber auch ihre Augen waren schreckgeweitet.
»Was ist denn los?«, wollte ich von meinem Banknachbarn wissen, aber der antwortete irgendetwas auf Spanisch, was ich nicht verstand. In der Schule wurde ja auf Englisch unterrichtet, doch seitdem dieses nervige Klingeln die Luft zerriss, schien es, als ob das alle um mich herum vergessen hätten. Ich verstand die Welt nicht mehr – wortwörtlich. Wir wurden nach draußen geführt, auf den Schulhof. Der war von einem großen Zaun umgeben, und ich sah mit Erstaunen, dass einige Schüler bereits versuchten, das Hindernis zu überwinden und das Schulgelände zu verlassen. Es herrschte Chaos ringsum, einige Kinder weinten, andere schrien, hielten sich an den Händen, die Lehrer dazwischen wirkten in ihren Versuchen, für Ruhe und Ordnung zu sorgen, hilflos. Und über allem lag der kreischende Gesang der Sirene.
In mir wuchs die Unruhe. Ich hielt Ausschau nach meiner Schwester. Die war in einer höheren Klasse, müsste doch aber auch hier irgendwo stecken. Vielleicht konnte sie mir erklären, was los war. Doch ich fand Malaika nicht. Da stand ich nun, umgeben von großen und kleinen Menschen, die wie aufgescheuchte Hühner von links nach rechts rannten, und wusste nicht, was ich tun sollte.
Eine Hand ergriff mich an der Schulter, und ich sah hoch. Es war die Deutschlehrerin.
»Was ist denn passiert?«, wollte ich von ihr wissen.
»Eine Bombendrohung«, antwortete sie atemlos. »Wir versuchen, eure Eltern zu erreichen, aber die ganze Stadt versinkt im Chaos.«
Eine Bombendrohung? Klar, mein Vater hatte mir erklärt, wer die Terroristen der ETA waren und was sie wollten. Nicht, dass ich mit meinen sieben Jahren verstanden hätte, was das bedeutete. Auch als wir ein paar Wochen vorher vom höchsten Punkt eines Hochhauses aus mitbekommen hatten, wie sich Spezialeinheiten vom Hausdach gegenüber in die darunterliegenden Etagen abseilten, hielt ich das alles eher für eine Szene aus einem spannenden Film, wie wir sie uns manchmal im Fernsehen oder Kino ansahen. Und ich kannte ja auch die Dreharbeiten meines Vaters. Da wurde mit Pistolen und Gewehren geschossen, da gab es wilde Verfolgungsjagden und heftige Schlägereien. Wie sollte ich in diesem Alter also den Unterschied zwischen der gespielten und der echten Gefahr erkennen?
Durch die Reaktionen auf dem Schulhof dämmerte mir nun aber langsam, dass diese Situation anders war als die in den Filmen meines Vaters. Ich wartete geduldig neben meiner Lehrerin, bis Malaika auftauchte und kurz darauf ein Fahrer kam, der uns kreuz und quer durch die Stadt, vorbei an Absperrungen und Staus, hupenden Autos und kopflos umherlaufenden Menschen nach Hause zu meiner Mutter brachte.
Madrid kam mir als Kind riesig vor. Bis zu diesem Zeitpunkt kannte ich im Grunde vor allem das verschlafene, romantische Lugano und die unendliche Weite Momellas. Und nun Madrid! Ich bestaunte jedes Mal, wenn wir unterwegs waren, die mehrstöckigen, pompösen Altbauten mit verschnörkelten Ornamenten an den Hauswänden und riesigen Kuppeln auf dem Dach, die nicht enden wollenden prunkvollen avenidas, links und rechts von hohen Bäumen gesäumt, die gigantischen plazas und die reich verzierten Museen, Opernhäuser und Kathedralen, so groß wie ein ganzer Block. In den Straßenzügen der Stadt kann man die Geschichte förmlich riechen.
Vor allem aber erinnere ich mich an die Geräuschkulisse. Madrid war damals, in den 1970er-Jahren, unglaublich laut, und obwohl ich lange nicht mehr dort war, kann ich mir kaum vorstellen, dass es in den vergangenen fünfzig Jahren leiser geworden ist. Es herrscht ein unbeschreiblicher Verkehr, überall tuckern und brummen die Autos, Motorräder und Lkws, es wird gehupt, geschrien, gelacht, Motoren jaulen auf, Bremsen quietschen, Busse lassen zischend Luft entweichen, wenn sie an einer Haltestelle stoppen und sich eine Woge Touristen aus aller Welt auf die Gehsteige ergießt. Sogar die Ampeln piepsen und vermischen sich mit den Rufen der Straßenverkäufer, die ihre Waren anbieten. Gerade im Sommer, wenn das Thermometer gern über die vierzig Grad klettert, ächzt Madrid wie eine alte Dame, wird jedoch niemals leiser, sondern noch quirliger, lebhafter und lauter. Das Leben findet von April bis Oktober auf den Straßen statt, die Gehwege sind bis zum letzten Platz mit Tischen und Stühlen vollgestellt, auf denen sich die Madrilenen mit dunkelroter, schwerer Sangria, buttrigem Serranoschinken und frittierten Sardellen, den boquerones, den Abend versüßen. Lichterketten erhellen den nächtlichen Himmel, ein sämiger Schein liegt über den Hausdächern wie eine Kuppel aus Gold.
An den unterrichtsfreien Tagen fuhren wir hinaus in die Wüste, um die Dreharbeiten zu Potato Fritz zu beobachten. Neben meinem Vater in der Hauptrolle spielten Stephen Boyd, Arthur Brauss, Friedrich von Ledebur, Diana Körner und Paul Breitner mit. Ja, genau, richtig gelesen: Paul Breitner, der legendäre Fußballspieler, der damals für Real Madrid kickte und eine Afrofrisur hatte, über die man nur staunen konnte. Mit von der Partie waren außerdem sein Freund und Sportkollege Günter Netzer als Setfotograf und Udo Jürgens als Komponist für die Musik. Im Nachhinein muss man wohl sagen, dass es vor allem die Besetzung war, die meinen Vater dazu brachte, am Film mitzuwirken.
Ich selbst konnte mir keinen besseren Spielplatz als das Set dieses Westernfilms vorstellen. Pferde, Bären, Lagerfeuer, Kutschen, »Cowboy und Indianer« – ich war im Himmel! Nie zuvor hatten Malaika und ich die Gelegenheit gehabt, so nah dran an der Arbeit meines Vaters zu sein. Das war ein Schlüsselerlebnis für mich, das mich nachhaltig beeindruckte. Wir trafen andere Schauspieler, kernige Mannsbilder, die Filterlose rauchten und ununterbrochen Whiskey soffen. So muss ein richtiger Mann sein, dachte ich damals – und mein Vater war einer von ihnen, sogar der Held des Films! Wenn er abends von den Dreharbeiten in unsere von der Produktion angemietete Wohnung kam, stank er zum Gotterbarmen. Besagter Potato Fritz bekam im Film nämlich immer wieder Besuch von einem Bären – und von dem ging ein infernalischer Geruch aus.
Wenn gerade keine Szene gedreht wurde, streunte ich über das Set. Der Geruch der Lederriemen, das Quietschen der Saloontüren, die heiße, brennende Wüstensonne, die die Haut so angenehm kribbeln ließ … Und dann erst die Dinge, die wir jeden Tag erlebten. Stephen Boyd brachte mir zum Beispiel das Schießen mit der Pistole bei. Obwohl mein Vater der Held der Geschichte war, war er wohl der einzige Cowboy im Wilden Westen, der nichts mit Waffen anfangen konnte.
Zum Glück gibt es im Umkreis nahezu jedes Kindes ein paar lustige Erwachsene, die die Rolle der »Outlaws« übernehmen. In meinem Fall war es Günter Netzer, der mich eines Tages fragte, ob ich schon einmal ein Auto gefahren habe. Ich verneinte, ich war ja gerade mal sieben Jahre alt. Der Fußballer nickte, lächelte und verfrachtete mich kurz darauf in seinen kleinen Mini Cooper. Kaum dass wir die Filmstadt verlassen hatten, ließ er mich hinters Lenkrad. Das Problem war nur: Ich war viel zu klein, um mit den Füßen an die Pedale zu kommen. Doch Not macht erfinderisch, also wies Günter mich an, mich auf den Sitz zu stellen und das Lenkrad fest zu umgreifen. Er selbst drückte vom Beifahrersitz auf das Gaspedal, und das Auto setzte sich ruckelnd und zuckelnd in Bewegung.
»Schneller!«, rief ich irgendwann, und Günter gab Stoff. Wir holperten über den trockenen Boden, lachten und freuten uns, und ich war mir sehr sicher: So einen schönen Tag würde ich nie wieder erleben!
Das war natürlich Unsinn, denn die schönsten Tage erlebte ich fast immer mit meinem Vater. Ich war wohl das, was man ein Papakind nennt. Er war nicht nur mein Held, sondern auch ein richtiger Freund für mich. Oft nannte er mich »Bursche«, was aus seinem Mund immer wie ein zärtliches Kompliment klang. Wir »Männer« waren während meiner Kindheit oft zu zweit unterwegs, unternahmen Radtouren, holten gemeinsam ein neues Auto in Sindelfingen ab und hörten auf der Fahrt Simon and Garfunkel, sahen uns Filme von Bud Spencer und Terence Hill an oder spielten Poker. Ich begriff, obwohl doch so jung, dass mein Vater ein wichtiger Mann war. Denn egal, wo auf der Welt wir waren, er kannte viele Menschen.
Oder war es andersherum? Kannten die Menschen ihn?
Wenn ich an damals denke, versetzt mich die Erinnerung immer wieder in sein Arbeitszimmer mit dem Blick auf den Luganer See, wo er vor der Schreibmaschine saß und rhythmisch tippte. Es war die schönste Melodie in meinen Ohren, das regelmäßige Klappern der Tasten, untermalt vom Geruch des Whiskeys und dem Duft einer frisch angezündeten Gitane ohne Filter. Wenn mein Vater schrieb, war er so vertieft, dass ich ihn nicht stören durfte. Also genoss ich es, still und leise in seiner Nähe zu sein, und malte stundenlang auf dem Boden seines Arbeitszimmers. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber ich bilde mir ein, dass auch er es genoss, wenn ich bei ihm war und mich mit mir selbst beschäftigte. Ich gab mir immer große Mühe, ihn nicht zu unterbrechen, denn ich sah ihn viel zu selten. Deswegen war jeder Augenblick, den ich mit meinem Vater gemeinsam erleben durfte, so wunderbar und bedeutsam für mich.
Wenn er wieder einmal ging, verabschiedete er sich stets liebevoll von uns und versprach, mit einer Überraschung zurückzukommen. Malaika und ich konnten seine Rückkehr deswegen kaum erwarten. Eines Morgens stand er nach einer seiner Reisen im Bademantel vor uns, ein breites Lächeln prangte in seinem Gesicht. Wir stürmten auf ihn zu – aber ich hielt inne, als ich erkannte, dass er etwas in den Taschen seines Bademantels versteckte. Ich entdeckte zwei große Teddybärenköpfe, die links und rechts aus den Taschen seines Bademantels lugten. Papa ging in die Knie, breitete die Arme aus und sagte: »Ich habe doch versprochen, dass es eine Überraschung gibt, wenn ich zurückkomme!«
Wie bei vielen anderen Vätern und Söhnen veränderte sich unsere Beziehung im Laufe der Jahre. Je älter ich wurde, desto mehr spürte ich die vielen Kilometer Distanz zwischen uns. Das Leben hatte sich verändert. Ich hatte mich verändert. Heute weiß ich, wie wichtig es als Schauspieler ist, einen Ort zu haben, an den man zurückkehren kann, an dem man geliebt wird, so wie man ist, nicht für das, was man darstellt. Ich glaube, mein Vater empfand genauso. Doch es liegt in der Natur des Schauspielers, immer in Bewegung zu sein. Die Welt ist dein Zuhause, die Menschen sind deine Inspiration. Du kannst nur dann glaubhaft Geschichten erzählen, wenn du mit allen Sinnen lebst. Es ist also das Wesen des Berufs, auf Reisen zu sein – doch es ist von mindestens genauso großer Bedeutung, eine Heimat zu haben. Diesen einen Ort, an den wir heimkehren können, wo wir geliebt und erwartet werden. Kein Schiff kann ununterbrochen auf See sein. Es braucht einen Hafen, in den es einlaufen kann, um sich aufzutakeln für die nächste Reise. Aber ich weiß, dass es nicht nur mir schwerfiel, meinen Vater immer wieder gehen zu lassen.
Meine große Schwester Malaika (deren Name auf Suaheli »mein Engel« heißt) ist vom Wesen her ganz anders als ich. Obwohl auch sie ein kreativer Mensch ist und Design und Grafik studiert hat, verlief ihr Leben komplett anders als meines. Mit gerade einmal zwei Jahren bekam sie einen kleinen Bruder, so klein und rund, dass man gar nicht wusste, wo Anfang und Ende war, und der die ganze Zeit lachte – ansonsten war er zu nicht viel zu gebrauchen. Ich erinnerte sie vermutlich an eine ihrer Puppen, abgesehen von der Tatsache, dass sie mit mir nicht spielen konnte. Wenn ich als kleiner Junge nicht das tat, was sie wollte, bekam ich eins auf die Mütze – ganz liebevoll, natürlich, wie große Schwestern eben sind. In unseren Anfangsjahren waren wir sehr eng, allein deshalb, weil wir einander die einzigen Spielkameraden waren, die beim nächsten Umzug nicht wie von Zauberhand verschwanden.
Doch je mehr Zeit verging, desto mehr entwickelten wir uns in unterschiedliche Richtungen. Sie wurde sesshaft, mich ergriff die Krüger’sche Unruhe. Die Welt scheint für uns Krügers nicht groß genug zu sein, uns zieht es immer hinaus. Im tiefsten Inneren sind wir Reisende, die nie ankommen wollen. Aber eben nicht Malaika. Sie zog in ein Haus, ich in die Welt. Sie fuhr geradeaus, ich bog an jeder Kreuzung nach links oder rechts ab. Malaika ist geradlinig und konstant. Da wo ihr Leben in geregelten Bahnen verlief, fuhr ich Schlangenlinien. Obwohl wir Geschwister sind, könnten wir unterschiedlicher nicht sein. Deswegen fiel es uns nicht immer leicht, Verständnis füreinander aufzubringen. War ich als kleiner Junge bereits verträumt und der Welt entrückt, gibt es heute wohl Phasen, in denen ich mich in meinen Gedanken komplett verliere. Mir ist bewusst, dass ich für die meisten, die mir begegnen, nicht greifbar bin. Doch ein Mensch ist nun mal so, wie er ist. Das Leben ist für mich ein wundervolles Abenteuer, von dem ich bis heute einfach nicht genug bekommen kann. Und ich bin heute erfahren genug, es nach meinen Wünschen und Bedürfnissen auszurichten und nicht nach denen anderer.