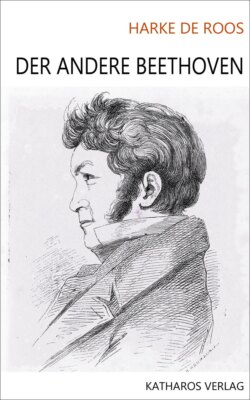Читать книгу Der andere Beethoven - Harke de Roos - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria heißt die Schlachtsinfonie wörtlich. Das 91. Opus Beethovens besteht aus zwei Teilen. Der 1. Teil stellt die Schlacht selbst dar, der 2. Teil, die Siegessymphonie genannt, ist eine Siegesfeier der Engländer, bei der der englischen Gefallenen gedacht und die Nationalhymne gespielt wird. Dieser Teil, in dem Beethoven nach eigener Aussage den Engländern ein wenig zeigen wollte, welch ein Segen in „God save the King“ ruht, klingt zu Ehren des englischen Königs. Folgerichtig ist der englische König der Widmungsträger der ganzen Partitur. In der Zeit der Komposition wurde England regiert vom Prinzregenten George, stellvertretend für seinen erkrankten Vater George III.
Um diese Widmung zu bekräftigen, ließ Beethoven eine prachtvolle Kopie seiner Komposition anfertigen und durch Lord Castlereagh oder einen Boten des russischen Gesandten in Österreich, des Grafen Rasumowsky, in die Hände des Prinzregenten legen. Zu welchem Zeitpunkt dies geschah, ist nicht eindeutig geklärt. Hätte der Prinzregent eine Empfangsquittung oder ein Dankesschreiben an den Komponisten geschickt, wäre das Datum kein Rätsel. Dass das Geschenk tatsächlich angekommen ist, steht aber fest.
Überliefert ist, dass der Prinzregent sich mit dem Leiter seiner Kapelle, Franz Cramer, über die Partitur der Schlachtsymphonie besprochen hat. Franz Cramer war der Bruder des Pianisten John Baptist Cramer, ein alter Bekannter Beethovens und Mitbegründer der Philharmonic Society in London, die als erster Konzertverein Großbritanniens seit Anfang 1813 existierte. Das Eröffnungskonzert der Philharmonischen Gesellschaft hatte am 8. März 1813 unter Leitung des berühmten Geigers Johann Peter Salomon stattgefunden.
Die Musikgeschichte kennt Salomon als jenen Konzertveranstalter, der Joseph Haydn nach London eingeladen und vergeblich versucht hatte, auch Mozart nach England zu holen. Der gebürtige Bonner war mit Beethoven befreundet und es wundert denn auch nicht, dass Symphonien von Haydn und Beethoven auf dem Programm des ersten Konzertes standen.
Haydn, Mozart und Beethoven bildeten den Kern des Repertoires, das von der wohlhabenden und anspruchsvollen Konzertgesellschaft gepflegt wurde. Die zahlreichen Mitglieder verstanden sich durchaus als eine Gemeinschaft von musikalischen Gralshütern. Im Jahre 1813 verehrten sie Haydn und Mozart bereits als wahre Gralskönige und betrachteten Beethoven als legitimen Nachfolger. Nur allzu gerne hätten die Londoner ihren neuen König einmal in ihrer Mitte erlebt. An Bemühungen, Beethoven nach London zu holen, hat es in der Philharmonic Society nicht gefehlt.
Beim genaueren Vergleich zwischen der musikalischen Gralsgemeinschaft und ihrem sakralen Vorbild fällt aber auch ein gravierender Unterschied auf. Im Mittelalter hatte die Treue zum König einen deutlich höheren Stellenwert. Ganz unvorstellbar, dass die Gralspriester ihren erkrankten König Amfortas so behandelt hätten wie George Smart und Ferdinand Ries, beide Mitglieder der Gesellschaft, ihren verehrten Meister Beethoven.
Auf Anraten Cramers übergab der Prinzregent die Schlachtsinfonie der Philharmonischen Gesellschaft, die zu dieser Zeit vom Dirigenten George Smart, ganz gewiss ein hoch gebildeter und wohl erzogener Gentleman, präsidiert wurde. Dieser witterte sofort den blanken Profit und veranstaltete im Londoner Drurylane Theater ab dem 10. Februar 1815 eine Serie von Aufführungen der Schlachtsymphonie, zum ureigenen Vorteil versteht sich. George Smart konnte nach Ende der über mehrere Konzertsaisons verteilten Aufführungsserie einen Reingewinn von 1000 Pfund einstreichen, ein Vermögen nach damaliger Valuta.
Zuvor hatte er die Partitur aber gemeinsam mit Ferdinand Ries grässlich verstümmelt. Ries war der älteste Sohn des ehemaligen Bonner Konzertmeisters Franz Anton Ries, der Beethoven in dessen Bonner Zeit Geigenunterricht erteilt hatte. Im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts war Ferdinand mit Unterbrechungen Beethovens Schüler gewesen. Nach langem Umherziehen durch ganz Europa zwischen 1809 und 1813 hatte er sich in London angesiedelt, wo er von Salomon in die Philharmonische Gesellschaft eingeführt worden war.
Aufgrund seiner einmaligen Kontakte mit Beethoven besaß Ferdinand Ries eine hohe Autorität bei seinen Kollegen. So wurde er von George Smart zu Rate gezogen beim Problem, wie mit Beethovens Partitur zu verfahren sei.
Die beiden Herren waren der Auffassung, dass der Fugato-Teil gestrichen werden sollte, weil man einem englischen Publikum angeblich keine Fuge auf ihre Nationalhymne zumuten konnte. Damit wurde aber, wie ich vermute, genau die Stelle gestrichen, bei der Beethoven den Engländern „ein wenig“ zeigen wollte, welch ein Segen in God save the King ruht. Außerdem wurde der Schluss des Werkes von Smart und Ries so geändert, dass die Nationalhymne noch einmal in voller Länge vom vollen Orchester gespielt wird. Sie wurde dann vom ganzen Haus aus vollem Hals mitgesungen. Voller Erfolg war garantiert.
Vom Gewinn hat Beethoven keinen Kreuzer erhalten, er wurde nicht einmal über die Aufführung seines Werkes informiert. Auch der Prinzregent hat sein Versäumnis niemals nachgeholt, so dass der Komponist sogar noch auf den überaus hohen Kopierkosten der Prachtpartitur sitzen blieb:
..ich fange schon an zu glauben, daß auch die Engelländer nur im Auslande großmüthig sind, so auch mit dem Prinzregenten, von dem ich für meine überschickte schlacht nicht einmal die Kopiaturkosten erhalte, ja nicht einmal einen schriftlichen oder mündlichen Dank
(An Ferdinand Ries, 8. May 1816)
Merkwürdigerweise hat kein Biograph dieses Verhalten von Prinzregent, Smart und Ries jemals beanstandet, als wäre die Missachtung Beethovens die normalste Sache der Welt. Der Komponist musste erleben, dass er sich immer weniger gegen Raub und Verstümmelung seiner Werke wehren konnte, je größer deren Wirkungskreis wurde. Zu dieser Verstümmelung gehörten auch Druckfehler und verfehlte Tempi.
Zu dieser lebensbegleitenden Erfahrung kam eine zweite. Beethoven lernte schon früh, dass er am meisten misshandelt wurde von jenen Leuten, die es gut mit ihm meinten oder meinten, es gut mit ihm zu meinen. Man spürt, dass offene Feindschaft ihm lieber war als verletzende Freundschaftsbezeugungen. Es machte ihm Spaß, mit „Kontrasubjekten“ umzugehen, gegenüber falschen Freunden war er dagegen hilflos. Hilflosigkeit war jedoch eine Eigenschaft, die ganz und gar nicht zu seinem Charakter passte. Mitleid mit seiner Person konnte er absolut nicht ausstehen, was zu Taten und Handlungen Anlass gegeben hat, die, gelinde gesagt, etwas interpretationsbedürftig sind.
In Ignaz von Mosel treffen wir ein Schulbeispiel eines falschen Freundes des Komponisten. Der selbstherrliche Publizist und Meinungsmacher betrachtete sich selbst als einen der größten Verehrer Beethovens. In seinen eigenen Worten klingt diese Bewunderung wie folgt:
Für Klavier- und Violinspieler begann eine neue Epoche durch Louis van Beethoven. Seine ersten Sonaten, seine ersten Quartette wurden mit wohlbegründetem Jubel aufgenommen… Indessen dürfte doch die Frage sein, ob nicht Beethoven selbst, wenigstens zum Teil, mit Ursache war, wenn die größere Zahl der Musikfreunde sich allmählich von seinen Kompositionen abgewendet hat. Wer erinnert sich nicht des Enthusiasmus, welchen seine ersten Sinfonien, seine Sonaten, seine Quartette erregt haben? Alle Musikfreunde waren entzückt, so bald nach Mozarts Tode einen Mann sich erheben zu sehen, der jenen so schwer Vermissten zu ersetzen versprach. Obschon ein völlig eigener Geist und Geschmack in seinen Werken atmete, waren doch – wie schon früher erwähnt- Stil und Form denen des geliebten Verklärten ähnlich. Wären sie es geblieben, so hätten wir in der Tat Mozart wiedererlangt; ….Aber siehe da, zwar allmählich, aber immer mehr entfernte er sich von der anfänglich eingeschlagenen Bahn, wollte sich eine durchaus neue brechen und geriet endlich auf Abwege.
Die Botschaft dieses Berichts lautet, dass die Individualität Beethovens – oder wie Beethoven es selbst ausdrückt: seine Eigenthümlichkeit – als eine Abirrung beschrieben wird. Nur jene Werke, in denen der Einfluss von Mozart und Haydn dominiert, lässt der Kunstrichter gelten. Als Mozart-Ersatz war Beethoven akzeptiert worden, ein Beethoven durfte Beethoven nicht sein.
Gerne würde man dieses Urteil eines dritt- oder viertrangigen Musikkenners belächeln und schnell übergehen, wäre es nicht so, dass die überwiegende Mehrheit der Zeitgenossen Beethovens eine ähnliche Meinung vertrat. Dass es hier um eine Meinung ging, welche an den Stammtischen Wiens lebendig ventiliert wurde, mag noch zu verzeihen sein. Der Mensch ist nun einmal ein Herdentier, was die kollektiven Hirngehege betrifft. Aber dass Komponisten wie Carl Maria von Weber oder Louis Spohr genau das Gleiche über Beethoven dachten wie Ignaz von Mosel, stimmt bedenklich. Auch in London war dieses Rezeptionsmuster angekommen. So hatte John Baptist Cramer um die Jahrhundertwende, als er zum ersten Mal Beethovens Klaviertrio Opus 1 mit Salomon und einem Cellisten durchspielte, noch laut ausgerufen:
Das ist der Mann, der uns für den Verlust Mozarts trösten wird.
Zehn Jahre später hielt er, wie die meisten seiner Landsleute, Beethoven für einen Komponisten, der sich seit seiner Dritten Symphonie eindeutig auf Abwegen befinde und dringend wieder solche Symphonien komponieren sollte wie die ersten zwei.
Sogar Ferdinand Ries hielt sämtliche neueren Werke seines früheren Lehrers für verrücktes Zeug, wobei bei ihm auch wohl der Ehrgeiz mit im Spiel war. Er hielt sich selbst für genauso begabt wie Beethoven und konnte es kaum abwarten, dessen Nachfolger zu werden. Er wollte kein Gralspriester sein, er wollte selber Gralskönig werden.
Es mag wie ein Paradox erscheinen, aber Beethovens Königstitel konnte niemand auch nur im Entferntesten etwas anhaben. Je mehr über die neueren Werke des Komponisten geschimpft und je schwächer dessen Gehörorgan wurde, desto klarer stand für die Welt fest, dass es nur einen unumschränkten Herrscher im Reich der Musik gab. Ludwig van Beethoven aus Wien galt unbestritten als größter Komponist unter den Lebenden.
Nicht einmal der listenreiche Metternich vermochte mit seinem Protektionskind Gioacchino Rossini gegen diese unheimliche Autorität anzukommen, auch wenn es eine Zeitlang den Anschein hatte, als würde die Beliebtheit Beethovens in Wien abnehmen. Die Wiener zeigten jedoch ihr eigenes Naturell. Auch wenn sie mal auf den eigensinnigen Komponisten schimpften, wenn es darauf ankam, ließen sie nichts auf ihren Beethoven kommen, sehr zum Verdruss Metternichs und seiner Beamten. Im unsichtbaren Machtkampf zwischen Staat und Individuum spielte Mälzels Metronom die Rolle eines Herrschaftssymbols. Ausgerechnet Beethoven sollte sich vor diesem Symbol verneigen wie der Gläubige vor dem Kreuz. Die unterschwellige Aufforderung dazu ist einem Artikel Mosels in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung vom 27. November 1817 zu entnehmen. Darin wird den „geübtesten Componisten“, und es kann kein Zweifel daran bestehen, dass diese Bezeichnung auf Beethoven gemünzt war, in umschweifender Beamtensprache nahegelegt, das Metronom während des Komponierens ununterbrochen ticken zu lassen:
Es geschieht nämlich selbst den geübtesten Componisten, dass sie, während der Erfindung eines Tonstückes von grösserem Umfange, im Laufe der Arbeit, zumahl wenn sie zufällig unterbrochen wurde, sich des Zeitmasses nicht mehr ganz genau erinnern, welches sie sich beym Anfange desselben dachten, und dann Mittelsätze anbringen, die in dem Tempo, welches für das Hauptmotiv gewählt wurde, den gewünschten Effect nicht machen…..
Lässt nun der Componist den Metronome, während er schreibt, sich fortan bewegen, so wird ihm durch die hörbaren Schläge desselben, ohne von seinem Papier wegsehen zu müssen, sein Tempo immer gegenwärtig bleiben, und er vor der Gefahr gesichert seyn, eine übrigens gelungene Composition umarbeiten oder gar bey Seite legen zu müssen, weil er in der Fortsetzung seiner Arbeit das anfänglich gewählte Tempo nicht mehr ganz getreu im Gedächtnisse behielt.
Solche Sätze gingen an die Künstlerehre Beethovens, das ist klar:
Fühllos selbst für ihres Künstlers Ehre,
Gleich dem toten Schlag der Pendeluhr,
Dient sie knechtisch dem Gesetz der Schwere,
Die entgötterte Natur.
(Friedrich Schiller: Die Götter Griechenlands)