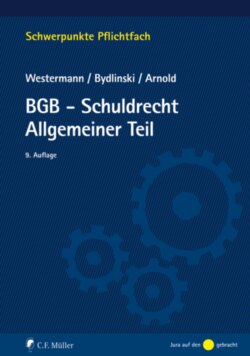Читать книгу BGB-Schuldrecht Allgemeiner Teil - Harm Peter Westermann - Страница 137
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Das Inflationsrisiko im Kontext der Geldschuld
Оглавление203
Der wirtschaftliche Wert des Geldes hängt von seiner konkreten Kaufkraft ab, die erheblichen Schwankungen unterliegen kann. Daher ist von hoher Bedeutung, wer das Inflationsrisiko trägt. Das ist für wichtige Teilbereiche in gesetzlichen Bestimmungen geregelt. Bei Geldwertschulden etwa trägt das Inflationsrisiko der Schuldner, denn erst zum Leistungszeitpunkt wird der konkret erforderliche Betrag fixiert. Weitere Sonderregeln finden sich etwa für Löhne oder Gehälter.
204
Auch die Vertragsparteien können das Inflationsrisiko vertraglich regeln. Das geschieht in der Praxis durch Wertsicherungsklauseln, die Geldschulden wertbeständig machen sollen. Das ist vor allem bei auf lange Zeit angelegten Verträgen (in der Regel also: bei Dauerschuldverhältnissen) wichtig. Häufig nehmen Wertsicherungsklauseln auf bestimmte Preisindizes Bezug. Auch kann vereinbart werden, dass Geldschulden unter bestimmten Voraussetzungen angepasst werden sollen. Wertsicherungsklauseln sind nur innerhalb der gesetzlichen Grenzen zulässig.
205
Für den praktisch wichtigen Bereich der Wohnraummiete beinhaltet § 557b eine Sondervorschrift. Neben weiteren Sondergesetzen werden die Grenzen vor allem durch das Preisklauselgesetz (PrKG) vorgegeben. § 1 Abs. 1 PrKG beinhaltet ein grundsätzliches Verbot von Wertsicherungsklauseln für Geldschulden. Allerdings sieht das Gesetz in § 1 Abs. 2 und den §§ 2 ff zahlreiche Ausnahmen von diesem Verbot vor. Nach dem PrKG unwirksame Vereinbarungen sind nicht ex tunc unwirksam, sondern erst vom Zeitpunkt des rechtskräftig festgestellten Verstoßes an. Wenn Wertsicherungsklauseln zugleich AGB sind, gelten zusätzlich die §§ 305 ff.
206
Nicht immer ist das Risiko von Geldwertschwankungen gesetzlich oder vertraglich geregelt. Dann gilt der Grundsatz des (geldschuldrechtlichen) Nominalismus[41], den man schlagwortartig mit „Euro gleich Euro“ umschreiben kann. Der Grundsatz des Nominalismus besagt, dass der Euro als Währungseinheit grundsätzlich unabhängig von seiner Kaufmacht definiert wird und nominell gleichbleibt – trotz möglicher Geldwertschwankungen. Wenn im November 2019 eine Geldschuld in Höhe von 100 Euro begründet wurde, ist sie auch im Jahre 2029 in Höhe von 100 Euro zu erfüllen, und zwar auch dann, wenn 100 Euro im Jahre 2029 eine ganz andere Kaufkraft haben, als sie es 2019 hatten. Damit wird dem Geldgläubiger das Inflationsrisiko zugewiesen. Kommt es zur Inflation, profitiert der Schuldner; er trägt aber auch die Risiken der Deflation. Der Grundsatz des Nominalismus ist zwar nirgends explizit geregelt. Er wird aber von den gesetzlichen Bestimmungen über den Ausgleich von Inflationsrisiken und vor allem den im PrKG enthaltenen Grenzen für Wertsicherungsklauseln stillschweigend vorausgesetzt.[42] In eng begrenzten Ausnahmefällen kann der Grundsatz des Nominalismus eingeschränkt sein. Insbesondere kann im Einzelfall bei schwerer Äquivalenzstörung § 313 eingreifen.[43]
Im oben geschilderten Fall 18 kann V deshalb von M nicht etwa jeweils die Zahlung des Geldbetrags verlangen, dessen Kaufkraft mit dem bei Vertragsschluss vereinbarten Mietzins übereinstimmt. Die Parteien haben auch nicht nach Maßgabe der §§ 557 ff eine Erhöhung oder Anpassung der Miete vereinbart.