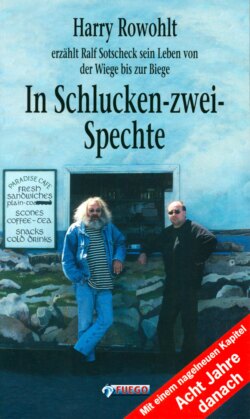Читать книгу In Schlucken-zwei-Spechte - Harry Rowohlt - Страница 7
ОглавлениеRALF SOTSCHECK: Als wir uns vor vielen Jahren kennenlernten, hatte ich noch einen Bart, und deiner war schwarz. Jetzt bin ich glattrasiert und dein Bart ist grau. Hast du mal erwogen, ihn zu färben, damit man die Essensreste nicht sieht?
HARRY ROWOHLT: Das habe ich schon mal gemacht, aber nicht wegen der Essensreste. Damals war ich Lehrling im Suhrkamp-Insel-Verlag und als solcher auch Praktikant bei der Firma »Clausen und Bosse« in Leck in Nordfriesland. Alle anderen Suhrkamp-Insel-Lehrlinge gingen zum Druckerei- und Setzerei-Praktikum nach Heidelberg und belegten Gastvorlesungen. Ich mußte in die dem Rowohlt Verlag assoziierte und von ihm auch gegründete Druckerei »Clausen und Bosse« in Leck. Das war aber nicht so schlimm. Ich fühlte mich wie in Dodge City. Leck war früher eine Cowtown. Da wurden Rinder aus Dänemark auf dem Weg zum Schlachthof durchgetrieben, weshalb es dort mehr Kneipen als Häuser gab. Manchmal gab es in einem Haus sogar zwei Kneipen. Ich hatte den Eindruck, irgendetwas muß ich von diesem Aufenthalt mitbringen, weshalb ich mir einen Bart stehen ließ. Den sah man nur im Gegenlicht, weil da nur weißblonder Flaum war. Also habe ich meine Nichte Muschi bestochen, daß sie mir in der Drogerie Polycolor-Färbe-Shampoo holt. Sie hat mir in die Hand versprochen, daß sie das niemandem sagt. Ich färbte mir diesen Bartflaum mit Polycolor dunkel, und seitdem ist der Bart sichtbar. Er blieb seltsamerweise dunkel. Der Bart hatte also gemerkt, was von ihm erwartet wurde.
Ich habe mir wegen Guinness den Bart abrasiert. Die Brauerei hat nämlich herausgefunden, daß jedes Jahr über 150.000 Pints Guinness in den Schnurrbärten der Trinker hängen bleiben. Bevor ich dem Guinness verfallen bin, hatte ich mir schon mal aus Neugier den Bart abgenommen, aber dann erkannte mich meine Tochter nicht mehr, und in die DDR wollten sie mich nicht einreisen lassen, weil ich keine Ähnlichkeit mit meinem Paßfoto hatte.
Ich sollte mal für das Zeit-Magazin einen Report über die Kneipenszene am Prenzlauer Berg machen. Der Fotograf war vierzehn Tage vor mir dagewesen und hatte die wunderschönen Kneipen fotografiert, und als ich hinkam, waren diese Kneipen, bis auf eine, aus baupolizeilichen Gründen geschlossen worden. Eine ganze Serie über eine einzige Kneipe machen, das ging ja nicht. Also hat sich die Reportage zerschlagen. In der einzigen Kneipe, die es noch gab, war ein richtiger Kellner, der sogar eine Kellnermontur trug. Eine Dame beschwerte sich: »Mein Sprudelwasser sprudelt gar nicht.« Der Kellner sagte: »Was glauben sie, weshalb ick schwarz trage.« Die DDR gab es zwar noch, aber nicht mehr lange. Überall war die Perestroika ausgebrochen, und ich bin in Ostberlin mit der S-Bahn gefahren. Der ganze Waggon diskutierte leidenschaftlich, und ein älterer Herr sagte, auf mich deutend: »Dieser junge Mann zum Beispiel hat sich, weil er mit den herrschenden Verhältnissen nicht einverstanden ist, einen Bart stehen lassen. Zu seiner Zeit trug ich ein Menjoubärtchen, det hat die Frauenzimmer wild gemacht.«
Hast du jemals erwogen, dir den Bart abzurasieren, um zu sehen, was darunter ist?
Ich hab mir mal die Stirnhöhlen, beziehungsweise die Nebenhöhlen fenstern lassen. Man kann auch Stirnnebenhöhlen sagen. Ich tendiere zu Stirnnebenhöhlen. Wenn schon, denn schon. Kurz vorher war in Hamburg ein Mann unter Vollnarkose gestorben, weil man ihn wegen des Bartes nicht beatmen konnte. Der ganze wertvolle Sauerstoff verlor sich im Bart. Also mußte der Bart ab, weshalb ich mich seit Jahrzehnten zum ersten Mal rasiert habe. Bei dieser Gelegenheit stellte ich fest, daß das Kinngrübchen, das in meinem Wehrpaß noch zu sehen ist, nicht mehr da war – ein Grübchen wie das von Kirk Douglas. Ich hatte auch kein Kinn mehr. Es war verkümmert, weil es jahrzehntelang niemand gesehen hatte. Das gibt es oft bei Organen, die nicht verwendet werden. Ich sah mit meinen blöden langen Haaren aus wie Frau Ponnwitz, so daß ich mir auch noch die Haare abgeschnitten habe. Kurz danach hatte ich eine Lesung in Braunschweig, in der Buchhandlung Leporello. Die wollten mich nicht lesen lassen, weil auf dem Plakat jemand anderes abgebildet war. Am nächsten Tag hatte ich eine Lesung in Hamburg-Barmbek beim U- und S-Bahnhof. Ich tupfte mir die Nase immer mit einem Tempotaschentuch, weil wegen der Operation noch Blut rann. In der Pause sagte eine Dame zu mir: »Ich finde das ein bißchen affig, daß so ein knorriger Typ wie Sie sich immer fein das Näschen mit einem Papiertaschentuch betupft, noch dazu mit einem Papiertaschentuch mit aufgedruckten Röschen.« Da habe ich ihr gezeigt, was es mit den Röschen auf sich hatte. Sie ist dann rückwärts in eine Zinkbadewanne voller Wasser mit Eiswürfeln und Guinness-Pullen gefallen.
Jedenfalls bist du nicht mit Bart geboren worden, sondern als unbehaartes Kriegsbaby.
Ich wurde in der Hochallee 1 in Hamburg 13 geboren. Im Luftschutzkeller, als Zehn-Monats-Kind. Immer, wenn ich soweit war, begann der Fliegeralarm, und ich dachte mir, ich bin doch nicht doof. Ich hab mir jetzt ausbedungen, daß in Kurzviten nicht mehr irgendetwas Kreatives steht. Da steht nur noch Harry Rowohlt, geboren 1945 in Hamburg 13, lebt in Hamburg Eppendorf. Für Kenner ist das ein leichter Abstieg, aber noch nicht die schiefe Bahn, man braucht sich also noch keine Sorgen zu machen.
Bei dem Nachnamen sowieso nicht. Das ist doch deine Lieblingsfrage: »Haben Sie etwas mit dem Rowohlt Verlag zu tun?« Jeder, der sie stellt, muß fünf Mark an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden, oder?
Jawohl. Es ist eine Last, wenn man Rowohlt heißt. Im Hamburger Telefonbuch stehen, außer dem Rowohlt Verlag, meiner Mutter und mir, noch zwei weitere Rowohlts, und irgendwann abends habe ich die beiden angerufen, ganz leicht angeheitert und mit entsprechend erhöhter Risikobereitschaft. Ich telefoniere eigentlich nur, wenn ich ganz leicht angeheitert bin. Wenn ich nicht betrunken bin, habe ich keine Lust, weil ich dann übersetze. Aber manchmal will man sich halt ein bißchen mitteilen. Ich habe schon erwogen, einen Alkoholmelder am Telefon anbringen zu lassen, aber dann würde ich ja gar nicht mehr telefonieren. Ich rief also die beiden übrigen Rowohlts im Hamburger Telefonbuch an, um sie zu fragen, ob es ihnen auch so auf den Wecker geht, immer gefragt zu werden, ob sie etwas mit dem Rowohlt Verlag zu tun haben? Der eine ist Weinhändler und sagte: »Nö, ich habe mich daran gewöhnt, ich weiß ja, wer ich bin.« Und der andere hieß Jörg Rowohlt, war damals Leiter der Hamburger Schwuleninitiative e.V. und klang wie jemand, der bösartig Fritz J. Raddatz nachmacht: »Was wollen Sie überhaupt von mir?«
Aber als du geboren wurdest, hattest du einen anderen Nachnamen.
Geboren wurde ich als Harry Rupp, weil meine Mutter damals in dritter und vorletzter Ehe mit dem Kunstmaler Max Rupp aus Idar-Oberstein verheiratet war. Dessen Wirken läßt sich in Idar-Oberstein immer noch verfolgen. Er hat Kunst am Bau gemacht und furchtbar herumgewütet, ganz grauenvoll. Deshalb hieß ich zunächst Harry Rupp. Als sich meine Mutter scheiden ließ, hieß ich Harry Pierenkämper-Rupp, nach dem Mädchennamen meiner Mutter. Ich war schon als Kleinkind eine männliche Doppelnamen-Tusse. Als ich schreiben lernte, gab es gewisse Probleme. »Harry« konnte ich bereits nach dem ersten Schultag schreiben. Mein Lehrer, Herr Stawitz, erklärte mir das so: Das H ist eine kurze Leiter. Das kleine a ist ein Reifen, der kaputt gegangen ist. Der Spengler repariert ihn, aber nicht besonders gut, und schon hat man ein a. Dann kommen zwei Spazierstöcke, und das y hatte ich ganz exklusiv für mich allein. Ich weiß nicht mehr, wie er das y erklärt hat, aber das konnte ich auch sofort. Nur mit dem Nachnamen haperte es, weil ich nie wußte, wie ich gerade hieß. Heute behauptet meine Mutter, sie hätte Max Rupp nur geheiratet, um ihm zwei Wochen Heimaturlaub verpassen zu können. Während der fraglichen Zeit, als ich gezeugt wurde, war er bereits in sowjetischem Gewahrsam, vulgo Kriegsgefangenschaft, weshalb er als Vater rundherum nicht in Frage kam.
Harry Rupp – das klingt wie ein Fußballreporter. »Wir schalten um ins Westfalenstadion zu Harry Rupp. Harry Rupp, bitte melden!« Wie war das nochmal mit dem Luftschutzkeller?
Ich hatte gutes Glück, daß ich nicht im Krankenhaus, sondern im Luftschutzkeller geboren worden bin. Ich war vor ein paar Jahren mal in dem lokalen Kinderkrankenhaus, das inzwischen eine halboffene Gemeindeklapsmühle ist.
Du warst in der Klapsmühle?
Nur zu Besuch. Sie hatten ein Jubiläum und eine Fotoausstellung. Ich hab mir das angesehen und dabei festgestellt, daß in diesem Krankenhaus Babys eingesammelt wurden. In der Fotoausstellung im Treppenhaus sah ich, was ich als geschichtlich interessierter Mensch hätte wissen können, daß in diesem Krankenhaus die Transporte mit den Babys zusammengestellt wurden, die wegen Euthanasie ins Gas geschickt wurden. Und meine Mutter hatte keinen Ariernachweis. Bis heute nicht. Das hat sie irgendwie verschlampt. Meine Oma mütterlicherseits war eine italienische Zigeunerin, wobei mir eine jüdische Großmutter noch lieber gewesen wäre. Da wäre ich ein bißchen plietscher, aber auf diese Weise habe ich wenigsten den Rhythmus im Blut. Kein Schwein durfte wissen, daß sie eine italienische Zigeunerin war, und deshalb hat es auch niemand erfahren. Wenn sie einen ihrer gefürchteten Ausbrüche hatte, sagte mein Opa Franz Pierenkämper immer begütigend: »Naja, dat is dat französische Blut.« Damals im Ruhrgebiet hatte man als italienische Zigeunerin, selbst wenn das geheim gehalten wurde, nicht viele Volksgruppen, auf die man herabblicken konnte, weshalb ich heute noch einen Merkvers von ihr beherrsche: »In Kruppsche Baracken, da wohnen Polacken, da laufen die Kakerlaken die Polacken in Nacken. Da nehmen die Polacken die Pickhacken und tun die Kakerlaken kaputt hacken.«
Herrje, Bochumer Büttenpoesie.
Immerhin. Was man meiner Oma gar nicht zutraute: Sie war Vegetarierin, sie kochte wie eine gesengte Sau. Um ihren Fraß nicht fressen zu müssen, habe ich irgendwann gesagt: »Ich esse alles, was auf den Tisch kommt, wenn Oma kocht«, weil ich wußte, daß sie das hören wollte. Danach hatte ich den Freibrief, den Kram meiner Oma nicht fressen zu müssen. Das Problem war nur: Ich war unterernährt und rachitisch und hatte einen stark geschrumpften Magen. Wasser und Brot waren das einzige, was ich mochte, weshalb ich hoffte, möglichst bald ins Gefängnis zu kommen. Das hat sich inzwischen leider alles sehr geändert.
Mochtest du deine Oma, abgesehen von ihren Kochkünsten?
Sie war oft im Knast, abwechselnd wegen »politisch« und Engelmacherei. Am meisten hat sie sich vor der Anstaltskleidung gegraust. Sie war ein sehr reinlicher Mensch. Einmal sagte sie: »In dem Kittel war Monate altes Unwohl drin!« Das letzte Mal ist meine Oma mütterlicherseits im Wartesaal Bonn Hauptbahnhof verhaftet worden. Sie wetterte mal wieder über Politik, und ein Herr sagte: »So eine alte Dame sollte sich um Politik nicht mehr bekümmern.« Da stieg meine Oma auf einen Stuhl und schrie: »Und der Adenauer, der alte Bock?« Und schon machte es klick. Die Bahnpolizei hatte sie verhaftet. Aber danach passierte nichts mehr. Im Krieg hat sie sich gut über Wasser gehalten. Sie hatte eine Ruine, eine alte Mühle im Hunsrück, gekauft, weil sie zu Recht annahm, daß die nicht bombardiert würde. Sie hat, weil sie Zigeunerin war und das offenbar konnte, den Bauern die Karten gelegt und ihnen geweissagt. Einmal sagte sie einer Bäuerin, ihr kleiner Sohn solle sich vor Wasser hüten, genauer gesagt, vor warmem Wasser, noch genauer, vor heißem Wasser. Und zwar in der allernächsten Zukunft, genauer gesagt, jetzt. Die Bäuerin rannte so schnell sie konnte nach Hause. Da war ihr kleiner Sohn schon in den siedend heißen Waschkessel gefallen und verbrüht. Daraufhin wurde meine Oma zum Pfarrer bestellt. Er sagte, sie solle gefälligst aufhören, diesen Aberglauben zu verbreiten. Sie hat ihn gefragt: »Warum behandeln Sie mich eigentlich so schlecht? Wir sind doch Kollegen.«
Hat sie denn an die Karten geglaubt?
Ja, meine Oma hat, im Gegensatz zum Pfarrer, an ihren Hokuspokus geglaubt. Sie plante immer, im Gegensatz zu mir, ihre Memoiren zu schreiben. Titel: »Die Königin vom Longkamperbach«. Sie konnte nicht ahnen, daß sie bei den Bauern im Hunsrück den Spitznamen »der Teufel zu Fuß« hatte. So wie meine Mutter später »der Teufel mit dem Auto« hieß. Meine Mutter ist jetzt 91, sie hat sich leider ein neues Auto angeschafft. Die Landbevölkerung ist in heller Aufregung. Sie kannten das Geräusch ihres alten Autos, das sie nur im ersten Gang fuhr, und konnten sich in Sicherheit bringen. An das neue Auto müssen sie sich erst noch gewöhnen. Sie hatte sogar mal einen BMW, den sie auch nur im ersten Gang gefahren ist. Sie fand auch nie die richtige Autobahnabfahrt. Sie ist eben Schauspielerin gewesen, und Schauspieler sind nun mal nicht allzu helle. Nach den Stücken, in denen sie mitgespielt hat, kann man sie aber noch fragen. »Käthchen von Heilbronn« hat sie noch einigermaßen drauf. Außerdem bezieht sie seit Jahrzehnten den Kalender »Mit Goethe durch das Jahr«. Meine Oma hatte einen furchtbar stacheligen Schnurr- und Kinnbart. Sie küßte einen ganz laut und aß Knoblauchpastillen, um ihr Leben zu verlängern. Sie sagte, die seien so gut, weil sie völlig geruchlos seien. Bei dem Wort »geruchlos« blätterte die Tapete von den Wänden, und auf dem Adventskranz brachen die Kerzen in Stichflammen aus, so sehr stank es nach Karbid. Meine Oma wurde nur 88, meine Mutter ist schon 91. Der Mann meiner Großmutter, Fränzken Pierenkämper, war Sitzredakteur beim Bochumer Volksblatt, das heißt, er war verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes. Wenn im Bochumer Volksblatt irgendwas erschienen war, was der Obrigkeit nicht paßte, ging er dafür in den Kahn. Sobald er im Kahn war, fing er an, Lyrik zu schreiben. Außerhalb des Knastes nur Prosa, innerhalb des Knastes nur Lyrik.
Wenn also ein Romancier mal Lyrik schreiben möchte, wäre diese Methode durchaus zu empfehlen.
Ja. Fränzken Pierenkämper war 1917 einer der führenden Köpfe im Arbeiter- und Soldatenrat von Wilna, und das als Goi. Da mußte man ganz schön was zwischen den Ohren haben. Später war er einer der ersten Minister der jungen Sowjetmacht. Da hat er sich aber nach einer Woche wieder abgeseilt – mit der Begründung: »Sind mir zu links, die Brüder.« Er hat aber später die USPD mitgegründet. Sein Sohn Harry Pierenkämper, nach dem ich benannt wurde, hatte eine Hasenscharte und stotterte, weshalb er Pantomime wurde.
Eine weise Entscheidung.
Außerdem war er Mitbegründer des Spartakus. Man kann sich vorstellen, wie muffelig es bei denen zu Hause zuging, denn es gibt ja nichts Unversöhnlicheres als Kommunisten und linke Sozis. Sie wohnten in Bochum-Weitmar, in einer Arbeitersiedlung mit lauter Häusern bis zum Horizont. Eins sieht aus wie das andere, die unterschieden sich genau wie heute nur durch die Vorgärten. Eines Morgens maulte der Alte seinen Sohn an: »Ich gehe morgen auf eine Vortragsreise, und wenn ich in zehn Tagen zurück bin, und der Vorgarten ist nicht tip-top in Ordnung, dann hast du deine Beine die längste Zeit unter meinen Tisch gestreckt.« Da hat sich der Sohn von niederländischen Genossen gelbe und rote Tulpenzwiebeln besorgt, den Vorgarten gejätet, die Tulpenzwiebeln gesteckt, und als die hervorschossen, oder was immer die so machen, sah man wunderschön deutlich einen fein säuberlichen und gelb umrandeten roten Sowjetstern mit gelbem Hammer und gelber Sichel. Der Alte sagte zähneknirschend: »Na, immerhin sieht das ordentlich aus.« Sie sind glücklicherweise beide pünktlich vor 1933 gestorben. An denen hätten die Nazis noch viel Spaß gehabt.
Deine Mutter war Schauspielerin. Wo hat sie damit angefangen?
In Bochum. Damals gab es ja noch das Fach »Jugendliche Sentimentale«: bei dem legendären Saladin Schmitt, dem Erfinder der expressionistischen dunklen Bühne, weshalb er von jedem »Saladin mit der Schlummerlampe« genannt wurde. Seine Inszenierung von Schillers »Die Räuber« hieß allgemein »Bruderzwist auf Sohle Sieben«. Er hatte eine stehende Redewendung gegenüber weiblichen Ensemblemitgliedern, indem er sie anschwulte: »Meine liebste, beste, teuerste Freundin, gehen Sie weg. Ich kann Sie nicht mehr sehen.« Sehr viel später wurde meine Mutter als Tischdame von Goebbels eingeteilt. Das wußte sie vorher nicht. Sie kam wie immer zu spät und bekam einen Wahnsinnsschreck, als nur noch neben Goebbels ein Platz frei war und ihr nichts anderes übrigblieb, als sich dorthin zu setzen. Goebbels mußte sich damals von seiner Freundin, der tschechischen Schauspielerin Lida Baarova, trennen, weil sie Halbjüdin war. Weil meine Mutter von weitem genauso aussah wie Lida Baarova, hatte man sie als Tischdame ausgesucht. Glücklicherweise saß ihr ein alter Kollege aus Bochumer Zeiten gegenüber. »Maria«, sagte der, »mach doch nochmal den Saladin Schmitt.« Also schwulte sie: »Meine liebste, beste, teuerste Freundin, gehen Sie weg. Ich kann Sie nicht mehr sehen.« Plötzlich Totenstille, weil Goebbels glaubte, sie hätte ihn nachgemacht. Auf diese Weise hat sich das mit Goebbels und meiner Mutter zerschlagen. Leider. Die hätte ich ihm nämlich gegönnt. Es wäre doch schön gewesen, wenn er sich nach einer Halbjüdin eine Halbzigeunerin eingehandelt hätte. Da hätten seine Kumpel aber irgendwann mal gedacht: »Der Goebbels, der hat aber auch einen seltsamen Weibergeschmack.«
Wann hat sie denn deinen Vater kennengelernt?
Mein Vater war im Ersten Weltkrieg in der Kavallerie gewesen, wie sich das gehört. Er war als einer der ersten dabei, als die Luftwaffe erfunden wurde. Daß er geflogen ist, hat man seiner Autofahrerei angemerkt. Glücklicherweise hatte er später einen Chauffeur. Er ist immer wieder mit seinem Verlag pleite gegangen, insgesamt fünf Mal. Deshalb bin ich auch ganz froh, daß ich nicht in den Rowohlt Verlag eingetreten bin, denn diese Tradition hätte ich als erstes wiederbelebt. Im Zweiten Weltkrieg emigrierte er zunächst nach Brasilien, obwohl man nicht so genau weiß, ob es sich wirklich um eine Emigration oder nicht vielleicht doch nur um einen Abenteuerurlaub handelte. Er kam erst zurück, als Deutschland die Sowjetunion überfallen hatte. Er dachte, daß es ja wohl nicht mehr lange dauern könne. Er ist auf einem Blockadebrecher zurückgekommen, weil er nicht erst zurückkehren wollte, nachdem Deutschland verloren hatte. Er wollte noch ein bißchen mitmischen. Es hat aber sehr viel länger gedauert, als er angenommen hatte, so daß er wieder zur Luftwaffe mußte.
Auf Kreta hat er gegen die Engländer gekämpft. Und wie! Er merkte ziemlich bald, daß die Griechen, die seit Jahren Bürgerkrieg hatten, schon seit Jahrzehnten mit denselben Spielkarten spielten, so daß jeder wußte, welches Blatt der andere hatte, so abgewetzt waren die Karten. Er hat sich mit seinen alten Verlegerbeziehungen von der Altenburger Skatkartendruckerei neue Spielkarten kommen lassen und hat sie gegen Ouzo und Retsina verscherbelt. Zweitens hat er mit Dynamit gehandelt. Aus den Bomben, die er auf die Engländer abwerfen sollte, hat er etwa vier Fünftel des Schießpulvers abgezweigt – die Bomben konnte man ja ganz leicht aufschrauben – und es gegen Naturalien an die Griechen vertschintscht. Er wußte natürlich, daß die Griechen auch noch etwas anderes damit gemacht haben, als das Dynamit zum Fischen zu verwenden, aber das war ihm auch ganz recht. Anschließend hat er brav seine Bomben ins Gelände geschmissen, wo sie kein Unheil anrichten konnten, und sie haben auch schön geknallt, aber sonst waren sie harmlos.
Eine dieser Bomben hat er aus Versehen auf eine englische Feldküche geschmissen, die so gut getarnt war, daß man sie beim besten Willen aus der Luft nicht sehen konnte. Die machte »Peng«, ganz zaghaft zwar, aber sie hat dennoch einigen Schaden angerichtet. Da hatte er ein so schlechtes Gewissen, daß er den nächsten Fliegerangriff auf der Tragfläche mitflog, weil er dachte, wenn es ihn herunterwehen würde, hätte er selbst schuld – Gottesgericht sozusagen. Seine Einstellung wurde schließlich ruchbar, und zu einer Zeit, als sie bereits Kinder und Greise einzogen, wurde er wegen politischer Unzuverlässigkeit unehrenhaft aus den Heeresdiensten entlassen und langweilte sich fortan in Grünheide bei Berlin.
Mein Vater hätte den Zweiten Weltkrieg fast verpaßt, weil man ihn mit seinem Vater verwechselt und ihn für tot erklärt hatte. Nach einem kurzen Einsatz in Nordafrika bekam er dann Tropenfieber und verbrachte den Rest des Krieges im Lazarett in Italien. Wie ist es deinem Vater denn zum Kriegsende ergangen?
Weil mein Vater immerhin in zwei Weltkriegen Erfahrungen gesammelt hatte, wurde er Hauptmann. Das war er, glaube ich, schon im Ersten Weltkrieg, im Zweiten ist nicht viel dazukommen. In Friedenszeiten wird man ja schneller befördert als in Kriegszeiten. Nun sollte er den Volkssturm von Berlin-Grünheide organisieren. Mein Vater kannte niemanden in Grünheide. Sein Nachbar, ein sozialdemokratischer Tischler, hat zwei Listen angefertigt, eine mit Nazis und eine mit Nicht-Nazis. Mit den Nazis ist mein Vater in den Wald gegangen und hat sie Griffe kloppen lassen. Er hat ihnen die Eier geschliffen, bis ihnen das Arschwasser in der Kimme kochte. Der Tischler requirierte mit den Nicht-Nazis Nahrungsmittel, weil ein Volkssturm ja von irgend etwas leben mußte. Abends lagen die Nazis auf ihren Betten, verbanden sich ihre Wunden und Blasen, stöhnten und hatten Muskelkater. Mein Alter, der Tischler und die Nicht-Nazis soffen währenddessen die Nahrungsmittel weg, die sie tagsüber requiriert hatten.
War deine Mutter damals bei ihm in Grünheide?
Nein, sie hatte sich nach Hamburg abgesetzt. Nach der Schließung des Schiller-Theaters wurde es plötzlich wichtig, ob man einen Ariernachweis hatte, aber sie war ohnehin zu schwanger, um noch das Gretchen spielen zu können, obwohl das natürlich gut gepaßt hätte, bei dieser Kindsmörderin. Zum Emigrieren war es auch schon viel zu spät, und da haben ihr alle geraten, nach Hamburg zu gehen. »Das ist fast so gut wie emigriert, denn die Hamburger fiebern den Engländern entgegen, um sich endlich ergeben zu dürfen.« So bin ich Hamburger geworden.
Und dein Vater ist 1945 nachgekommen?
Er hat sich von seinem Volkssturm in Grünheide abgesetzt. Den sozialdemokratischen Tischler ernannte er zu seinem Nachfolger mit dem dienstlichen Befehl, beim ersten Russen, den sie sehen, sofort weiße und wenn möglich auch ein paar rote Fahnen zu hissen. Auf diese Weise ist der Volkssturm in Grünheide bei Berlin geschlossen in sowjetische Kriegsgefangenschaft gegangen und geschlossen zwei Tage später wieder entlassen worden, weil er so vorbildlich die Waffen gestreckt hatte. Insofern sehe ich in meinem Alten durchaus einen Kriegshelden. Er ging dann mehr oder weniger zu Fuß nach Hamburg, um zu sehen, was da läuft. Geheiratet haben meine Eltern erst, als ich schon zehn Jahre alt war. Ich fand das immer noch verfrüht. Nur weil ein Kind da ist, tut man das doch nicht.
Seitdem heißt du Rowohlt?
Wenn ich Bücher signiere, die ich aus dem irischen Englisch übersetzt habe, und ich nicht immer ein Harry Rowohlt hinsetzen will, schreibe ich auch manchmal Harry auf irisch. Wie man das macht, habe ich in Dublin in der »Harry Street« abgekupfert. H E A R A I D H. Es ist also ganz einfach. Und dann schreibe ich Hearaidh FitzRowohlt, wobei Fitz als Präfix für uneheliche Geburt steht. Meine Eltern haben mich dann leider doch ehelich gemacht.
Und wo bist du aufgewachsen, als du noch unehelich warst?
Ich war jetzt zwar geboren, aber ich erinnere mich natürlich nicht mehr daran. Ich wuchs nicht in meiner Heimatstadt Hamburg auf. Dieses Hamburger linksradikale Straßenorchester »Tuten & Blasen« hat sich mal geweigert, mich als Trommler aufzunehmen, weil ich nicht ordentlich Noten lesen kann. Da bleibt mir als letzte Zuflucht nur noch der »Shanty-Chor des Vereins gebürtiger Hamburger e.V.« Die können mich nun wirklich nicht zurückweisen. Sogar für den früheren Hamburger Bürgermeister Henning Voscherau ist eine Ausnahme gemacht worden. Der wurde nämlich nicht in Hamburg geboren, sondern hart an der Grenze. Irgendwo im Landkreis Storman. Auf jeden Fall ist er kein gebürtiger Hamburger – im Gegensatz zu mir. Bewußt aufgewachsen bin ich in Wiesbaden im Alter von zwei bis sechs. Mit großem Genuß. Wir hatten einen wunderbaren Kindergarten. Lauter Schauspielerinnen und Künstlerinnen – also das, was man heutzutage als alleinerziehende Mütter bezeichnen würde – haben zusammengelegt und eine Kindergärtnerin bezahlt, die wir alle sehr liebten. Sie hieß Tante Renate. Das war ein Kinderladen lange vor der Zeit. Vor ein paar Jahren hatte ich meine erste Lesung in Wiesbaden und erzählte in der Einschleimphase von dieser Wiesbadener Zeit. In der Pause kam eine sehr süß anzusehende ältere Dame und gab sich als Tante Renate zu erkennen. Ich habe sie gefragt, wie alt sie ist, und plötzlich wurde mir klar, warum wir sie so geliebt haben. Sie war damals sechzehn Jahre alt, also nicht wesentlich älter als wir. Mein bester Freund war Timmi Belwe. Damals hatte Tante Renate ein neues rattenscharfes Sommerkleid an, dunkelblau, fast schwarz, mit großen weißen Tupfen. Sie sah sowas von zum Anbeißen in diesem Kleid aus, daß wir fanden, man müßte ihr das sagen. Timmi meinte, ich solle es ihr sagen. Ich sagte, nein, sag du es ihr doch. Wir hatten beide Schiß, und aus Buße haben wir die Türpfosten der Kindergartenhaustür – ich links, er rechts – von ganz unten bis soweit, wie wir hochkamen, abgeleckt. Das schmeckte sehr eklig nach Staub und Leinöl und war eine angemessene Buße. Wenigstens haben wir uns keinen Splitter in die Zunge gezogen. Viel, viel später habe ich mal in Pardon ein Foto von einem bärtigen langhaarigen Mann gesehen, der ziemlich wüst aussah und die Zunge herausstreckte, und ich dachte, der sieht aus wie mein Freund Timmi Belwe. Der hatte übrigens keine eigene Schultüte, deshalb halten auf dem offiziellen Foto »Mein erster Schultag« Timmi und ich zusammen dieselbe Schultüte, nämlich meine. Aber er hält sie so, als wäre es seine, während mir nur das dünne Ende blieb.
Und? War er es denn auf dem Foto in Pardon?
Es stellte sich heraus, daß Timmi inzwischen Frontmann der Gruppe »Soul Caravan« war. Die kamen, wie damals alle, gerade aus Indien zurück, hatten einen Gig in Wiesbaden und wurden an der Grenze festgehalten, weil sie Preßtee dabei hatten. Der sah aus wie Shit, dabei sieht Preßtee sehr schön aus, mit reingepreßten Mustern. Kein Dealer würde so schön gepreßten Shit verkaufen. Die Jungs von »Soul Caravan« sagten zu den Grenzern: »Wir haben morgen einen Gig und müssen weiter. Könnt ihr nicht einfach was von diesem Tee abhacken und versuchen, das entweder in der Pfeife zu rauchen, oder Tee davon zu brühen, dann merkt man doch, ob das Shit ist oder nicht.« Sie haben den Gig dann doch noch gekriegt. Damals haben sie schwer politische Texte gemacht, so daß ihnen die politische Polizei auf diesem Konzert den Strom abgedreht hat, wodurch aber nicht nur die Verstärker ausfielen, sondern auch das Licht. Also hat die politische Polizei das Licht wieder angemacht, und da hatten die Mitglieder der Kapelle »Soul Caravan« die Hosen heruntergelassen und zeigten ihre Ärsche. Daraufhin bekamen sie einen Prozeß wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Den haben sie aber gewonnen, weil der Richter sagte, sie konnten nicht damit rechnen, daß plötzlich das Licht wieder angehen würde, und wenn jemand im Dunkeln die Hose runterläßt, ist das kein öffentliches Ärgernis, sondern streng privat. Timmi ist zwar älter als ich, aber wir sind dennoch zusammen eingeschult worden. Das lag daran, daß meine zweite Verlobte Katharina eineinhalb Jahre älter war als ich. Die ging nun in die Schule, konnte plötzlich lesen und schreiben, und ich war kein Umgang mehr für sie. Da hab ich meine Mutter so lange angemault, bis ich auch in die Schule durfte, ein Jahr zu früh. Das war später ganz günstig, weil ich immer noch der Jüngste in der Klasse war, als ich mit siebzehn sitzenblieb.
Damals machte man ja mit achtzehn Abitur und wurde mit einundzwanzig mündig. Inzwischen ist es umgekehrt. Was ist denn aus deiner Verlobten geworden?
Katharinas Mutter war auch Schauspielerin und Timmis Mutter war Sopranistin. Als Timmi im Kindergarten meiner zweiten Verlobten Katharina dreimal hintereinander die Bauklötze umgeschmissen hatte, sagte Katharina zu mir: »Harry, unternimm was!« Da haben wir uns geprügelt, und ich habe ihm ein großes Stück Frisur samt Kopfhaut abgerissen. Das war mir sehr unangenehm, und eine Zeitlang habe ich mich aus Scham geweigert, in den Kindergarten zu gehen. Ein paar Tage später trafen meine Mutter und ich zufällig Timmi und seine Mutter beim Spazierengehen. Die Mütter keiften heftig aufeinander ein, was sich wirklich eindrucksvoll anhörte – Timmis Mutter, der Koloratursopran, und meine Mutter mit Atemstütze, die inzwischen nicht mehr die jugendliche Sentimentale war, sondern Hauptrollen spielte! Die konnte also auch ganz gut brüllen. Timmi und ich sind auf eine Kiefer geklettert und haben die beiden keifenden Mütter mit Kiefernzapfen beworfen, weil Timmi es völlig in Ordnung fand, daß ich ihm den Haarbüschel aus dem Kopf gerissen hatte. Es ist inzwischen alles prima nachgewachsen. Ich habe das überprüft.
Was war dein erstes Buch?
Meine Mutter hat mir immer »Pu der Bär« vorgelesen. Als ich drei war, hat sie damit angefangen, und das war ein Grund, weshalb ich endlich selber lesen können wollte: damit ich das unbehelligt von der mütterlichen Betonung lesen konnte. Aber davon abgesehen war es sehr angenehm, vorgelesen zu bekommen. Deshalb habe ich auch heute noch kein schlechtes Gewissen, wenn ich über die Käffer tingele und den Leuten etwas vorlese.
Wer kam nach Tante Renate und Katharina?
Meine Mutter verkrachte sich ständig mit ihren Dienstmädchen. Wenn sie das alleine nicht schaffte, kam meine Oma und hat auch noch mitgemischt. Das war ziemlich lästig. Sobald man sich an eine gewöhnt hatte, war sie auch schon wieder gefeuert. Meine absolute Lieblingsfrau hieß Ingeborg. Da hatte ich mich von Tante Renate schon emanzipiert. Ingeborg war mit lauter Binnenschiffern verwandt, und wenn die in Wiesbaden festgemacht haben, waren Krach und Wonne angesagt. Das konnte nicht lange gutgehen. Meine Oma fand das entsetzlich. Danach mußte ich weg, weil meine Mutter am Zürcher Schauspielhaus ein Engagement bekam. Ich wurde allerdings nicht nach Zürich, sondern nach Herrliberg in der Nähe von Zürich in eine Kleinkinderbewahranstalt gesteckt. Meine Mutter wohnte möbliert bei Herrn und Frau Huber, und ich war in dieser kleinen Anstalt, ein entsetzliches Haus. Aus Deutschland und immer noch leicht unterernährt, kam ich in die reiche Schweiz und wurde erstmal gezielt und systematisch ausgehungert. Außer mir gab es noch zwei weitere Kinder. Das eine war ein zurückgebliebenes kleines Mädchen, welches von Frau Bopp, der Leiterin, isoliert wurde. Ich habe mich ein paar Mal zu ihr geschlichen und ihr das Wort Tasse beigebracht. Die konnte überhaupt nicht sprechen. Und dann gab es noch ein Baby. Bei dem hat Frau Bopp eine Art Scheinschwangerschaft entwickelt. Sie prozessierte gegen die Mutter dieses Babys und wollte sie für unzurechnungsfähig erklären lassen, damit sie das Baby behalten konnte. Eine sehr unerfreuliche Geschichte. Das ganze wurde angeblich nach Montessori-Gesichtspunkten geführt. Noch heute, wenn ich das Wort Montessori höre, denke ich an die Kapelle »KISS«, mit dem SS-Logo in der Mitte: MonteSSori.
Hast du nur schaurige Erinnerungen an Herrliberg?
Nein, glücklicherweise habe ich Alfred Polgar kennengelernt, der damals in Zürich im Hotel Urban wohnte. Wir haben uns angefreundet, soweit sich so ein wunderbares Jahrhundertgenie wie Alfred Polgar mit einem Sechsjährigen überhaupt anfreunden kann. In der Biographie von Ulrich Weinzierl steht, so beißend er gegenüber Männern sein konnte, so charmant war er gegenüber Frauen und Kindern. Weinzierl führt dann ganz viele Frauen als Beispiel auf, aber kein einziges Kind. Ich habe Weinzierl geschrieben, ich wäre ein Kind, das er hätte erwähnen können.
Du gibst ja gerne mit deinem Brief von Alfred Polgar an.
Ja. Ich besitze einen Brief von Alfred Polgar, und wie jeder, der einen Brief von Alfred Polgar besitzt, gebe ich entsprechend damit an. Bei Robert Gernhardt scheine ich es irgendwann mal übertrieben zu haben, weil er genervt sagte: »Ja, ja, du hast einen Brief von Alfred Polgar.« Und ich hab gesagt: »Ja allerdings, ich hab einen Brief von Alfred Polgar. Du hast keinen Brief von Alfred Polgar.« Robert machte den geballten Balten und sagte: »Meine hat alle der Russe.« Wir haben ihn mal in seiner albernen Toscana besucht, wo der PCI, der Partito Comunista Italiano, bei den Kommunalwahlen dreiundsiebzig Prozent abgestaubt hatte, und Robert sagte: »Da ist man nun dreimal vorm Russen abgehauen und dann das.«
Als Schauspielerin ist deine Mutter doch sicher viel herumgekommen. Mußtest du immer im Schlepptau mit?
Ich war insgesamt auf sechzehn oder achtzehn verschiedenen Schulen, weil meine Mutter von Engagement zu Engagement eilte. Und als meine Eltern geheiratet hatten, war mein Vater auf der Flucht vor dem Rowohlt Verlag. Er mußte angeblich im Allgäu wohnen, wegen der Höhenluft. Alles Quatsch. Er hat sich im neuen Rowohlt Verlag in Reinbek bei Hamburg nicht zurechtgefunden. Aber er hat da ohnehin nichts getan, weil der Laden inzwischen von meinem Brüderchen, Heinrich Maria Ledig-Rowohlt, geschmissen wurde, der das sehr viel besser konnte.
Wie hast du dich denn mit deinem Brüderchen verstanden?
Ich war völlig durch den Wind, als er gestorben ist. Seine letzten Worte waren: »Na, jetzt langt es aber auch allmählich.« Während der Buchmesse im Café Laumer, was zur Buchmessenzeit Café Rowohlt heißt und wo man Gutscheine trinken kann, hab ich zu meinem Brüderchen gesagt: »Ich gehe jetzt ins Café Rowohlt und gebe mich als junger Herr Laumer zu erkennen.« Wir sind zusammen vom »Hessischen Hof« zu Fuß hingegangen. Damals war mir noch nicht klar, daß es ihm sehr viel schlechter ging, als man ihm anmerkte. Das waren vielleicht hundertachtzig Meter, da hat er schon geklagt, und danach hat er den Weg vom »Hessischen Hof« ins Café Laumer immer »unsere gemeinsame Nachtübung« genannt. Da haben wir unabhängig voneinander »Matjes Hausfrauenart« bestellt und beide unabhängig voneinander gesagt: »Hausfrau bedeutet nicht Strapse, sondern Äpfel.« Daraufhin meinte er: »Man merkt eben doch, daß wir Brüder sind.«
Woran ist er gestorben?
Er war in Indien auf der Buchmesse, in Delhi, und Inge Feltrinelli hat ihn ziemlich herumgescheucht, was Vergnügungen betraf. Er ist mit der Eisenbahn gefahren, dem »rollenden Palast«, der durch übertriebenes air-conditioning furchtbar unterkühlt war. Dabei hat er sich eine Lungenentzündung geholt und ist in Agra im Angesicht des Tadsch Mahal gestorben. Er ist sofort verbrannt worden, allerdings ohne Witwe. Die Urne mit seiner Asche hat seine Witwe Jane nach Lavigny, aufs Schloß in der Schweiz gebracht und auf den Kaminsims gestellt. Sie wollte nach ihrem Tod, der sie auch ziemlich schnell ereilte, ebenfalls verbrannt werden, und anschließend sollte ihrer beider Asche vermischt und in ihrer Familiengruft in der Nähe von London beigesetzt werden. Das war die Gruft ihres Vaters, ein reicher Schotte, der in der Eliteeinheit »The Black Watch« gedient hatte. Die trugen schwarze Kilts und wurden deshalb »The Devil’s Ladies« genannt. Er nannte seinen Schwiegersohn immer Adolf, weil er Deutscher war. Sehr witzig. Das war eine ausgesprochen blöde Beerdigung. Die beiden waren in der Urne zwar richtig schön miteinander gemischt worden, aber niemand hielt eine Trauerrede. Wenn in der Aussegnungshalle wenigstens ein Harmonium gestanden hätte! Dann hätte man mit Anspielung auf die Urne und ihren Inhalt spielen können: »Oohoohoo, ooh, yeah, yeah, I’m all shook up!«
Hatte dein Bruder eigentlich Kinder?
Heinrich Maria hatte zwei Töchter: eine leibliche, die er enterbt hat, weil sie ihr Erbe zu seinen Lebzeiten ausbezahlt haben wollte, um sich in München eine Boutique einzurichten. Und eine unleibliche, die vom Briefträger oder vom Milchmann stammte. Ich habe sie anläßlich der Beisetzung von Heinrich Marias Witwe in London getroffen. Sie ist mit einem Schweizer Anwalt oder Börsenmakler oder irgend so was Nützlichem verheiratet, wohnt seit unvordenklichen Zeiten in Zürich und ist eine richtig wohlsituierte Schweizerin. Es gibt ja vier Schweizer Sprachen, also Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch, und sie meinte tatsächlich, Rätoromanisch hätte englische Wurzeln.
Du hattest doch auch eine Schwester, oder?
Meine Halbschwester Anna Elisabeth, genannt Baby, ist während der brasilianischen Emigration meines Vaters gezeugt und geboren worden, in einer Favela in São Paulo. Dort hat sie sich offenbar auch den Hautkrebs zugezogen, an dem sie dann gestorben ist, weil sie als Rotblonde immer mit den Caboclos – das sind Schwarzafrikaner und Indiomischlinge, die sehr viel gesünder pigmentiert waren als sie – im Schlamm gespielt hat. Kennengelernt hab ich sie, als ich sechs Jahre alt war, und hab mich prompt in sie verknallt. Sie war ein rundherum angenehmer Mensch, ich habe aber leider so gut wie nie von ihr Gebrauch gemacht. Wir haben uns immer sehr geliebt, auf die Entfernung. Sie ist dann irgendwann nach Deutschland gekommen, doch wir sind einander so gut wie nie über den Weg gelaufen.
Erzähl ein bißchen mehr von deinem Vater.
Ernst Rowohlt war einer der wenigen Menschen, der gar nichts konnte. Es war erstaunlich, wie unbegabt er in jedem Bereich war. Einfach toll. Das hat man ja manchmal, und dann kann man diese Leute nur als Genies bewundern. Irgendeiner seiner Autoren hat mal gesagt, er sei ein Genie der Freundschaft gewesen. Er war viermal verheiratet, hauptsächlich mit Schauspielerinnen. Er hatte den Ehrgeiz, sie aus ihrem Beruf zu entfernen, damit sie sich nur noch um ihn kümmerten. Wenn er das mit Straßenbahnschaffnerinnen gemacht hätte, wären die vielleicht sogar froh gewesen. Ich habe ihn erst in einer Zeit richtig erlebt, als er alt und miesepetrig geworden war. Er war eigentlich immer nur alt und krank und muffelig und hat, weil er sich nicht mehr in den Rowohlt Verlag hineingetraut hat, versucht, zu Hause den Laden zu terrorisieren. Mein Brüderchen hat es nie geschafft, sich gegen ihn aufzulehnen, während ich das bereits mit dreizehn oder vierzehn gemacht habe. Danach waren wir praktisch unzertrennlich. Ich mußte spätestens um zehn zu Hause sein. Ich habe immer erst meine Mutter gefragt, wann ich von der Fete zu Hause sein sollte, und dann habe ich meinen Vater gefragt: »Wenn’s gemischt wird, pünktlich.« Daran halte ich mich bis heute. Ich gehe immer weg, wenn’s gemischt wird. Ich habe ihm auf seinem Totenbett, von dem wir beide noch nicht ahnen konnten, daß es sein Totenbett sein würde, den gesamten Schwejk, den ersten und zweiten Band, mit verteilten Rollen vorgelesen. Bei der Stelle: »... den Kokoschka Ferdinand, der was den Hundsdreck sammelt«, ist er wegen der pastosen Technik des Kokoschka Oskar vor Lachen aus dem Bett gefallen und hat meine Mutter angeröhrt: »Kommando zurück, der Junge wird nicht Verleger, der Junge wird Schauspieler.« Das war eine schöne Zeit, die letzten anderthalb Jahre mit meinem Alten, als er plötzlich gemerkt hat, daß sein anderer Sohn ein Mensch ist, und ich plötzlich gemerkt habe, daß mein verachteter Vater auch ein Mensch ist. Da hätte er gerne noch ein bißchen länger rummurkeln können, aber das ist eben nicht gelungen. Wozu auch. Das war kein Leben für ihn, sich nicht in den Verlag zu trauen, und zu Hause Zoff. Seine letzten Worte waren, und das war ganz typisch für ihn, eine Mischung aus Bestellung und Beschwerde: »Eigentlich ist doch jetzt Bockbierzeit.« Also hat er noch ein Bockbier bekommen, und dann ist er abgekratzt.
Einfach so?
Er hatte früher schon mal einen Herzinfarkt. Unser Hausarzt in Hamburg, Professor Dr. Kurt Gröbe, der damalige Spitzenkandidat der Hamburger DFU, hat ihm einen Hund verschrieben, damit er jeden Tag zweimal spazieren gehen mußte.
Gibt’s den auf Krankenschein?
Nö. Aber sollte es. Der erste Hund war ein Polizeihund, dessen Hundeführer an die Polizeischule nach Eckernförde befördert worden war. Dort hat der Hund den ganzen Tag Bürodienst geschoben und wurde immer trübseliger, weil er Streife gehen wollte. Deshalb war er billig abzugeben. Vater, Mutter und ich sind hingefahren und kamen in das Büro, wo der Hund unter dem Schreibtisch saß. Er hat sich auf mich gestürzt und umgeschmissen, weil Boxer ja sehr kinderlieb sind. Boxer sind nach einem ziemlich komplizierten System gestrickt. Was größer ist als er selbst, wird bekämpft, was genau so groß ist, wird gevögelt, was kleiner ist, wird beschützt. Deshalb gucken Boxer so besorgt, weil sie jeden Tag etwa 80.000 Entscheidungen treffen müssen. Ich wurde also beschützt, weshalb er mich erstmal hingeschmissen hat. Die zwei Spaziergänge jeden Tag mit meinem Vater haben ihm überhaupt nicht genügt. Deshalb ist er immer auf eigene Faust auf dem Oberalsterwanderweg Streife gegangen, um nach dem Rechten zu sehen. Wir hatten ein Gatter, das in der Mitte etwas höher als links und rechts war, und er ist immer über die höchste Stelle gesprungen, um zu zeigen, was er kann. Sein Nachfolger Toxi ging auch auf dem Oberalsterwanderweg Streife, aber der hat sich ein Loch unter den Zaun hindurch gegraben. Er war von Beruf nicht Polizist, sondern Schauspieler, neigte also eher zur Bequemlichkeit. Eigentlich hieß er nicht Toxi, sondern »Erlo von der Kollau«. Er war ursprünglich für den König von Nepal gezüchtet worden, der dann jedoch starb. Der Thronfolger fragte sich, was soll ich hier mit so einem kurzhaarigen Hund, der friert doch den ganzen Tag – und hat ihn wieder abbestellt. Er mußte dann tingeln gehen, damit das Geld wieder reinkam. Er hat in diesem Rührstück »Toxi« mitgespielt. Der Film handelte von einem Besatzungskind, gespielt von einem kleinen, farbigen Mädchen, das nicht wesentlich älter war als er und vor den Kameras und dem Regisseur und den Maskenbildnern Angst hatte. Die haben ihr zum Trost Toxi, also Erlo, als Welpen beigesellt. Er selbst ist in dem Film nie zu sehen. Ich dachte immer, er hätte da mitgespielt. Hat er aber nicht, und wenn, dann ist er rausgeschnitten worden. Elke Heidenreich hat mir den Film mal im Fernsehen auf Video aufgenommen und mich furchtbar beschimpft. Sie hätte die ganze Zeit geguckt, ob ein Boxerwelpe vorkommt. Weit und breit kein Boxer. Zum Beweis hat sie mir die Kassette geschickt.
Vielleicht hat der Hund ja nur als Dialektcoach mitgewirkt.
Danach bekam ihn Hubert von Meyerinck. Beziehungsweise Hubsi von Meyerinck. Seit dieser Zeit hatte der Hund eine Abneigung gegen Schwule. Wenn jemand zu Besuch kam, von dem man nicht so richtig wußte, ob er schwul ist oder nicht, merkte man es spätestens an der Reaktion des Hundes. Er fing an zu knurren, sein Rükenfell sträubte sich, und er ging steifbeinig rückwärts aus dem Raum. Das war ihm selber peinlich, weil man doch zu Besuch nett sein muß, besonders als Boxer, die ja allgemein sehr freundlich sind. Es war schön anzusehen, wie er darunter litt, aber seine Abneigung war stärker als er selbst.
Er war ein ausgesprochener Charmebolzen. Meine Eltern und ich sind mal im Harz, in der Nähe der Zonengrenze, spazieren gegangen. Damals war die Grenze noch offen. Ein Bundesgrenzschützer kam und sagte: »Fast wären Sie jetzt auf das Gebiet der Ostzone gelatscht. Das ist ja ein schöner Hund.« Mein Vater antwortete: »Schön vielleicht, aber er ist so verspielt und gutmütig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der die Schutzhundprüfung bestanden haben soll.« Der Bundesgrenzschützer brach einen großen Ast ab und ging ohne Vorwarnung auf meinen Vater los. Da hättest du den verträumten und gemütlichen Toxi sehen sollen. Er ging dem Bundesgrenzschützer gezielt an die Kehle, so daß der richtig in Gefahr geriet. Seitdem haben wir den Hund gesiezt.
Toxi konnte sogar Leute nachmachen. Das hat man ja auch nicht oft. Ich habe neulich Robert Gernhardt tödlich beleidigt. Der hat seine »Bella« in der Toskana als Welpe aus dem Mülleimer gefischt, halb Pointer und halb Dalmatiner. Dalmatiner sind, wie wir alle wissen, ziemlich dämlich, und Pointer sind Jagdhunde. Ich habe Robert furchtbar beleidigt, indem ich behauptete, Jagdhunde seien humorlos. Boxer hingegen haben wirklich Humor. Die sind zwar ursprünglich als Bullen-Beißer auch Jagdhunde gewesen. Sie haben diesen vorstehenden Unterkiefer, um sich am Auerochsen festbeißen zu können. Wenn dann so fünf, sechs Stück am Auerochsen hängen, wird er matt. Und anschließend wird er mit Speeren erlegt. Aber sonst hatten die Hunde nicht viel zu tun und sind deshalb freundliche Familienhunde geworden.
Du sagtest, euer Köter konnte Menschen nachmachen?
Ja. Meine Mutter hat diese alte Wassermühle im Hunsrück von ihrer Mutter geerbt. Ernst von Salomon war dort zu Besuch. Er hatte in seiner Eigenschaft als Freikorpskämpfer einmal von einem Demokraten ordentlich eins aufs Nasenbein bekommen, weshalb er Zeit seines Lebens furchtbar schnarchte. Salomon schlief unten im Gästezimmer, und Toxi machte sich Sorgen, weil der so schnarchte. Das hatte er noch nie in der Lautstärke gehört. Der Hund machte die ganze Nacht kein Auge zu. Meine Mutter wachte irgendwann nachts auf und ging pinkeln, und Toxi führte sie ganz aufgeregt oben an den Treppenabsatz, guckte nach unten und machte »Rhrhrhrhrhrh«. Daraufhin weckte mich meine Mutter, und Toxi führte mir das auch nochmal vor. Es hat ihm keine Ruhe gelassen, daß ein Mensch solche Geräusche macht. Ein Hund, der Leute nachmachen kann – das hat man doch selten.
Da hätte er bei mir auch seine Freude gehabt. Ich habe mal in Berlin bei Freunden in einer Wohngemeinschaft übernachtet, im Flur. Am nächsten Morgen hatte einer der Bewohner einen geschwollenen Arm, weil ihn seine Freundin die ganze Nacht angeknufft hatte. Sie dachte, er schnarcht so verheerend, bis sie im Morgengrauen merkte, daß ich es war – durch zwei geschlossene Türen hindurch. Ein Hund, der Schnarchen nachmachen kann, ist mir allerdings noch nicht begegnet.
Toxi konnte noch mehr. In Westerland auf Sylt hab ich mir mal weiße Turnschuhe gekauft. Toxi war dabei und guckte in einen Ganzkörperspiegel, den es in Schuhläden oft gibt, damit man sieht, wie der Schuh am gesamten Menschen wirkt. Er guckte also ausgiebig seine Füße und anschließend uns an – sehr vorwurfsvoll. Weil meine Mutter sich Schuhe kaufte, dachte Toxi, er wäre doch allmählich auch mal dran. Es war ganz deutlich zu sehen. Er sah im Spiegel seine unbeschuhten Füße an, guckte dann ziemlich trübselig in unsere Richtung und dachte: »Da reißt man sich den Arsch auf für diese Familie, aber da hast du dich geschnitten, wenn du glaubst, daß wenigstens zwei Paar Schuhe für dich rausspringen.«
Toxi fuhr gerne Auto. Im Allgäu auf der Voralpenstraße hielten immer die Autos an, weil die Leute das Panorama genießen wollten. Da sprang Toxi rein und ließ sich bis zum nächsten oder übernächsten Kaff einen Lift geben, weil er so gern Auto fuhr. Wenn die Leute ihn zur Polizei bringen wollten, sprang er heraus und versuchte, einen Lift zurück zu bekommen, was natürlich viel schwieriger war. Dann kam er oft mit blutenden Pfoten nach Hause. Schließlich machte meine Mutter den Führerschein. Es ist ein Verbrechen, daß sie ihn bekommen hat. Toxi hat sich in Nullkommanix das Autofahren abgewöhnt.
Du erzählst so viel von euren Kläffern, bist du etwa ein Hundenarr?
Nein, Hunde sind mir ziemlich wurscht. Bis auf Trulla, die war eine echte Ausnahme. Das war ein Neufunddackel in München, mit dem ich sehr befreundet war. Also: Vater Dackel, Mutter Neufundländerin, das heißt ein Riesenbernhardinerkopf, und dann war auch schon Schluß, da war der Hund zu Ende. Er gehörte Rita und Rüdiger Ullrich. Rüdiger Ullrich ist der Bruder der verstorbenen Almut Gernhardt. Rüdiger und Rita sind Psychotherapeuten und mußten in die Toskana fahren, weil sie da irgendwas vergessen hatten. Sie haben Ulla und mir Trulla überlassen, weil ich so gut mit Trulla konnte. Das war sehr angenehm. Trulla hat immer mit ihrem Kopf auf meinem Matratzenlager gepennt, der übrige Hund, den man ansonsten vergessen konnte, pennte außerhalb. Wenn Ulla morgens zur Arbeit ging, nahm sie Trulla mit, damit sie pinkeln konnte. Einmal um den Block und wieder rein. Trulla legte dann wieder diesen Riesenkopf auf mein Matratzenlager, und sobald ich einigermaßen wach war, tat sie so, als hätte sie gleich einen Blasenriß: »Ich muß ja sooooo dringend vor die Tür.« Trulla hatte genauso wie ich eine absolute Kneipennase. Wir sind vorzugsweise in München in den »Soller« in der Talstraße gegangen. Den »Soller« gibt es inzwischen nicht mehr. Da spielte morgens schon ein Stimmungstrio, und Trulla bekam immer einen Riesenknochen, mit dem sie nicht mehr durch die Tür kam. Die sahen nur diesen Bernardinerkopf unterm Tisch, und deshalb hat sie den entsprechenden Knochen bekommen. Die Kapelle, das Stimmungstrio, habe ich sehr geliebt. Der Frontmann fragte mich mal auf dem Weg zum Klo nach meinen Musikwünschen: »Mogst Kanntrie hean?« Ich mochte. Dann haben sie eineinhalb Stunden Western-Swing gespielt. Eine längst ausgestorbene Musikgattung, für die man wirklich etwas können muß. Der große Chet Atkins hat das begründet. »Bob Wills & his Texas Playboys« war die erste Kapelle, die das machte.
Ich kenne deinen Musikgeschmack, seit du heute früh in Galway eine CD von dieser obskuren irischen Country-Tanzkapelle gekauft hast. Hat sich der Hund nicht gewehrt?
Ach was. Irgendwann blieb Trulla mal vor einer Kneipe stehen und wollte dringend rein. Die Kneipe sah absolut nach nichts aus. Ich hab ihr gesagt, »Trulla, nee, da hast du dich wirklich verpeilt, das kann es nicht sein. Das ist doch die hinterletzte Fascho-Pinte.« Aber Trulla bestand darauf, daß wir reingehen. Ich hab gesagt: »Ja gut, Trulla, weil du es bist, aber auf deine Verantwortung. Wenn das jetzt Scheiße ist, glaube ich dir nie wieder etwas.« Wir sind dann hineingegangen, und da merkte man, daß die Kneipe nur von außen doof aussah, weil die Hausfassade renoviert war. Innen war das eine so schöne Höhle, und in der Ecke ein runder Stammtisch mit einer SPD-Traditionsfahne von 1869, und »Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit«, und »Einigkeit macht stark«. Da habe ich gesagt: »Gut, Trulla, ich sage ja schon gar nichts mehr.«
Ich habe in einer irischen Zeitschrift ein Cartoon gesehen, in dem ein Mann mit einem angeleinten Wellensittich gerade das Haus verlassen will, und seine Frau raunzt ihn an: »Dir ist auch jede Ausrede recht, um in die Kneipe zu gehen.«
Mit Trulla konnte man nicht nur in Kneipen gehen, sondern es war auch in Biergärten sehr schön. In München fällt ja immer viel ab, Weißwurstpelle zum Beispiel, und wenn sie die irgendwo sah, schleppte sie sich völlig entkräftet an den Tisch, wo es Weißwurstpelle gab, und sah auch sofort ungeheuer abgemagert aus. Sie konnte sich also ganz gut selbst ernähren. Später, wenn ich ohne Trulla in den »Soller« ging, sagte die Gastronomie immer: »Hast heut den Schlumpfi net dabei?« Weil der Münchner zunächst Hunde wahrnimmt, und erst in zweiter Linie sonstiges Gesocks. Trulla hatte Zitzenkrebs, woran sie auch eingegangen ist. Bei so einem Dackelkörper hatte sie entsprechend viele Brustwarzen. Sie muß sehr gelitten haben. Das waren die drei wichtigen Hunde in meinem Leben.
Ich mag eher Katzen. Wir hatten eine pechschwarze Katze, aber sie hat ihre sieben Leben ziemlich zügig aufgebraucht. Zweimal erwischte sie der Nachbarshund und zerzauste sie, zweimal geriet sie unter ein Auto und zweimal hatte sie eine fast tödliche Infektion.
In New York hatten wir mal eine zugelaufene Katze. Wegen dieser schönen, alten Feuerleitern können Katzen sich in New York aussuchen, wo sie wohnen wollen. Wenn ich nach der Arbeit nach Hause kam, habe ich mir meinen Chillum angezündet und mein Six Pack of Schäfer ausgepackt. Dann hat sich die Katze neben mich gesetzt und an dem Chillum geschnuppert, direkt an der Glut. Ich habe in den Fernseher geglotzt, die Katze an die Wand, und beide sagten wir uns: »Too much, man, just too much, man.«
Rosa, die Tante von meinem Freund John, lebte auch in solch einem Haus in New York, sie hatte auch eine Katze. Sie glaubte allerdings, die Katze sei die Reinkarnation ihrer Mutter und hätschelte das Tier entsprechend.
Bei Reinkarnation fällt mir ein: Nachdem mein Bruder in Indien gestorben war, stellte seine Witwe in der Schweiz die Urne im Schlafzimmer auf den Kaminsims. Neben der Urne kroch ein Riesenkäfer umher, und sie dachte, das wäre ihr verstorbener Mann. Das ist natürlich albern. Wenn man schon als Riesenkäfer reinkarniert, warum soll man sich dann ausgerechnet neben seiner Urne aufhalten? Oder? Ich möchte doch nicht immer an meinen Tod erinnert werden. Apropos Käfer: Ich habe mal meine Stammtischschwester Anna Mikula, die Kulturchefin der wöchentlich erscheinenden Wochenzeitschrift Die Woche, ziemlich angefreakt. Wir unterhielten uns über einen damaligen Zeit-Redakteur, der nicht wußte, wer Gregor Samsa ist, und Anna sagte: »Stell dir mal vor, der ist Redakteur eines solchen Hirnblattes wie der Zeit und weiß nicht, wer Gregor Samsa ist.« Ich guckte etwas stumpf vor mich hin, und dann wurde Anna allmählich irre an mir und sagte: »Aber gell, Harry, du weißt schon, wer Gregor Samsa ist?« Darauf ich: »Na, erlaube mal, ich werde wohl wissen, wer Gregor Samsa ist. Den habe ich doch selbst noch in Berlin in der Hasenheide kämpfen sehen. Gregor Samsa staatenlos.« Da brach eine Welt für sie zusammen. Gregor Samsa ist die Hauptfigur der Erzählung »Die Verwandlung« von Franz Kafka. Der wacht eines Morgens auf und ist ein Käfer.
Das klingt natürlich sehr einleuchtend: »Gregor Samsa staatenlos, habe ich noch selbst in der Hasenheide kämpfen sehen.« Aber eigentlich haben wir ja von deiner Schulzeit gesprochen...
Nachdem meine Eltern geheiratet hatten, mußten wir ins Allgäu umziehen, weil Kurt W. Marek, besser bekannt unter dem Namen C.W. Ceram, »Götter, Gräber und Gelehrte«, nach Amerika zog. Er war in Woodstock, und zwar in dem Woodstock. In Amerika war er aber sehr unglücklich, weil er nicht bedacht hatte, daß es für ihn offenbar zu spät war, Fremdsprachen zu lernen. Er fühlte sich in seiner Eigenschaft als Herzens-Amerikaner in Amerika immer kreuzunwohl. Aber auf diese Weise stand sein Haus leer, und deshalb zogen meine Eltern mit mir ins Allgäu. Dort bin ich in die Zwergschule gegangen. Eigentlich war es keine Zwergschule. Es gab acht Klassen mit vier Lehrern, also wurden immer zwei Klassen zusammen unterrichtet. Da war ich zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben ein richtig guter Schüler. Das lag an folgendem: Haschi Marek sagte mal: »Du hast es besonders schwer als Briefmarkensammler und Rasselbandeleser.« Aber dadurch wußte man automatisch mehr als sogar der Lehrkörper. In der Rasselbande kamen Titelgeschichten wie »Fiesta in Cuzco« vor. Also wußte ich, wo Cuzco liegt und was Fiesta bedeutet.
Als Briefmarkensammler kommt man ja auch in der Welt herum.
Ich habe nie bedauert, daß ich mal Briefmarken gesammelt habe, weil ich selbst riesige Filmschinken, die man eigentlich nur im Kino sehen dürfte, auch auf einem kleinen Bildschirm mit großem Genuß angucke. Ich kann mir vorstellen, wie das auf einer großen Leinwand aussieht, weil ich als ehemaliger Briefmarkensammler die Kunstschätze dieser Welt längst im Briefmarkenformat genossen habe.
In Lindenberg wurde damals gerade eine Oberschule fertiggestellt. Da ging aber niemand hin. Ich bestand heimlich die Prüfung zur Oberschule. Na ja, es war halb heimlich. Mein Vater durfte es nicht wissen, weil sein Motto war: Raus aus der Schule, rinn ins Geschäft. In Hamburg hätte ich mir das nie zugetraut. In Hamburg war ich sogar in der Volksschule ein schlechter Schüler. Aber im Allgäu suchten sie händeringend nach Schülern, möglichst evangelischen, weil die klüger waren. Kaum hatte ich die Prüfung bestanden, zogen meine Eltern wieder nach Hamburg. Auf der Oberschule dort war ich sofort wieder ein schlechter Schüler, wie sich das gehörte. Außerdem begann in Bayern das Schuljahr im Herbst und in Hamburg im Frühjahr, so daß ich eine Lücke von einem halben Jahr hatte, die bis heute nicht gestopft wurde. In der Albert-Schweitzer-Schule, wo wir gerade den Bauernkrieg durchnahmen, schrieb ich meine erste Eins in Geschichte, weil endlich mal was kam, das mich interessierte, Thomas Müntzer. In der Walddörfer Schule in Hamburg-Volksdorf waren sie bereits beim Ersten Weltkrieg, so daß meine Lücke vom Bauernkrieg bis zum Ersten Weltkrieg reicht. Es ist alles nicht mehr zu stopfen.
Ich bin in Geschichte nie über das 19. Jahrhundert hinausgekommen. Immer, wenn wir das abgehandelt hatten, war das Schuljahr zu Ende, und danach fingen wir wieder bei den Römern an. Unglücklicherweise war unser Geschichtslehrer auch Lateinlehrer, und er fand es angemessen, das zu kombinieren. Er ließ uns die mittelalterlichen Urkunden aus dem Lateinischen übersetzen.
Ich war in Latein auf der Walddörfer Schule quasi unzensierbar und bekam die erste Sechs minus. Da war ich so stolz. Dann habe ich mich bis zu einer zwei in Latein gesteigert, die ich auch ins Abitur hinübergerettet habe.
Bei mir war es genau umgekehrt. Ich hatte mich jahrelang mit knappen Vieren gerettet, weil meine Interpretation des miserabel übersetzten Textes ganz in Ordnung war, aber im Abitur bekam ich eine Sechs in Latein, weil es keine Interpretationsfrage gab.
In der Walddörfer Schule gab es einen Lateinlehrer, Professor Dr. Gumpricht, den ich aber glücklicherweise nicht hatte. Bei dem hätte man in Latein eine Interpretation verfassen müssen. Ich konnte krankheitsbedingt an einer Klassenfahrt nicht teilnehmen und wurde deshalb eine Klasse höher zu Dr. Gumpricht gesteckt. Die sprachen Latein miteinander, dabei waren das sogenannte Musen, bildende Kunstmusen. Das fing schon damit an, daß man das Datum sagte, was nicht leicht ist: Am dritten Tag der Iden des September.
Ich weiß. Ich habe beim Versuch, das Datum zu nennen, einen Lachkrampf bei meinem Lehrer ausgelöst.
Vor ein paar Jahren hatte ich eine Lesung in Bad Oldesloe. Da kam Herr Dombrowski, den ich in der Walddörfer Schule in Latein hatte. In der Albert-Schweitzer-Schule ging es ein bißchen anthroposophisch zu, das heißt, man machte mit ungeheurem pädagogischen Aufwand nichts. Herr Dombrowski, bei dem ich es von unzensierbar bis zu einer Zwei geschafft hatte, hat sich, um mich zu überraschen, aus dem Sekretariat der Walddörfer Schule meinen Notendurchschnitt in der Oberstufe besorgt. Ich hab einen richtigen Schreck bekommen. Das war immer eine solide Zwei. Damit war’s mit dem Mythos vorbei, ich wäre ein schlechter Schüler gewesen. Ich hatte zwar im Abitur eine Fünf in Mathe, aber die habe ich durch eine Eins in Deutsch ausgebügelt. Tja, da ging er hin, der Mythos. Ich war kein schlechter Schüler. Furchtbar! Dabei gab es in der Walddörfer Schule eigentlich gar keine Einsen. Zwei war das absolut beste, das man kriegen konnte. In meiner Klasse gab es immerhin drei Einsen. Johann Ulrich Siems-Weisbach in Latein, der war aber vorher auf dem Johanneum gewesen und konnte außer Latein gar nichts. Stoffel Weber in Musik. Der war aber damals schon aktiver Komponist und legt heute in Bhagwan-Discos Platten auf.
Was für eine Karriere!
Ganz so schlimm ist es nicht. Er hat sich inzwischen gefangen und bringt in München Schauspielern das Singen bei, weil die doch manchmal in irgendeiner Rolle singen müssen, und sie das an normalen Schauspielschulen nicht lernen. Wenn Leute, die nicht singen können, aber musikalisch sind, plötzlich trotzdem singen müssen, ist das eigentlich viel schöner, als wenn Sänger gleich singen.
Singen kann ich auch nicht. Im Grunde habe ich alle Fächer auf dem Weg zum Abi mit Fünf abgegeben, aber die konnte ich immer mit Mathe ausgleichen. Meinen Abitur-Notendurchschnitt will ich gar nicht wissen. Eine Eins kommt darin jedenfalls nicht vor.
Für meinen Abituraufsatz habe ich nicht nur eine Eins bekommen, sondern sogar noch eine Urkunde für den besten Abituraufsatz von Hamburg, Nordniedersachsen und Holstein. Über Max Frisch: »Gedanken nach einem Fluge.« Ich erinnere mich noch an einen brillanten Satz aus diesem Deutschabitur: »Inzwischen bemüht man sich, ethnische Animositäten in geregeltere Bahnen zu lenken. In Aschenbahnen zumeist.« Ist das nicht brillant?
Doch. Sehr.
Wir hatten bisher immer alle fünf Jahre Klassentreffen, aber inzwischen machen wir das aus Angst alle drei Jahre. Nicht nur aus Angst um Herrn Glockauer, unseren Klassenlehrer, den wir immer noch so lieben wie damals, sondern weil wir selbst auch immer älter werden. Gestorben ist von uns seltsamerweise noch keiner. Das scheint eine sehr gesunde Klasse zu sein. Wenn ich bedenke, wie wir in der blöden Albert-Schweitzer-Schule beim Sportfest der Hamburger Oberschulen immer die Walddörfer-Schüler beneidet haben, weil die alle Pokale abräumten. Ich war in Sport eine ausgesprochene Flasche, und dann auch noch in der Albert-Schweitzer-Schule, die nie irgendwas gewann. Als ich später in der Walddörfer Schule war, traf ich meine alten Kumpels Kümmel und Seitz und Láczi Kurucz wieder. Die waren in Zivil und ich in Schulsportkleidung, weil ich nämlich Ersatzmann der Schulstaffel war. Aus dem Stand. Toll, was?
Ich bin beeindruckt.
Dennoch bin ich wegen einer Fünf in Sport sitzengeblieben. In Mathe und Physik hatte ich auch Fünfen, aber die konnte ich ausgleichen, doch dann habe ich noch eine in Sport draufgekriegt, was eine Gemeinheit gegenüber dem Schlußmann in der Schwedenstaffel und Ersatzmann in der Schulstaffel ist. Im Sport wurden lauter Sachen geturnt, bei denen man sich die Eier quetschen konnte. Beim Rennen kann man das nicht. Und ich lief gar nicht mal übermäßig schnell. Ich hatte nur die Gabe, jeden zu überholen, der vor mir war. Deshalb war ich ein beliebter Schlußmann. Dabei habe ich so kurze Beine. Das war offenbar der Triumph des Willens. Bloß weg hier.
Bei mir ist das genau umgekehrt: Zu kurzer Oberkörper und zu lange Beine. Ich bin ein Sitzzwerg.
Ich habe einen zu langen Oberkörper und zu lange Arme. Die Hornhaut an den Fingerknöcheln kommt vom Nachziehen. Damit konnte man beim Laufen offenbar gut rudern. Beim letzten Klassentreffen haben wir nochmal die Schwedenstaffel durchgehechelt, das ist die 400, 300, 200 und 100 Meter-Staffel, also immer schneller. Ich wußte noch, daß Naschke die 400 Meter lief, 300 Meter weiß ich nicht mehr, 200 Meter war Wongi Schriever. Und der sagte: »Du wirst dich doch noch dran erinnern, daß ich dir das Staffelholz übergeben habe.« Und ich sagte: »Wongi, du hast nichts kapiert. Ich drehe mich doch nicht um, um zu sehen, wer mir das Staffelholz überreicht. Da bin doch längst losgerannt.« Das hat er dann auch eingesehen. Unser Klassenlehrer, Herr Glockauer, hat es nach dem Abitur immer mit den zwei oder drei Schönen aus der Klasse getrieben. Aber immer erst danach, weil es ja sonst Unzucht mit Abhängigen gewesen wäre. Wir sind nach dem Abitur in die Heide gefahren. Da hat ihm Petra Dietz, mit der das eigentlich schon mehr oder weniger klar ging, die Ärmel- und Hosenbeine seines Pyjamas zusammengenäht. Außerdem entfernte sie das Mittelstück seiner dreiteiligen Matratze und zog das Laken schön straff. Wir anderen saßen zum größten Teil noch unten und soffen, da kam er plötzlich in seinem Pyjama mit den zusammengenähten Ärmeln und Hosenbeinen und hat strahlend gesagt: »Wer hat das zusammengenäht? Die Frau werde ich heiraten!«
Und hat er sie geheiratet?
Nein. Er war und ist sehr konservativ, und ich bin ein linker Spinner, was ich auch damals schon war. Bei einem Klassentreffen sagte er mal: »Wie kommt es eigentlich, daß wir uns immer so gut verstanden haben?« Darauf ich: »Das lag wohl an der Solidarität der Demokraten.« Weil er zwar sehr konservativ ist, aber doch ein großer Nazi-Fresser. Bei unserem ersten Klassentreffen hat er sich darüber gewundert, daß so viele von uns Lehrer geworden sind. Ich sagte: »An Ihnen hat man eben gemerkt, daß Pauker zu sein doch nicht so übel sein muß.« Damals haben wir ihn noch gesiezt, inzwischen sagen wir Horst oder Jürgen. Er heißt zwar Horst-Jürgen, aber einen der beiden Namen kann er nicht leiden, ich vergesse immer, welchen. Er sagte: »Ich hab nun lange genug deine spitzen Sprüche angehört, und nach dem Abitur habe ich keine Lust, mir die weiter anzuhören.« Ich sagte: »Das war kein spitzer Spruch, das hab ich ernst gemeint.« Da ging er ganz schnell aufs Klo und kam nach fünf Minuten mit roten Augen zurück.
Hast du dich auch in der Schulpolitik engagiert, oder gab es so etwas zu deinen Zeiten noch gar nicht?
Doch. Johann Ulrich Siems-Weisbach und ich wechselten uns immer als Klassensprecher ab. Er war mal Vorsitzender der Schülermitverantwortung, also in der Schulpolitik ein ausgewiesener Crack. Wir machten aus, daß wir bei der nächsten Klassensprecherwahl uns selbst wählen. Das habe ich vergessen und ihn gewählt. Mit meiner Stimme wurde er Klassensprecher. Das hat meine Klasse ziemlich schnell bedauert und mich danach gleich wieder gewählt, weil ich die Gabe hatte, von einer Schülerratssitzung, die zehn Minuten gedauert hatte, 45 Minuten lang zu berichten, und das möglichst, wenn eine Mathearbeit anstand. Das war ja unser Recht. Glücklicherweise hatte ich kurz vor den APO-Zeiten Abitur, denn da wurde es ziemlich grimmig. Diese wild gewordenen Schüler haben nämlich unseren wunderbaren Schulleiter Herrn Brühl mehr oder weniger in den Tod getrieben. Der war ein wirklich angenehmer Linksliberaler. Und den haben sie schlecht behandelt. Als die Schülermitverwaltung eingeführt wurde, hat er mich sogar mal in der Pause ins Lehrerzimmer gebeten und gesagt: »Ich möchte, daß du dich da engagierst. Ich will mal ein bißchen Opposition spüren.« Davon hat er dann eine Menge abbekommen. Ich war zwar nicht mehr dabei, aber ich kann mir vorstellen, wie unangenehm das war, denn es hat ja besonders die Linken erwischt. Das hat man ja bei den Scheißstudenten gesehen. Die haben sich eigentlich mehr gegen Linke gewandt als gegen Leute, die die Polizei geholt hätten. Herrn Brühl hatten wir in Geschichte und Gemeinschaftskunde, und da hat er einmal wunderschön mit verteilten Rollen eine pazifistische Veranstaltung im Curiohaus in der Rothenbaumchaussee vorgespielt, die von der SA gestürmt wird. Es kamen darin verschiedene SA-Redner vor und der Rot-Front-Kämpferbund, der der SA einen auf die Mütze haut, und ein kommunistischer Redner. Berühmt waren auch seine Führer-Reden. »Kameraden, wir haben vierzehn Jahre lang darum gekämpft, daß die deutsche Frau wieder Mutter werden kann. UND WIR HABEN ES GESCHAFFT!!!!« An dieser Stelle ging die Tür auf und ein deutscher Schäferhund kam herein. Der wollte sein Frauchen abholen, irrte durch die Gänge und hörte plötzlich die Stimme des Führers, und da wollte er natürlich gucken, was Herrchen will.
Blondi?
Ja. Teil des musischen Abiturs war »Biedermann und die Brandstifter«. Wir hatten zu viele Mädchen in der Klasse. Und »Biedermann und die Brandstifter« war ursprünglich – ähnlich wie »Unter dem Milchwald« von Dylan Thomas – kein Theaterstück, sondern ein Hörspiel. Um der Mädchenschwemme zu steuern, haben wir den Chor, der im Hörspiel vorkommt, wieder eingeführt, und zwar nach dem Friedhofsgärtnerprinzip. Wenn man einen Friedhofsgärtner mit einer Schubkarre sieht, ist noch nichts. Wenn man zwei Friedhofsgärtner mit einer Schubkarre sieht, ist immer noch nichts. Aber wenn man nacheinander drei Friedhofsgärtner mit einer Schubkarre sieht, nimmt man doch an, daß die was im Schilde führen. Wir haben die Mädchen in schwarze Body-Stockings, Schuhe mit Stilett-Absätzen und echte schwarze Feuerwehrhelme gesteckt. Wenn der Chor auftrat, kam die erste rein, wapps, dann die zweite, wapps, dann die dritte, wapps, dann die vierte, wapps, dann die fünfte, wapps, dann die sechste, wapps, so daß man dachte, das hört ja überhaupt nie wieder auf. Soviel knackige weibliche Feuerwehrleute. Wenn alle auf der Bühne waren, stellten sie sich auf, sagten »WEHE!« und gingen wieder weg. Auf diese Weise waren alle versorgt.
Was hast du denn im »Biedermann« gespielt?
Na, den Biedermann, und zwar mit dem Anzug meines Vaters, einem angeklebten Schnurrbart und einer grauen Perücke. Könnte ich mir heute alles schenken. Auch das Kissen unter dem Anzug. An der spannendsten Stelle ging immer der Schnurrbart ab. Hinter der Bühne saß ein echter Polizist in Unterwäsche und las Illustrierte, weil in »Biedermann« ja auch ein Polizist vorkommt. Anstatt uns einfach eine Uniform zu leihen, sagte er: »Nee, nachher geht ihr los und verhaftet Leute.« Lieber saß er in Unterwäsche und in Socken hinter der Bühne, bis seine Uniform nicht mehr gebraucht wurde.
Ich habe nur einmal Theater gespielt, und zwar im Schullandheim Iserhadsche in der Lüneburger Heide. Das Stück hieß »Betragen ungenügend«. Meine Mitschülerin, die doppelt so groß war wie ich und meine Mutter spielte, wollte die Sache etwas realistischer gestalten und vermöbelte mich auf der Bühne, so daß ich am Ende benommen auf den Brettern lag und meinen Text vergessen hatte. Bei euch ging es vermutlich friedlicher zu.
Nicht unbedingt. Naschke spielte den Ringer Eisenring. Laut Handlung mußte ich vor ihm Angst haben. Ich hatte aber keine Angst vor ihm. Wenn ich ihn laut Regieanweisung freundlich gestupst habe, fiel der nach links in die Soffitten. Und dann sollte man auch noch spielen, daß man Schiß vor ihm hat, wenn er sich gerade wieder aufrappelte. Naschke war regieanweisungsresistent. Da wurde ein Gänsebraten aufgetragen, und Naschke sollte sich kämmen und sagen: »Mmmh, wie das schon duftet!« Mit dem Duft war natürlich der Gänsebraten gemeint. Der hat das aber immer so gespielt, daß man den Eindruck hatte, der riecht an seinem Kamm, mit dem er sich durch die Haare fährt. »Mmmh, wie das schon duftet!« Das war ihm nicht auszutreiben. Aber wie unser Klassenlehrer Herr Glockauer, der sich gezielt professionelle Inszenierungen von »Biedermann und die Brandstifter« angesehen hat, zu recht sagte: »Ihr wart einfach besser.« Ich habe mal so eine abgefilmte Inszenierung im Fernsehen gesehen, schwarz-weiß mit richtigen Schau. Herr Glockauer hatte völlig recht. Wir waren einfach besser.