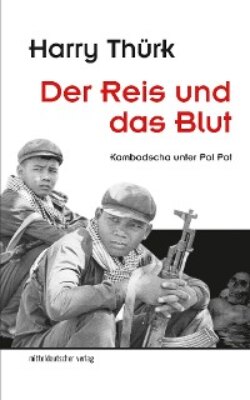Читать книгу Der Reis und das Blut - Harry Thürk - Страница 6
PHNOM PENH – Juli 1979
ОглавлениеDie drei jungen Männer ähnelten einander. Nicht nur, daß sie annähernd gleich alt erschienen, sie sahen auch gleich zerlumpt aus in ihrer geflickten schwarzen Kleidung, ihre Gesichter waren gleich schmal, ausgemergelt, und selbst ihre Haare waren auf die gleiche Weise lieblos gestutzt, glichen Zotteln. Die Augen der drei verrieten eine seltsame Mischung von Abgeklärtheit und Neugier, Tatendrang vielleicht, und Hoffnung.
Der vierte in der Runde, die auf der ramponierten Balustrade eines ehemals prächtigen Pavillons am Ufer des Tonlé Sap saß, in der Nähe des nicht so recht in die Umgebung passenden Wassertanks, war anders. Er war kein Khmer, sondern ein Inder. Älter als seine drei Gesprächspartner, bedächtig fast sah er aus, wenn er sie anblickte, wenn er Fragen stellte, wenn er die Antworten nicht nur in ihren Worten suchte, sondern auch in ihren Blicken. Er war im Gegensatz zu ihnen exakt gekleidet, sein ergrauendes Haar war ordentlich gekämmt, und er trug eine elegante Goldrandbrille. Auch hatte er Schreibzeug bei sich und machte sich immer wieder Notizen. Aus seinem Gesicht war nicht abzulesen, was er dachte. Es wirkte verschlossen, als wolle der Mann eine Art schützenden Wall aufrichten zwischen sich und dem, was er auf seine Fragen erfuhr.
Er kannte die drei jungen Männer seit einigen Tagen. In einem notdürftig instand gesetzten Haus hatte er ein Büro ausfindig gemacht, das sich um die ausländischen Journalisten kümmerte, die den Prozeß der neuen Regierung gegen Pol Pot und seine Helfershelfer verfolgten, der soeben begonnen hatte. Es war dem indischen Reporter erlaubt worden, sich in der Zeit, die er nicht beim Prozeß verbrachte, mit Bürgern zu unterhalten, die das, was da verhandelt wurde, am eigenen Leib gespürt hatten – drei Jahre, acht Monate und zwanzig Tage lang, so oder so.
Im Flußhafen, wo die Hilfsgüter aus Vietnam ankamen, war er auf Kim Sar gestoßen, der Säcke mit Reis aus einem Lastkahn an Land trug. Ung Phim war später hinzugekommen, als Gesprächspartner, auch Yong Sok, der durch besondere Umstände in seinem Leben sogar die Zeitung kannte, die den Inder aus Delhi hierher, nach Phnom Penh, entsandt hatte.
Sie rauchten alle in Hanoi hergestellte »Thang-Long«-Zigaretten, und als der Inder das Aroma lobte, klärte Kim Sar ihn lakonisch auf: »Wir haben sie eingetauscht. Bei einem vietnamesischen Kapitän. Gegen ein chinesisches Fernglas. Das lag auf einem Haufen anderen Gerümpels, von irgendeinem Pol-Pot-Offizier weggeworfen …«
»Gibt es für Sie Anlaß zu Freude?« fragte der Inder. Die drei schwiegen. Dachten nach. Schließlich bemerkte Yong Sok, der bei genauer Betrachtung der Feingliedrigste, Schmalste von ihnen war: »Eine schwierige Frage, Mister. Natürlich freuen wir uns, weil wir überlebt haben. Jeder auf seine Weise. Daß wir nicht zu den drei Millionen Toten gehören, die das Regime Pol Pots hinterlassen hat. Aber – was für eine Art von Freude ist das? Sehen Sie sich unser Land an! Man hat es einmal die Perle Südostasiens genannt. Und heute? Zählen Sie die Ruinen, betrachten Sie die verwüsteten Städte, die Asche der Dörfer, verweilen Sie mit Ihrem Blick auf den herrlichen Zuckerpalmen, die rings um die ehemalige Markthalle von Phnom Penh wachsen – unter jeder von ihnen liegt ein Mensch begraben. Erschlagen und mit einem Palmensamen auf der Brust eingescharrt. Sehen Sie sich unsere Schulen an, die Krankenhäuser, die Pagoden, alles. Wenn Sie das getan haben, werden Sie spüren, daß Freude etwas anderes ist, als was wir heute empfinden. In uns ist das Salz der Bitterkeit. Die Asche der Toten trübt unseren Blick. Die Schreie der Sterbenden hören wir in den Nächten, im Schlaf. Was ist heute in unseren Herzen? Vielleicht erst eine Vorstufe von Freude. Erleichterung …« Der Inder erinnerte sich: »Einer der Ankläger hat gesagt, selbst die steinernen Apsaras, die Gespielinnen der ehrwürdigen Götter, verfluchen die Mörder …«
Ung Phim, der bisher geschwiegen hatte, nur gelegentlich mit den Fingern der rechten Hand über die Stelle an der linken strich, an der ihm zwei Finger fehlten, sprach vor sich hin: »Apsaras fluchen nicht, Mister. Sie klagen. Ich kann es hören, nachts. So wie Kim Sar und Yong Sok die Schreie der Erschlagenen hören.«
Der Inder gestand ihm: »Ich habe die Anklagen gelesen und einige der Zeugen gehört. Man hat mir in einem Gefängnis einen dreizehnjährigen Jungen gezeigt, der einhundertfünfundachtzig Menschen mit einer Rodehacke totgeschlagen hat, wie er selbst erzählte. In der ehemaligen Oberschule hier, die als Gefängnis diente, unter Pol Pot …«
»Tuol Sleng«, ergänzte Yong Sok. »Ich bin dort zur Schule gegangen. Zwölftausend sind es insgesamt gewesen, die man da ermordet hat. Und von jedem wurde vorher ein Foto gemacht.«
»Der Dreizehnjährige antwortete mir auf die Frage, warum er tötete, die Angkar habe es befohlen, das sei die höchste Autorität gewesen, die Organisation. Wer sich hinter dieser Bezeichnung verbarg, wußte er nicht genau, nur daß er bedingungslos ihre Befehle zu befolgen hatte. Die Getöteten seien alle Parasiten gewesen, nicht wertvoller als Kakerlaken. Im übrigen habe er es so gemacht, daß die Leute gleich beim ersten Schlag tot gewesen seien …«
Kim Sar drehte den Kopf zur Seite und tippte auf eine Stelle im Genick. »Hierhin schlugen sie. Man hatte sie belehrt, das sei die beste Stelle.«
»Warum?« Der Inder hob hilflos die Hände. »Was war diese ominöse Angkar? Konnte sie Menschen verzaubern? Aus Anständigen Bestien machen? Und – warum das viele Morden? Wie kam es dazu? Und wieder – warum?«
»Eine weitere schwierige Frage«, bemerkte Yong Sok.
»Können Sie sie nicht beantworten? Oder wollen Sie das nicht?«
»Wir können Ihnen erzählen, wie es begann«, sagte Kim Sar, »und wie es weiterging. Aber es würde Tage dauern, Ihnen alles begreiflich zu machen, Mister.«
»Ich habe viele Tage Zeit!«
»Nun gut«, meinte nach einer Weile Ung Phim. »Wir arbeiten alle drei an den Kais. Hier werden Leute gebraucht, die anpacken können. Aber wir haben stets drei Stunden Mittagsruhe, wenn die Hitze am schlimmsten ist, weil die Sonne am höchsten steht. Seien Sie um diese Zeit hier, unter dem Wassertank. Was wir wissen, werden wir Ihnen erzählen …«
Als der Inder sich am nächsten Mittag dort einfand, hockten die drei bereits im Schatten. Zigaretten glühten. Ung Phim wies auf Kim Sar. »Es wird am besten sein, wenn er beginnt. Seine Erfahrungen reichen am weitesten zurück. Durch besondere Umstände geriet er in den Führungskreis der Angkar. Und er hat da so manches über die Vorgeschichte der Tragödie erfahren …«
Am Kai war Motorengeräusch laut geworden. Eine Barkasse legte ab. Draußen im Strom, der eigentlich der Mekong war, zumindest ein Nebenarm von ihm, der hier den Namen Tonlé Sap trug und sich gute hundert Kilometer nordwestlich in den Großen See ergoß – von jeher ein reiches Fanggebiet für die Fischer –, ertönte der kreischende Schrei einer Bootssirene. Ein leichter Luftzug bewegte an den Resten einer Pagode unweit des Ufers das letzte, nicht zerstörte Glöckchen. Ein heller, einsamer Ton.
Der Inder blickte Kim Sar fragend an. Dieser nickte. Dann begann er zu berichten. Manchmal stockte er, als ob er nachdenken müsse. Dann wieder wurde seine Stimme leiser, als habe er jetzt noch Furcht vor dem, was er beschrieb.
Tage vergingen. Immer wieder saß der Berichterstatter um die Mittagszeit mit den jungen Männern unter dem Wassertank. Schrieb. Brachte schließlich, als auch die anderen erzählten, ein kleines Tonbandgerät mit und nahm auf, was gesprochen wurde. Die drei wechselten einander ab. Es schien ihnen ein Bedürfnis zu werden, dem Fremden alles mitzuteilen, woran sie sich erinnerten. Sie wollten, daß er sie verstand, das Ausmaß der Tragödie begriff, die sie durchlebt hatten und von der die Leute in der übrigen Welt Kunde erhalten sollten, über die spröden Berichte der Zeitungen hinaus. Nachempfinden – würde das möglich sein? Begreifen? Sie wußten es nicht. Und auch der Inder wußte nicht, wie er es anderen würde begreiflich machen können …