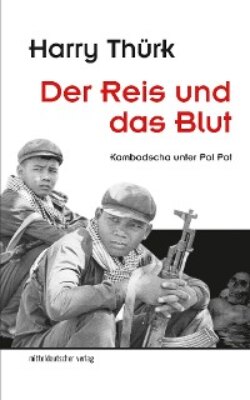Читать книгу Der Reis und das Blut - Harry Thürk - Страница 7
KIM SAR, 32 Jahre
ОглавлениеIch bin in Phnom Penh, in der Vithei Samdech Hinn, aufgewachsen, nicht weit von dem Platz, an dem unser Unabhängigkeitsdenkmal steht. Wir nannten es als Kinder die Pagode auf zwei Füßen, weil es so aussieht. Man kann hindurchgehen zwischen den Füßen, erst treppauf, dann treppab. Alles edler Stein. An Feiertagen stets besonders sauber geschrubbt. Sonst allerdings konnte es schon einmal vorkommen, daß ein Rikschafahrer sich dort vor dem Regen unterstellte, in der nassen Jahreszeit, wenn die Schauer plötzlich niederprasselten. Man erzählte sich sogar, Rikschafahrer hätten nicht selten unter dem Denkmal die Nacht hindurch geschlafen.
Wenn Sie unsere Stadt genau durchforschen, entdecken Sie, daß es sechs große, sehr lange Straßen gibt, sie verlaufen nahezu parallel, von Nordwesten nach Südosten. Vom Osten angefangen sind das die Monivong, dann die Trasak, die Pasteur, die Norodom, die Yukanthor und, am Flußufer, die Vithei Sisowath Terak.
Das Unabhängigkeitsdenkmal liegt am Ende der Norodom; eine Krone besonderer Art für die Dynastie. Wenn Sie vom Nordwesten kommen, biegen Sie an der letzten Kreuzung rechts ab, das ist die Vithei Samdech Hinn. Dort betrieben meine Eltern einen Gewürzgroßhandel. Gute Lage. Einen Kilometer von den letzten Kais entfernt, an denen die Lastkähne anlegten, die flußauf kamen, von Saigon.
Eigentlich war der Handel in Phnom Penh ja die Domäne der Chinesen. So wie Handwerke meist von Vietnamesen betrieben wurden. Man war das so gewöhnt, die Khmer waren das Staatsvolk, sie hatten in der Hauptstadt meist die Verwaltungsposten inne.
Aber mein Vater lachte immer, wenn er solche Einteilungen hörte. Er meinte, wie ein Mann sein Geld verdiene, hänge eher von seinem Unternehmungsgeist ab als von seiner Nationalität. Wobei die Nationalität ohnehin keine sehr große Rolle bei uns spielte, jedenfalls um die Zeit, als ich aufwuchs. Wie auch die Religion. Die Götter, so pflegten die Alten zu sagen, haben uns Toleranz gelehrt. Und die alten Könige von Angkor respektierten alle Götter, hinduistische wie buddhistische. Laßt doch die einen zu Buddha beten, die anderen zu Wischnu. Wieder andere verehren den Mann aus Arabien, den mit der Krone aus Dornenranken, der am Kreuz endete. In den Pagoden stehen die Figuren der verschiedensten Gottheiten ohnehin nebeneinander, das ist Tradition bei uns.
Die Cham, die meist in der Provinz Kompong Cham lebten, ein Urvolk, das eine primitive Auslegung des Islam betrieb, unterschieden sich in ihren Riten am meisten von uns anderen. Eigenartigerweise aßen sie kein Schweinefleisch, aber auch sie waren gleichberechtigte Bürger, wenigstens auf dem Papier der Gesetze.
Doch in unserem Lande gab es in der Tat keine Religionsfehden, nicht einmal die Christen, die so gern zu Märtyrern werden wegen ihres Glaubens, konnten darüber klagen, wenige, die sie ohnehin waren. Erst Pol Pots Regime begann Unterschiede zu machen. Neben den Hauptunterschieden, auf die ich noch zu sprechen komme, auch religiöse. In jedem Falle waren sie tödlich. –
Ich wuchs sozusagen mit der Unabhängigkeit auf. Als ich das erste Jahr zur Schule ging, damals ein Privileg der Hauptstädter, weil es in den meisten anderen Orten des Landes noch kaum Schulen gab, bekamen wir eines Tages kleine Fähnchen mit den Türmen von Angkor Wat in die Hand gedrückt und wurden am Straßenrand aufgestellt. Wir hatten Prinz Sihanouk zuzujubeln, der, wie man uns sagte, die Unabhängigkeit im Kampf gegen die französischen Kolonialherren errungen hatte. Monseigneur Papa, wie unsere Lehrer ihn nannten, der gütige Prinz aus der Dynastie der Norodom, der unser Schicksal wenden konnte.
Ich habe keine Erinnerungen an die Kolonialzeit, kann daher auch nicht sagen, daß ich mich sonderlich befreit fühlte. Zumal mein Vater, der eine Buchhalterseele hatte und alles dreimal von allen Seiten besah, bevor er es zur Kenntnis nahm – auch die Rechnungen für seine Gewürze übrigens –, nicht selten im Familienkreis lose Reden führte. So meinte er, der Prinz schmücke sich mit unechten Federn, wenn er sich das Verdienst der Unabhängigkeit so einfach allein zuschriebe. Es habe im Lande seit dem zweiten Weltkrieg, der für mich nur noch eine Legende war, Leute gegeben, die gegen die Franzosen und die Japaner gekämpft hatten. Eigentlich sei dieser Kampf von den Vietnamesen ausgegangen, habe auf uns, das Nachbarland, übergegriffen, ebenso auf Laos, den nördlichen Nachbarn. Im Frühjahr 1954 hätten die Vietnamesen die Franzosen bei Dien Bien Phu so katastrophal geschlagen, daß diese gezwungen waren, nicht nur Vietnam, sondern auch das übrige Indochina aufzugeben.
Sihanouk, der an einer französischen Universität in Saigon studiert hatte, wie das bei den Leuten unserer Oberschicht üblich war, hätten die Franzosen als Statthalter ausgewählt, damit nicht die tatsächlichen Kämpfer, die meist Kommunisten waren, an die Macht gelangten. Die Franzosen, so meinte mein Vater, hätten Sihanouk das Land sozusagen auf dem Silbertablett übergeben, weil er zugesagt habe, daß Frankreichs wirtschaftliche und politische Interessen wenigstens zu einem gewissen Teil weiter respektiert würden.
So gab es bei uns auch weiterhin französische Unternehmen, Kautschukplantagen beispielsweise, aber auch Schulen und Krankenhäuser. Das Militär zog ab, aber die Franzosen waren damit nicht ausgeschaltet, wie etwa im Norden von Vietnam und später im Süden, wo die Amerikaner an ihre Stelle traten – sie waren bei uns lediglich in gewisse Grenzen verwiesen. Aber das kennen Sie ja aus den Geschichtsbüchern …
Als ich zehn Jahre alt war, schickte mich mein Vater in das französische Gymnasium. Bildung, so meinte er, sei wichtig, auch das Erlernen von Sprachen. Das Gymnasium trug den Namen Lycée Kamputh Both. Französisch lehrte dort ein erst kürzlich vom Studium aus Paris heimgekehrter Herr namens Saloth Sar. Er hatte mit einem Stipendium des französischen Staates in Frankreich studieren können wie einige andere Auserwählte auch. Die Franzosen hatten diese Studien finanziert, wohl um sich im eigenen Land eine Art geistiger Elite heranzubilden, die dann später in der ehemaligen Kolonie verantwortungsvolle Posten bekleiden sollte, nicht zuletzt im Interesse jenes Landes, das ihnen so großzügig zu höherer Bildung verholfen hatte.
Herr Saloth Sar war ein untersetzter, etwas bullig wirkender Khmer, der oft lachte und dabei auf eine unnachahmliche Weise sein Pferdegebiß entblößte. Er war nicht ungerecht, und das Lernen bei ihm machte sogar Spaß. Im Gegensatz zu den Erfahrungen, die eine andere Klasse mit ihrem Lehrer hatte, einem gewissen Ieng Sary, der schnell aus der Haut fuhr und dann laut schimpfte. Auch er war übrigens aus Paris zurückgekommen und mit Herrn Saloth Sar ziemlich eng befreundet. Am Gymnasium hatte ich nur einmal mit ihm zu tun, als er mir einen Brief übergab, den ich ins Lycée Norodom bringen sollte, zu einer Madame Khieu Thirit, Englischlehrerin und, wie ich erfuhr, die Frau von Herrn Ieng Sary. –
Unser Französischlehrer, Herr Saloth Sar, war aber bei weitem nicht nur an der Vermittlung von Sprachkenntnissen interessiert. Er war in vielen Fächern bewandert, so auch in der Geschichte und vor allem in der Politik. An unserer Schule gründete er damals den »Zirkel zur Analyse der Geschichte des Khmer-Volkes«. Eine von den Schulbehörden recht gern gesehene Ergänzung unseres Unterrichts, obwohl die Teilnahme freiwillig war. Ich erinnere mich an farbige Landkarten mit den Grenzen des alten Reiches Fu Nan, an Darstellungen der legendären Khmer-Metropole Angkor, in der vom 9. bis zum 15. Jahrhundert unsere Gottkönige herrschten. Wir Schüler bekamen einen Eindruck von der Größe und Bedeutung unserer Vergangenheit.
Wenn wir Herrn Saloth Sar lauschten, wie er von der Pracht und Herrlichkeit des Hofes erzählte, von der Gewalt, die sich dort verkörperte und die angewendet wurde, um das Land immer bedeutsamer zu machen, hatten wir durchaus ein wenig das Gefühl, einem auserwählten Volk anzugehören. Schließlich hatten die Gottkönige von Angkor es nicht nur verstanden, die Energien des einfachen Volkes völlig für die Größe der Dynastie zu mobilisieren, die sich in den gewaltigen Bauwerken von Angkor verkörperte – sie ließen die von Natur aus trägen Bauern, die sich mit dem bißchen Reis, das sie selbst aßen, mit ein paar Fischen und ein wenig Gemüse begnügten, zu riesigen Arbeitskolonnen zusammenfassen, die zwischen Saat und Ernte sogenannte gemeinnützige Vorhaben ausführten. Im ganzen Land legten sie engmaschige Wasserverteilungssysteme an, die der notwendigen Bewässerung der Reisfelder während der Trockenperiode ebenso dienten wie dem Schutz vor Überflutungen während der sintflutartigen Regenfälle.
Mit sichtlichem Stolz präsentierte uns Herr Saloth Sar immer wieder Landkarten, auf denen die einstmals für ganz Südasien beispielhaften Systeme der Stauanlagen und Kanäle im Kambodscha der Angkor-Periode verzeichnet waren. Er bewahrte diese Karten übrigens nicht in der Schule auf, sondern bei sich zu Hause.
Hier muß ich erwähnen, daß ich sozusagen zu seinen Lieblingsschülern gehörte, deshalb wurde ich von ihm oft mit kleinen Nebenarbeiten betraut, wie etwa die Karten von seinem Haus zur Schule und zurück zu tragen. Er hatte mich wohl auserwählt, weil ich eine gute Auffassungsgabe besitze. Französisch bereitete mir keine Schwierigkeiten, ebensowenig die englische Sprache, die ich als Wahlfach nahm.
Allerdings machte der außerschulische Zirkel mir bald mehr Spaß als die Schulfächer. Was Herr Saloth Sar uns über die glorreiche Vergangenheit des Khmer-Reiches erzählte, beflügelte meine Phantasie und gab mir ein wenig das Gefühl, als Khmer etwas Besonderes zu sein. Es schärfte aber auch meinen Blick für die Wirklichkeit, die mich umgab.
Kambodscha erlebte damals eine gewisse Blütezeit. Zwar wurden noch immer beachtliche Teile der Wirtschaft direkt oder indirekt von Franzosen kontrolliert; große Ländereien gehörten französischen Gesellschaften oder Privatpersonen, wie etwa die gesamten Kautschukplantagen des Landes, deren Ertrag nur zu einem geringen Teil Kambodscha zufloß, aber die Verhältnisse stabilisierten sich. Es wurde nicht mehr gehungert. Fisch und Reis waren in den dichter besiedelten Gebieten reichlich vorhanden, der Außenhandel entwickelte sich, die Städte bekamen nach und nach die Errungenschaften der modernen Zivilisation zu spüren – Busse fuhren, Kinos wurden gebaut. Man feierte die alten Feste: das Visak Bauchéa in der ersten Maiwoche, den Geburtstag Buddhas, dann Anfang Mai das Chrot Preah, das sogenannte heilige Pflügen der ersten Furche, oder das Prachum Ben im September, ein Tag, an dem den toten Ahnen Opfergaben dargebracht wurden.
Am schönsten war stets in der Hauptstadt das Fest des umkehrenden Wassers, gegen Ende Oktober, wenn der verringerte Zufluß des Mekong in den Nebenarm Tonlé Sap dazu führt, daß dieser nicht mehr, wie von Juli an, nordwärts in den Großen See fließt, sondern südwärts, zum Meer. Ein Dankfest, das dem Wasser gilt, dessen Fruchtbarkeit den Reis hat reifen lassen.
Tausende Boote schwammen da auf dem Fluß, ruderten um die Wette. Alles war mit Kerzen und Lampions geschmückt. Eine große Barke mit einem Altar setzte sich mit der Flut in Bewegung – es gab wohl keinen Hauptstädter, der nicht an diesem Tag festlich gekleidet am Ufer stand. Nicht einmal der Unabhängigkeitstag am 9. November mit seinen Paraden und Festreden konnte das Wasserfest übertreffen!
Wer Kambodscha um diese Zeit sah, mußte den Eindruck eines prosperierenden Landes haben. Dennoch war das nur die Oberfläche, die schöne Seite. Schon ein paar Dutzend Kilometer von den größeren Städten entfernt sah es wesentlich anders aus.
Den Blick für diese dunklere Seite der Realität schärfte uns Heranwachsenden an der Schule ganz wesentlich Herr Saloth Sar. Von ihm lernten wir, daß sich das System des Prinzen auf klug dosierter Ausbeutung und Unterdrückung aufbaute. So gab es etwa in den ausgedehnten landwirtschaftlich genutzten Gebieten eine schleichende Verschlechterung der Lebenslage unter den Bauern.
Da alles Land der Krone gehörte, dem Staat also, brauchten die Bauern zwar keine direkten Steuern zu entrichten, doch dafür gehörte ihnen das Land nicht, und es häuften sich eine Menge indirekter Abgaben. Die meisten selbständigen Bauern hatten Schwierigkeiten, die steigenden Preise für Saatgut, für Wasser und für den Transport ihrer Erzeugnisse zu zahlen. Sie mußten die Ernten verpfänden, sich bei Geldverleihern verschulden, immer höher, um selbständig bleiben zu können. Gaben sie auf, wurden sie zu Lohnsklaven reicher Landaufkäufer, ihr Lebensstandard sank weiter ab. An die Ausbildung ihrer Kinder war kaum noch zu denken.
Die Sihanouk-Dynastie selbst betätigte sich immer mehr als Wirtschaftsunternehmen und wurde zunehmend reicher. Dazu gründete sie – oft über Mittelsmänner – Industriebetriebe, deren Ertrag ihr allein zufloß. Sie ließ in den landschaftlich schönsten Gegenden, wie etwa bei Angkor, Hotels bauen. So entstand die Socièté Khmere des Auberges Royales, deren Kassen sich mit dem Geld der Touristen füllten; die Gesellschaft besaß so gut wie alle für Ausländer geeigneten Hotels im Lande. Hinter vorgehaltener Hand flüsterte man, selbst die unzähligen Bordelle der Hauptstadt würden von Strohmännern des Königshauses betrieben.
Unser Prinz widmete sich indessen den schönen Künsten. Er komponierte Musik und produzierte Spielfilme – es existierten nur wenige Gebiete des öffentlichen Lebens, an denen nicht die Norodom-Sippe, die Franzosen oder die einheimische Schicht der Zwischenhändler und Exporteure Millionen verdienten. Damit verglichen gab es Gegenden im Lande, die sich buchstäblich noch im Urzustand befanden, ohne die Hoffnung, daß sich das in absehbarer Zeit ändern könnte. Am schlimmsten stand es um die nordöstlichen und östlichen Provinzen, Mondulkiri etwa oder Ratanakiri. Aber auch Battambang war davon betroffen, Siem Reap, Koh Kong oder Svey Rieng, Kompong Speu, Takeo, Kampot.
Ein Studienfreund unseres Herrn Saloth Sar, ein gewisser Khieu Sampan, der an einer Hochschule Ökonomie lehrte, schob sich damals in unser Blickfeld. Herr Saloth Sar eröffnete uns, daß er und einige Mitstudenten sich bereits in ihrer Pariser Schulzeit grundlegende Gedanken über die Misere Kambodschas gemacht und auch eine Theorie für deren Überwindung entwickelt hätten.
Als Herr Khieu Sampan den ersten Vortrag in unserem Zirkel hielt, war das für die meisten von uns eine Art Erleuchtung. Wir begriffen, seine Überlegungen sahen nicht kleine Reparaturen an unserem unzulänglichen Staatssystem vor, sondern dessen gründliche und tiefgreifende Veränderung. Khieu Sampan verkündete, Sihanouk putze Phnom Penh und ein paar andere Vorzeigeplätze im Lande so auf, daß jeder Fremde, der dahin geführt würde, vor Ehrfurcht erstarre und darauf schwöre, der Prinz wäre ein Meister der Staatskunst. Auf diese Weise erschleiche sich die Regierung außenpolitische Meriten, während der größere Teil unseres Volkes dazu verdammt sei, auf unwürdige Weise zu leben. Das müsse man ändern. Er, Khieu Sampan, setzte nicht auf Reformen, sondern auf eine – wie er es nannte – »revolutionäre Umwälzung der Gesellschaft«: Weg mit der korrupten Monarchie, in der ein Geier dem anderen das Futter stehle, weg mit der Schicht der nutznießenden Beamten und Verwalter, der Mittler und Zwischenhändler, die vom Schweiß anderer lebten, weg mit dem Geld, das nur die Reichen besäßen, weg mit allem überhaupt, was das Leben der Oberschicht angenehm mache und das der Armen bedrücke!
Herrn Khieu Sampan schwebte als Lösung eine Art locker organisierte, aber auf strikter Disziplin beruhende Gemeinschaft vor, mit einer nahezu militärischen Kommandostruktur. Hauptanliegen sollte die Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte sein, bei absoluter Gleichheit aller an der Produktion Beteiligten, was den Verdienst betraf, der ohnehin nur in Naturalien bestehen sollte. Verwaltungseinrichtungen höherer Ebene sollte es nicht mehr geben. Eine Art Urgesellschaft, einfach und anspruchslos. Industrie war nur in geringem Umfang vorgesehen, und zwar soweit sie die Landwirtschaft unterstützte. Vorbild war in jeder Beziehung das ehemalige Angkor-Reich. Eine Umkehr also. Zurück zu den Ahnen und ihrer unbestreitbaren Größe. Aber auch zu ihrer Frugalität.
Wir waren, das darf man getrost sagen, fasziniert von diesen ungewöhnlichen Ideen. Herr Khieu Sampan, der uns ausführlich das Elend der Menschen in den entlegenen Provinzen, in den Wald- und Berggebieten beschrieb, sagte damals – ich habe es mir gemerkt: »Die; systematische Nutzung bisher ungenutzter Energien, die in den bäuerlichen Massen schlummern, wird die Landwirtschaftserträge verhundertfachen und dazu beitragen, Neuland zu erschließen, das mit Hilfe gigantischer Gemeinschaftsaktionen bewässert und vor Überschwemmungen geschützt wird – das bedeutet Sattsein und Reichtum für alle, nicht mehr nur für die parasitäre Schicht der Städter, Intelligenzler, Militärs und Händler.«
Es traf den Kern der Sache, meinten wir alle, die wir zuhörten. Wir sahen täglich mit an, wie sich in der Hauptstadt eine neue soziale Schicht bildete, protzend, überheblich, ohne Skrupel. Kaufleute, Zwischenhändler, Spekulanten, hohe Beamte und Militärs, ihre Weiber, Kinder, Mätressen und Huren – das waren die Leute, deren Lebensstil uns provozierte. Sie verbargen ihren neuerworbenen Reichtum nicht etwa, im Gegenteil, sie stellten ihn zur Schau, wo immer es möglich war. Kleideten sich wie die Amerikaner oder Franzosen, aßen nur noch in teuren Restaurants, gaben abends ihre geräuschvollen Partys in Luxusvillen. Wenn sie sich überhaupt in den Straßen der Hauptstadt bewegten, dann geschah das in Buicks oder Cadillacs mit langen Heckflossen, die an Haifische erinnerten.
Haie, das waren sie auch. Sättigten sich ohne Rücksicht auf andere. Ich will damit nicht etwa das rechtfertigen, was später geschah, ich will es nur in den rechten Zusammenhang rücken. Sprechen wir es offen aus: Der Feudalismus auf dem Lande war nicht abgeschafft worden.
Ein Bauer bei uns bewirtschaftete in der Regel etwa fünf Hektar Land. Er besaß vielleicht einen Büffel und einen Pflug. Der Staat, der Land an Bauern verpachtete, verlangte den Bodenzins in Naturalien. Dadurch erwirtschafteten die meisten Bauern fast kein Geld mehr, und es kam auf dem Markt ein Überangebot an Naturalien zustande, das in den Städten Üppigkeit vortäuschte, in Wirklichkeit aber die Preise ruinierte und die Bauern zwang, selbst noch für den Eigenbedarf benötigte Produkte zu verkaufen, um ein wenig Geld für die notwendigsten Ausgaben zu erlangen. Hunger und wachsende Verarmung waren die Folge. Die reichen Städter merkten das vermutlich gar nicht. Sie lebten in Villen, ausgestattet mit dem Luxus französischer oder amerikanischer Zivilisation – wie sollten sie da wissen, was Hunger auf dem Lande war! Sie mästeten sich förmlich. Wenn es etwas gibt, das von dem Regime, das hinter uns liegt, an Wahrheiten verkündet wurde, dann ist es die über das unglaubliche soziale Gefälle bei uns gewesen. Es machte den Leuten, die uns nachher in die Katastrophe stürzten, die Sache leicht.
Auf dem Weltmarkt wurde damals kambodschanischer Reis zu Schleuderpreisen angeboten. Ein gefährliches Phänomen. Der Ertrag der Arbeit kambodschanischer Bauern wanderte nicht mehr in einem großen Kreislauf ins Land zurück – er versickerte in den Kanälen der internationalen Valutaspekulation. Zudem muß man wissen, daß die paar Hektar Land, die ich als Durchschnittsbesitz erwähnte, mit der Zeit schrumpften. Unsere Bauern haben viele Kinder. Unter ihnen mußte das vorhandene Land von Generation zu Generation neu aufgeteilt werden. Das Land nahm nicht zu, aber die Anzahl der Kinder wuchs.
Der Prinz wollte die Misere der Bauern nicht sehen. Herr Khieu Sampan sah sie. Herr Saloth Sar auch. Und wir Jungen erkannten sie. War das verwunderlich? Die theoretischen Überlegungen des Herrn Khieu Sampan enthielten ja durchaus einen Kern, der auf Tatsachen beruhte. Damals hielt auch ich die von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen für brauchbar. Heute habe ich Erkenntnisse gewonnen, die ich damals nicht besaß. Und ich habe miterlebt, daß das Land nicht nach den seinerzeit als revolutionär gepriesenen Methoden umgestaltet wurde, sondern etwas ganz anderes geschah. Noch während die große Tragödie lief, habe ich mich von dem getrennt, was ich einst für richtig gehalten hatte.
Aber kehren wir zu den damaligen Realitäten zurück, damit Sie verstehen, weshalb Leute wie ich Khieu Sampan und Saloth Sar zuhörten, ihnen sogar vertrauten.
Die Industrie in Kambodscha erbrachte zu Zeiten Sihanouks lediglich etwa 10 Prozent des Nationaleinkommens. Die erwirtschaftete sie allerdings mit Exporterzeugnissen – für den Bauern produzierte sie so gut wie nichts, wenn man von Seven-Up-Limonade und Bastos-Zigaretten absieht. So machte die Schicht der Exporteure und Industriemanager ihr Geschäft, während die Bauern in der Rückständigkeit versanken.
Daran änderte nichts, daß sich der Prinz gelegentlich vor einer Reihe von Traktoren fotografieren ließ und dazu die internationale Presse, das diplomatische Korps und überhaupt jeden ausländischen Pinsel einlud, den er erreichen konnte!
In den Städten rollten amerikanische Autos, plärrten japanische Fernseher und Recorder, es gab eine wachsende Schicht von Angestellten, die nur noch Dienstleistungen für die Großverdiener versah, vom Kraftfahrer über den Masseur und den Kellner im »Royal« bis zur Hure. Auf dem Lande fehlte hingegen selbst die Pinzette, mit der man eine Zecke hätte aus der Nackenhaut eines Babys entfernen können. In den Städten wuchs die Zahl der sogenannten Verwaltungsangestellten, während in den Dörfern die traditionellen Handwerker ausstarben, etwa der Mann, der eine Karrenachse hätte reparieren können – er wanderte, wie andere auch, in die Stadt ab, um dort Wasserklosetts für Neureiche zu bauen. –
Man muß berücksichtigen, um diese Zeit bezogen wir noch amerikanische »Hilfe« – außer einigen Lastwagen für das Militär oder ein paar Traktoren vor allem Kognak, Whisky, Waschpulver, Zigaretten, Modekleidung, Radios, TV-Geräte, feines Geschirr, Parfüms, Fahrzeuge, Möbel …
Diese Dinge wurden von etwa 10 Prozent der Bevölkerung konsumiert, und zwar in den Städten, weil es anderswo niemanden gab, der sie hätte bezahlen können, selbst wenn er sie gebraucht hätte. Auf dem Lande aber lebten 90 Prozent aller Kambodschaner, und die Importe für sie – Lampenbrennstoff, Haushaltsartikel, Werkzeuge und billiger Baumwollstoff – machten genau 4 Prozent aller Einfuhrgüter aus. Das waren die Zahlenverhältnisse, die Herr Khieu Sampan errechnet hatte. Selbst wenn sie nur annähernd stimmten, ließen sie erkennen, was da vor sich ging: Es war eine Deformation des Lebens, die wir Jungen zwar spürten, auf deren tatsächliches Ausmaß uns aber erst Khieu Sampan und Saloth Sar aufmerksam machten. Und sie boten ein Rezept an, um die Sache vom Kopf wieder auf die Beine zu stellen.
Heute halte ich dieses Rezept für fragwürdig in seiner theoretischen Basis und für barbarisch in der Form, in der es später realisiert wurde, aber man muß verstehen, daß vor allem viele junge Leute nach einem solchen Rezept griffen, nach irgendeinem, begierig, die fatale Wirklichkeit zu verändern, und ohne zunächst zu fragen, worin die Konsequenzen bestehen würden.
Khieu Sampan bot als Lösung an, zunächst die parasitäre Rolle der Städte abzuschaffen. Der Verkauf der Dorf-Produkte – wie Reis, Kautschuk oder Gemüse – sollte nationalisiert werden, um die Preise, die die Bauern erzielten, erträglicher zu gestalten. Importe sollten auf das beschränkt werden, was die Landbevölkerung brauchte, und die Exporteinnahmen sollten gemeinsam mit den Profiten aus den Landwirtschaftsgütern dazu verwendet werden, die Lage der Bauern zu verbessern. Banken, Energiebetriebe, überhaupt alle Industrieunternehmen seien zu verstaatlichen, die Verwaltungsbürokratie, die geradezu unglaublich korrupt geworden war, und die Angestellten aus dem Sektor der Luxusdienstleistungen sollten in der Landwirtschaft arbeiten, um dort die Produktion zu erhöhen. Pachtzinsen seien abzuschaffen, indem große Arbeitsgemeinschaften auf dem Dorfe gegründet würden.
Auf dem Lande, unter den einfachen Leuten, den Ärmsten, sollte der Weg entschieden werden, den Kambodscha zu nehmen hatte – nicht mehr im Königshaus oder in der von den Unternehmern bestochenen Bürokratie.
Unser Herz schlug für diese Ideen. Wir fühlten mit den Armen; das ist wohl das Vorrecht jeder Jugend. Wir waren mit dem, was Herr Khieu Sampan theoretisch ausgearbeitet hatte und was Herr Saloth Sar uns zugänglich machte, total einverstanden. Es traf unseren sozialen Nerv.
Es traf natürlich auch den Nerv des Königshauses; Khieu Sampan ebenso wie Saloth Sar galten als Kommunisten. Obgleich – genaugenommen stimmte das nicht. Sie waren, wie ich sehr viel später erfuhr, erst seit 1960 eingeschriebene Mitglieder der damaligen KP, die sich im Untergrund befand und von den Polizeiorganen erbittert verfolgt wurde. Sihanouk allerdings schmückte sich mit, wie er es nannte, »legalen Kommunisten« als Parlamentsmitgliedern, um seine Toleranz zu beweisen. Er wollte einige Vorzeigekommunisten haben, sogar als Minister, um Kritik von links abzubauen.
Nun bezeichnete sich Herr Khieu Sampan beispielsweise selbst stets als Kommunist. Er ließ durchblicken, er gehöre sogar zum Zentralkomitee der Partei. Ich habe nie, auch später nicht, herausfinden können, ob das eigentlich stimmte. Eine illegale Partei wie die damalige KPK läßt gewiß keine Mitgliederlisten herumliegen; es wären Todesurteile, wenn die Polizei sie aufspürte. Wie dem auch gewesen sein mag, wir Jungen hatten das Gefühl, es tatsächlich mit Kommunisten zu tun zu haben, selbst wenn Sihanouk es vorzog, sie zeitweilig nicht anzutasten. Für uns hatten die Kommunisten aus der Zeit der Kämpfe gegen die Franzosen einen guten Namen. Sie verkörperten soziale Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Unbestechlichkeit.
Khieu Sampan gab damals, neben seiner Lehrtätigkeit, in Phnom Penh eine Wochenzeitung in französischer Sprache heraus, die im wesentlichen der Propagierung seiner Ideen diente, wenngleich er dabei recht vorsichtig vorging und jeden direkten Konflikt vermied. Trotzdem wollte Sihanouk ihn wohl in der Öffentlichkeit als politischen Gegner abwerten. Im Herbst 1960 erschien eine Gruppe Schläger vor Khieu Sampans Haus. Dieser hielt gerade Mittagsruhe. Die Kerle zerrten den nur mit einer Unterhose Bekleideten auf die Straße und ließen ihn von einem Zeitungsreporter fotografieren. Ein Bild der Lächerlichkeit sollte er abgeben. Es hatte nicht den erwarteten Erfolg.
Zwei Jahre später änderte Sihanouk seine Taktik. Neuwahlen standen an. Die KPK war offiziell verboten. Sihanouk nahm Khieu Sampan und zwei seiner Gesinnungsfreunde, Hu Nim und Hou Yon, die beide an der juristischen Fakultät der Universität Phnom Penh lehrten, einfach in seine Sangkum-Partei und deren Wahlliste auf, mit der Begründung, er wolle Linken wie ihnen großmütig eine Chance sichern, weil sie selbst ja keiner Partei angehörten, die Listen aufstellen durfte. Sie wurden prompt gewählt, und so kam es dazu, daß sie alle drei für ein knappes Jahr Ministerposten in Sihanouks Regierung bekleideten, bis er sie wieder hinauswarf.
Herr Khieu Sampan wurde dann, 1966, nochmals auf die gleiche Weise zum Abgeordneten gewählt. Sihanouk wollte ihn wohl neutralisieren. Aber um diese Zeit hatte sich die revolutionäre Stimmung im Lande bereits so stark entwickelt, daß es in Battambang zu Aufständen kam. Da wurde auch Khieu Sampan endgültig von Sihanouk abgesetzt und zum Aufrührer und Staatsfeind erklärt.
Bevor ich über die Aufstände spreche, will ich versuchen, Ihnen ein wenig Aufschluß über das eigenartige Verhältnis Sihanouks zu den Amerikanern zu geben, weil das in unserer ganzen neueren Geschichte eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt hat. Einzelheiten darüber erfuhr ich von Saloth Sar in unserem Zirkel.
Zunächst muß man wissen, daß unser Monseigneur Papa, der Prinz aus der Norodom-Dynastie, ein Mann mit hochentwickeltem Geltungsbedürfnis war. Er rieb sich an Beleidigungen, die von den Amerikanern ausgingen und die ihn zu höchst eigenwilligen Reaktionen trieben.
Die Angelegenheit reicht weit zurück. Ich kenne sie aus den Gesprächen der Älteren, die ich später hörte. 1952, als die Franzosen Kambodscha noch ziemlich umfassend beherrschten, hatte der junge Prinz, zweifellos von nationalem Ehrgeiz getrieben, aber wohl auch von der Absicht bewegt, die Macht zu übernehmen, eine Art Weltreise unternommen, um in vielen Ländern für die Unabhängigkeit Kambodschas zu werben.
Die Reise führte ihn auch nach Washington, wo er nicht gerade wie ein Prinz behandelt wurde, eher wie ein »Eingeborener aus einem wilden Land«. Er wurde vom damaligen Außenminister John Foster Dulles empfangen, und nachdem er seinen Wunsch auf Unabhängigkeit Kambodschas vorgebracht hatte, schüttelte der große weiße Mann nur den Kopf und erklärte dem Prinzen, er solle doch froh sein, daß Kambodscha eine französische Kolonie voller französischer Soldaten wäre, das sei der beste Schutz gegen den aggressiven Kommunismus.
Nun war Sihanouk ja keinesfalls ein Kommunistenfreund, obwohl die kommunistische Widerstandsbewegung zunächst dasselbe Anliegen verfolgte wie er, nämlich die Befreiung vom Kolonialstatus. Aber Sihanouk war in Sachen seines Landes erfahren genug, Herrn Dulles darauf hinzuweisen, daß dessen Denkrichtung nicht stimmte: Die weitere Unterdrückung der Selbständigkeitsbestrebungen in Kambodscha durch die Franzosen würde im Gegenteil die Sympathien für die Kommunisten noch erhöhen. Dulles lachte ihn aus. Das kränkte Sihanouk so sehr, daß er es nie vergessen konnte.
Nach allem, was ich über die Sache erfahren habe, war das so etwas wie ein Anfangskonflikt. Ich hatte später, als ich im Dschungel lebte, worüber ich noch sprechen werde, viel Zeit, und Geschichte wurde ein wenig zu meiner bevorzugten Freizeitbeschäftigung, sofern ich Freizeit hatte. Je irrealer das Leben um mich herum wurde, je mehr Rätsel es mir aufgab, mein Gewissen plagte, mir Fragen stellte, desto mehr war ich interessiert, Wahrheiten herauszufinden, die mir helfen konnten, mich in dem Irrgarten zurechtzufinden, in den ich geraten war.
Die Politik der Amerikaner uns gegenüber war in mancherlei Hinsicht für die Entwicklung Kambodschas mitentscheidend. Es kam nach 1954, als die Franzosen aus Indochina abzogen, zu einer weiteren Kontroverse Sihanouks, des nunmehrigen Staatschefs, mit den USA. Diese bestanden darauf, daß Kambodscha der SEATO beitreten sollte, diesem antikommunistischen Pakt. Sihanouk lehnte das ab. Er stellte zu den asiatischen kommunistischen Staaten bessere Beziehungen her. Aber gleichzeitig bemühte er sich auch um Ausgleich mit den Amerikanern; er erbat bei ihnen sogar Hilfe in Form von Krediten und auf militärischem Gebiet.
Er bekam sie ab 1955. Herr Khieu Sampan errechnete, daß 30 Prozent unseres Militärbudgets von der US-Hilfe gedeckt wurden. Man sah es unserer Armee übrigens an. Uniformen, Helme, Handfeuerwaffen, Geschütze, Panzer, Lastwagen, das alles stammte aus amerikanischen Beständen. Lediglich bei den Luftstreitkräften wurden alte französische Typen benutzt, sonst überwog US-Material.
Sie werden wissen, daß Sihanouk 1963 dann die US-Hilfe zurückwies. Das hing mit der damaligen Entwicklung im Vietnamkrieg zusammen und mit Forderungen, die uns die in Südvietnam stationierten Amerikaner stellten. Wir sollten ihnen mehr oder weniger verdeckt gegen den vietnamesischen Widerstand helfen. Sihanouk wollte nicht als Komplize der Amerikaner angesehen werden. Deshalb warf er ein Jahr später auch noch die US-Militärmission hinaus. Aber hinter dieser Abkühlung der Beziehungen steckte mehr als nur der Aspekt Vietnam. Auch mehr als die Verbesserung unserer Beziehungen zu Rotchina, wie manche glauben.
Nein, man muß die wahren Gründe woanders suchen. Zuerst bei Sihanouk natürlich und bei seinem leicht verletzbaren Selbstbewußtsein. Aber auch schon bei dem ersten diplomatischen Vertreter, den die USA nach der Genfer Konferenz zum Botschafter in Phnom Penh ernannten: Robert McClintock, das Urbild amerikanischer Arroganz. Er sprach von uns grundsätzlich nur als von den »Eingeborenen«, auch öffentlich. Wenn er in den Königspalast gerufen wurde, unterließ er es nie, den Prinzen vor aller Ohren zu belehren, seine Reden seien zu lang, seine Stimme zu hoch und sein Regierungsstil lächerlich. Er bot an, in diesen Fragen als Berater für Sihanouk tätig zu werden. Damit nicht genug – zu offiziellen Diplomatenempfängen erschien der Botschafter grundsätzlich in kurzen Hosen, mit nackten Knien.
Eine freche, gezielte Beleidigung, wenn man bedenkt, daß man bei uns keine Shorts trägt. Selbst die Ärmsten, die Rikschafahrer, pflegen lange Hosen zu tragen, geflickt zwar, aber jedenfalls lang. Auf den Dörfern bevorzugt man den traditionellen Sampot, der ebenfalls bis an die Waden reicht. Nur manchmal, wenn ein sehr armer Mann seine einzige Hose gewaschen hat, wartet er in kurzen Turnhosen darauf, daß sie trocknet.
Der Aufzug des US-Botschafters stellte also eine Beleidigung dar, eine Herabwürdigung unseres Staatsoberhauptes, des ganzen Staates überhaupt. Weiter: Bei uns zulande ißt man Hundefleisch, nicht aus Armut – es gilt als Delikatesse. Ich will nicht über Geschmack streiten – ich rede von Takt. Der Herr Botschafter erschien nämlich nicht nur in kurzen Hosen zu Staatsanlässen, er führte auch noch seinen kleinen Hund an der Leine mit, der kläffte dann zwischen die Reden der Diplomaten. Gelegentlich ermahnte ihn sein Herr, er solle leise sein, sonst werde er gegessen.
Verstehen Sie mich recht, ich war nie ein Royalist. Aber im internationalen Verkehr gibt es gewisse Regeln des Anstands. In der Hauptstadt erzählte man sich damals, daß McClintock zusammen mit Sihanouk eine Entbindungsklinik einweihte, die uns von den USA im Rahmen ihrer Hilfe geliefert worden war. Am Schluß seiner Rede wies der Botschafter auf eine Reihe Betten und sagte, zu Sihanouk gewandt, laut und vernehmlich für alle Gäste: »Nun, mein lieber Prinz, können Sie getrost Ihre persönliche Produktion von Nachwuchs steigern!«
1958 wurde der Botschafter gewechselt, Mister Carl Strom kam zu uns. Mit einer anderen Taktik. Er arbeitete mit Druck. Verbot uns, an der Ostgrenze, wo die südvietnamesische Armee ziemlich oft unser Territorium verletzte, US-Waffen einzusetzen. Hintertrieb unser Verhältnis zu Thailand bis zum Abbruch der Beziehungen. Mobilisierte die sogenannten Khmer Serai, eine vornehmlich gegen das Königshaus gerichtete Bewegung militanter Art, die Son Ngoc Thanh anführte, den die Japaner noch kurz vor ihrer eigenen Kapitulation zum Ministerpräsidenten in Kambodscha gemacht hatten. Die Khmer Serai hatten sich nach der Unabhängigkeit in Südvietnam verkrochen, jetzt fielen ihre Trupps wieder bei uns ein und terrorisierten ganze Landstriche.
1959 dann – ich weiß nicht, ob es Tatsachen gab, die das belegten – verkündete Sihanouk, die US-Botschaft in Phnom Penh habe mit den Khmer Serai und einigen bestochenen Provinzgouverneuren einen Putsch gegen ihn geplant, der Kambodschas Neutralität in eine enge Partnerschaft mit den USA umwandeln sollte. Damals mußte ein hoher Beamter der US-Botschaft, ein gewisser Matsui, dem Tätigkeit für die CIA nachgewiesen wurde, Kambodscha verlassen. Sihanouks Privatkrieg mit den Amerikanern trat in eine neue Phase. Wichtig aber war, daß der Einfluß der amerikanischen Lebensweise unter den wohlhabenderen, gebildeten Schichten der Städte stärker wurde. Daran arbeiteten unzählige »stille Amerikaner« bei uns. Sie gewannen durch Bestechung diesen oder jenen Provinzgouverneur, und sie sicherten sich Einfluß bei hohen Militärs, die ihrerseits wiederum ihre Macht nutzten, um von der Dorfbevölkerung der ihnen unterstellten Gebiete zusätzliche Abgaben zu erpressen.
So geriet Sihanouk einerseits immer mehr in Widerspruch zu eigenen Beamten, die Nutznießer amerikanischer Manipulationen waren, und andererseits zu der zunehmend verelendenden Bevölkerung in den unterentwickelten Gebieten. Er zeigte sich den Politikern in Hanoi aufgeschlossen und forderte die USA auf, Vietnam zu verlassen. 1963, nachdem die Amerikaner in Saigon den unbequem gewordenen Politiker Diem hatten ermorden lassen, brach der Prinz wirtschaftlich und militärisch völlig mit den Vereinigten Staaten. Um zu Hause Ordnung zu schaffen, verkündete er eine Wirtschaftsreform, verstaatlichte einige Banken und verhängte das Staatsmonopol über den gesamten Außenhandel. Gleichzeitig aber schwor er, Kambodscha werde nie kommunistisch werden, und um die Oberschicht in den Städten und in der Verwaltung zu besänftigen, ordnete er immer schärfere Verfolgungen der Kommunisten im Lande an.
Er schien aber übersehen zu haben, daß die Amerikaner sich inzwischen in aller Stille mit seinem Verteidigungsminister Lon Nol arrangiert hatten. 1966, bei den nächsten Parlamentswahlen, gewann Lon Nol die meisten Stimmen und wurde Premierminister. Wobei man wissen muß, daß die Stimmen der Leute in den von der Hauptstadt entfernteren Regionen einfach unterschlagen wurden. Es seien Rebellengebiete, nicht zur Wahl befugt, hieß es. Aber – ich greife vor …
Interessant im Zusammenhang mit der späteren Entwicklung war, daß Ieng Sary, der am Kamputh-Both-Lycée Französisch gelehrt und häufig an unserem Zirkel teilgenommen hatte, bereits 1963 aus Phnom Penh verschwunden war. Angeblich, um im Untergrund bei der Führung der Kommunisten zu wirken. Saloth Sar folgte ihm 1965. Unser Zirkel verwaiste. Ich selbst arbeitete inzwischen als Assistent am Lycée. Wie die meisten anderen Gebildeten war auch ich unzufrieden mit der Unterdrückungspolitik Sihanouks gegen die Opposition, und ich begann, einen Ausweg nur noch in der Rebellion zu sehen, wie das im Zirkel immer wieder zu hören gewesen war.
Die Stimmung damals kann man als explosiv bezeichnen. Wir standen in einem seltsamen Konflikt: Einerseits waren wir gegen Sihanouk, der sich krampfhaft bemühte, das Staatswesen gegen die Wühlarbeit der Amerikaner und ihrer einheimischen Helfer zusammenzuhalten. Andererseits aber standen wir mit Herz und Verstand links, waren also wütende Gegner der amerikanischen Eskalation des Vietnamkrieges. Wir schmorten sozusagen zwischen zwei Feuern. Und dann, in dieser Situation, als General Lon Nol das Amt des Ministerpräsidenten ausübte und das Schicksal Sihanouks ungewiß war, weil dieser sich scheinbar aus der Politik etwas zurückzog, brach in Battambang, im Nordwesten des Landes, plötzlich ein Bauernaufstand aus. Man sprach von der Rebellion von Samlaut.
Dieses Samlaut ist eine kleine Ortschaft westlich der Provinzhauptstadt Battambang. Es liegt, schwer zugänglich, in einem dichten Regenwaldgebiet, und die Mehrzahl der dort lebenden Bewohner, die sich von primitivem Ackerbau ernährte, gehörte zum Stamme der Pors, einer jener vergessenen Minderheiten, die zu den ärmsten und unterprivilegiertesten Leuten im Lande zählten. Dazu kam, daß sich gerade in dieses Gebiet viele ehemalige Kämpfer aus dem antifranzösischen Widerstand zurückgezogen hatten, die von Sihanouks Polizei als »Kommunisten« gejagt wurden.
Nun beschlossen der Provinzgouverneur und ein paar Geldleute aus Battambang, in der Gegend um Samlaut ausgedehnte Zuckerrohrplantagen anzulegen; auch eine Raffinerie sollte gebaut werden, in Kompong Kol, wenige Kilometer von Samlaut entfernt. Die Provinzbehörden begannen kurzerhand Land zu enteignen, so daß den Bauern die Existenzgrundlage genommen war. Die Betroffenen rotteten sich zusammen. Sie gruben ihre seit dem antifranzösischen Widerstand versteckten Gewehre aus und verteidigten ihre Äcker, die sie mühsam aus dem Dschungel gerodet hatten.
Lon Nol schickte Militär in die Region, später auch Polizei. Es kam zu unbeschreiblichen Massakern. Hunderte von Dorfbewohnern, meist Frauen und Kinder, wurden getötet. Wer davonkam, floh in den Wald und schloß sich den Bewaffneten an. Die Revolte schwelte weiter. Sihanouk, der ja offiziell immer noch Staatschef war, nahm die Chance wahr und entließ zunächst Lon Nol, dem er vorwarf, untaugliche Maßnahmen angewandt zu haben, wie immer man das verstehen wollte. Er selbst ließ wenig später aber neue Einheiten in die Rebellengegend entsenden, dazu Schlägertrupps aus der Provinzhauptstadt, denen er gute Posten in der zukünftigen Zuckerbranche versprach.
Wieder begann das Abschlachten von Dorfbewohnern. Mit dem Erfolg, daß noch mehr Leute in den Wald flohen. Sie überfielen Polizeiposten, raubten Militärtransporte aus, bewaffneten sich, wählten Anführer, die sie Kommunisten nannten, die das hin und wieder wohl auch waren, und begannen nach und nach einen einfallsreichen Guerillakrieg.
Was später unter der von Sihanouk geprägten Bezeichnung Khmer Rouges von geschickt vorgehenden Theoretikern wie Saloth Sar, Khieu Sampan und anderen als »kommunistische Befreiungsbewegung gegen das Sihanouk-Regime« ins Feld geführt wurde, entstand in dieser Phase unserer Entwicklung.
Herr Khieu Sampan, den ich damals noch regelmäßig sah, traf sich stets heimlich mit mir. Noch war er ja offiziell Abgeordneter, aber er teilte mir mit, daß er fliehen müsse. Er zeigte mir eine druckfrische Zeitung mit einem zornigen Artikel Sihanouks. Danach waren die Samlaut-Aufstände von ihm, Khieu Sampan, sowie von zwei weiteren linken Oppositionellen, den Herren Hou Yon und Hu Nim, organisiert worden. Man werde die drei zur Rechenschaft ziehen, drohte Sihanouk, die Todesstrafe sei ihnen sicher.
Ich war ziemlich ratlos, aber Herr Khieu Sampan versicherte mir, er sei in der Lage, sich zu retten. Herr Saloth Sar, der sich bereits im Untergrund befinde, würde ihn aufnehmen, das Versteck läge in einer unerschlossenen Region der Provinz Kompong Cham. Von mir wollte er wissen, ob ich jetzt, da die Stunde der Abrechnung nahe sei, weiter der linken Bewegung dienen wolle. Ich sagte sofort zu.
Es war keine überhastete Entscheidung. Ich hatte aus vielen theoretischen Erörterungen im Zirkel eine Vorstellung von der wahren sozialen Misere meines Landes, und ich glaubte fest daran, daß nur noch der allgemeine Aufstand eine Lösung bringen könnte. Also war ich einverstanden, als er mich bat, vorerst in der Hauptstadt zu bleiben, da ich nicht auf der Liste der Polizei stand. Wir vereinbarten ein Losungswort, es hieß »Großvater ist krank«. Jedem, der mich damit ansprach, sollte ich Informationen über die Lage in der Hauptstadt übermitteln und ihm überhaupt helfen.
Herr Khieu Sampan verschwand. Auch die beiden anderen Beschuldigten tauchten unter. Eine Weile wurden sie gesucht. Dann gab es Gerüchte, sie seien von Sihanouks Polizei ermordet worden, aber es wurde kein Beweis vorgezeigt, also war ich sicher, daß sie entkommen konnten.
Gewißheit darüber erhielt ich viel später. Das war lange, nachdem Sihanouk selbst den nächsten, ganz ähnlichen Aufstand provoziert hatte: Seit dem Aussetzen der US-Hilfe war es in der Kasse des Prinzen zu einer erheblichen Devisenknappheit gekommen. Da entschied Sihanouk, in dem ausgedehnten Basalthochland der nordöstlichen Grenzprovinz Ratanakiri riesige Kautschukplantagen anlegen zu lassen, mit deren Ertrag in Zukunft die nötigen Devisen beschafft werden sollten. Ziemlich naiv, wenn man bedenkt, wie lange ein Kautschukbaum braucht, bis er Ertrag bringt – trotzdem, es wurde so verfügt.
Es war, als würden sich die Ereignisse von Samlaut wiederholen. In der ins Auge gefaßten Gebirgsregion lebten zurückgebliebene Bergvölker, die sich recht kümmerlich, ähnlich wie die Pors, durch Brandrodung und Jagd ihre Nahrung beschafften. Vergessene wie in Samlaut. Als sie das Gebiet nicht räumen wollten, ließ der Provinzgouverneur einige hundert von ihnen erschießen. Das wirkte wie ein Signal. Tausende verschwanden in den Wäldern, vorerst nur mit Pfeil und Bogen bewaffnet, mit Speeren, Knüppeln und Hacken. Die Armee konnte sie nicht erwischen. Sie teilten sich in kleinere Gruppen auf und legten Hinterhalte. Die Zugänge zu ihren Verstecken blockierten sie mit tödlichen Fallen, wie sie sie von jeher für jagdbares Wild angelegt hatten. Es dauerte nicht lange, dann erkrankten die regulären Soldaten, die ihnen nachstellten, an Malaria, Dysenterie, an unbekannten Fiebern. Ein neuer Herd der Rebellion war entstanden. Niemand konnte ihn mehr beseitigen. Im Gegenteil, Leute wie Khieu Sampan, Saloth Sar und andere begannen, die Rebellen militärisch zu formieren und auszubilden. Sie erzählten ihnen, sie seien die Führer der Kommunistischen Partei – dazu hatten sie sich, wie ich später berichten werde, auch tatsächlich gemacht –, also war das nicht einmal gelogen. Doch das ist wirklich eine andere Geschichte, und ich werde morgen damit fortfahren, falls nicht einer meiner beiden Freunde zuvor spricht.