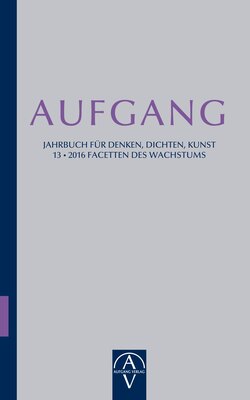Читать книгу Aufgang. Jahrbuch für Denken, Dichten, Kunst - Heinrich Beck Barbara Bräutigam Christian Dries Silja Graupe Anna Grear Klaus Haack Rüdiger Haas Micha - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ingrid Lanzl Berufliches Wachstum
ОглавлениеEin Gespräch1
Vorbemerkung
München, den 21. November 2015, 11.00 Uhr. Der Schriftleiter von Aufgang, Herr Dr. Rüdiger Haas, trifft Frau Dr. Ingrid Lanzl in einem Café in München an der Donnersberger Brücke. Es ist ein Samstag. Das Ambiente ist ruhig und entspannt, die Gesprächsteilnehmer sitzen an einem kleinen Tisch. Beim persönlichen Kennenlernen ist Frau Lanzl überrascht, mit philosophischen Fragen konfrontiert zu werden, und betont, keine Philosophin zu sein. Nach der kurzen Klärung, dass man nicht Philosophie studiert haben müsse, um über Sinnfragen des Lebens sprechen zu können, leitet das Gespräch direkt über zum beruflichen Werdegang von Frau Dr. Lanzl.
*
Das Gespräch
Aufgang: Unser Thema „Facetten des Wachstums“ fragt nach den verschiedenen Wachstumsaspekten. Was uns interessiert, ist Ihr persönliches berufliches Wachstum, die Stationen und persönlichen Erfahrungen, die Sie durchlaufen haben, um Ihre verantwortungsvolle Tätigkeit in der privaten Wirtschaft ausführen zu können. Welche Schulausbildung haben Sie genossen?
Lanzl: Es für mich schon frühzeitig klar, dass ich aufs Gymnasium gehen würde. In der siebten Klasse konnten wir uns zwischen dem mathematisch-naturwissenschaftlichen und dem neusprachlichen Zweig entscheiden. Da meine Interessen im Bereich Naturwissenschaften lagen, war auch hier die Entscheidung klar.
Aufgang: Wie ging es nach Ihrem naturwissenschaftlichen Abitur weiter?
Lanzl: Schon während meiner Schulzeit habe ich mich für Technik interessiert. Bei Wanderungen mit der Familie durfte ich als Kind Wasserkraftwerke besichtigen. Die Nutzung der vorhandenen Wasserkraft und die Möglichkeiten einer effizienten Energiegewinnung haben mich so begeistert, dass ich mir überlegte, so etwas auch einmal machen zu wollen. So entstand mein Berufswunsch: Maschinenbau-Ingenieurin.
Aufgang: War das damals nicht ungewöhnlich, als Mädchen Maschinenbau studieren zu wollen?
Lanzl: Meine Begeisterung für Technik und mein Berufswunsch waren für mich überhaupt nicht ungewöhnlich. Es war für mich selbstverständlich, für eine bessere Energieversorgung arbeiten zu wollen. Dass nicht jeder die Vorstellung einer geschlechterunabhängigen Berufswahl teilt, erkannte ich erst, nachdem ich einige negative und aggressiv ablehnende Reaktionen auf meinen Berufswunsch erhalten hatte.
Davon habe ich mich nicht einschüchtern lassen. Es gibt keinen Grund dafür, ein bestimmtes Fach nicht zu studieren, nur weil man eine Frau ist. Dasselbe gilt auch für Männer.
Aufgang: Sie haben Ihr Studium mit Freude geradlinig bis zum Diplom durchgezogen.
Lanzl: Ich habe konsequent und mit Begeisterung Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Energie- und Kraftwerkstechnik studiert. Danach konnte ich im Fachbereich Thermodynamik promovieren und auf diese Art auch das wissenschaftliche Arbeiten lernen.
Aufgang: Wie lange hatten Sie die Forschungsstelle und wann schlossen Sie Ihre Promotion ab?
Lanzl: Ich war fünf Jahre an der Technischen Universität München als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt. Mit Auslauf des Forschungsauftrags wurde ich promoviert.
Aufgang: Sie wurden mit 28 Jahren zum Doktor Ing. promoviert. Was war das Besondere an Ihrer Doktorarbeit?
Lanzl: Das Thema hieß „Teilkondensation am horizontalen Rohrbündelwärmetauscher“. Es ging um Kondensation in Anwesenheit von Luft und Wasserdampf und darum, herauszufinden, wie man diese Kondensationseffekte berechnet. Mein Beitrag war die Entwicklung einer neuen Formel sowie die Korrektur einer Phänomen-Beschreibung.
Aufgang: In der Phänomenologie beschreiben wir menschliche Phänomene, die aber nicht berechenbar sind, weil das Phänomen der Psyche grundsätzlich über den Berechnungsaspekt hinausgeht.
Lanzl: Auch die Phänomene in der Thermo- und Strömungsdynamik sind nicht so einfach zu berechnen.
Aufgang: Sie mussten aber vertiefte mathematische Erkenntnisse in die Arbeit einbringen.
Lanzl: Es war eine experimentelle Arbeit, bei der ich einen Prüfstand aufbaute und mit studentischen Hilfskräften Messungen durchführte. Aus den Messdaten habe ich versucht, einen logischen Zusammenhang zu entwickeln, was mir dann auch gelungen ist. Dieser Zusammenhang musste beschrieben werden. Ich bin ein Mensch, der nicht so schnell aufgibt. Natürlich gab es bei der Forschung immer wieder reale Hindernisse. Wenn bei der Durchführung von Versuchen etwas nicht funktioniert hatte, musste man es eben auf anderem Weg noch einmal probieren. Durchhaltevermögen zeigen und an der Sache dranbleiben sind wichtige Grundvoraussetzungen für den Erfolg.
Aufgang: Durchhaltevermögen und die Überwindung von Hindernissen führten Sie zu kontinuierlichem beruflichem Wachstum. Nun waren Sie Mitte der 90er Jahre promoviert. Was war Ihre erste berufliche Station außerhalb der Uni?
Lanzl: Die Lage auf dem Arbeitsmarkt war zu dieser Zeit sehr schlecht. Aufgrund meiner Vorkenntnisse in der Energietechnik und Thermodynamik konnte ich trotzdem eine sehr interessante Aufgabe in der Entwicklung bei einem Automobilzulieferer bekommen. Für meine berufliche Entwicklung war das eine wichtige Stelle, weil ich schon sehr früh Verantwortung übernehmen durfte. Zudem konnte ich das nutzen, was ich während der Promotionszeit gelernt hatte, einschließlich des Durchhaltevermögens.
Aufgang: Wie lange waren Sie in diesem Betrieb?
Lanzl: Sieben Jahre. Ich bekam immer mehr Aufgaben übertragen, mehr Verantwortung und auch Führungsverantwortung. Zudem fand ich es sehr interessant, gesammelte Erfahrungen an Leute weiterzugeben und sie entsprechend anzuleiten, nicht sofort beim ersten Hindernis aufzugeben. Auch von netten Kollegen durfte ich in dieser Firma viel lernen, sodass sich ein großes persönliches Wachstum einstellte.
Aufgang: Neben der Durchhaltekraft haben Sie auch gelernt, Menschen zu führen. Das ist nicht leicht. Gehört das zu Ihren persönlichen Stärken?
Lanzl: Es ist überhaupt nicht leicht, Menschen zu führen. Auf diesem Gebiet lernt man nie aus. Aber es ist ein schönes Erlebnis für mich, zu sehen, wenn Menschen, unterstützt durch meine Führung erfolgreich und auch mit Freude arbeiten.
Aufgang: Welche Fähigkeit brauchen Sie, um Menschen führen zu können?
Lanzl: Ich muss eine klare Vorstellung vom Weg haben, auf den ich führen möchte. Dabei muss ich überlegen, wie Leute eingebunden werden können und welche Informationen sie benötigen, um die Ziele zu sehen. Es ist wie beim Bergwandern. Wenn der Führer seinen Weg nicht kennt, nicht weiß, auf welchen Gipfel er will oder was er seinen Leuten zumuten kann, dann geht es schief. An diesem Bild erkenne ich meine Führungsaufgabe.
Aufgang: Souveränität in der Fach- und Sachkompetenz sind Voraussetzungen.
Lanzl: Nicht einmal so sehr. Ich hatte Gott sei Dank ausgezeichnete Mitarbeiter, die mir in manchen fachlichen Aspekten überlegen waren. Ich muss in der Lage sein, diese Überlegenheit anzuerkennen und zu nutzen. Ich muss die Fachkompetenzen der einzelnen Leute zusammenführen und darauf achten, dass sie sich gegenseitig unterstützen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
Aufgang: Das sind sogenannte Soft Skills [Fähigkeit im Umgang mit Menschen], also emotional-soziale Fähigkeiten. Braucht man dazu auch Intuition?
Lanzl: Man muss menschliche Fähigkeiten analysieren können. Was kann der Mitarbeiter und was kann er nicht? Natürlich hilft auch Intuition. Je länger ich diese Prozesse leite, desto besser kann ich mich auf die Intuition verlassen. Aber gerade als Anfänger muss man analysieren und überlegen. Ich muss nicht unbedingt fachlich besser sein als meine Mitarbeiter, aber ich muss in der Lage sein, ihnen Ziele und Richtung vorzugeben. Weil es wichtig ist, dass sie in ihrer Arbeit nicht eingeschränkt werden, gehe ich sehr systematisch und analytisch vor. Wenn ich dann sehe, wie die einzelnen Prozesse ineinandergreifen, Mitarbeiter gut und mit Erfolg zusammenarbeiten, habe ich Freude an meiner Arbeit. Es ist eine wunderbare Aufgabe, zu sehen, wenn sich die Mitarbeiter gegenseitig motivieren und am Ende Ergebnisse herauskommen, die meine Erwartungen übertreffen.
Aufgang: Analyse ist wichtig, aber es muss auch ein Gesamtbild entstehen.
Lanzl: Die Analyse steht am Anfang, die verschiedenen Kräfte müssen sich stärken, damit Synergien entstehen können.
Aufgang: Diese Fähigkeiten sind nicht jedem gegeben.
Lanzl: Stimmt. Diese Fähigkeit braucht aber auch nicht jeder. Wenn alle Menschen führen wollen, hat man am Ende nur noch einen Kampf um die wenigen Führungspositionen. Man braucht mehr Spezialisten, die mit hervorragenden Fachkenntnissen ausgezeichnete und detaillierte Lösungen erarbeiten. Es muss unterschiedliche Talente und Aufgaben geben.
Aufgang: Und Ihr Talent ist das Führen?
Lanzl: Man hat mir zumindest oft gesagt, ich könne gut führen. Ich war hier immer anerkannt und es bereitet mir auch Spaß.
Aufgang: Dann stehen Sie am richtigen Ort. Hatten Sie nie Angst?
Lanzl: Angst nie. Ich habe aber öfter Zweifel. Man muss sich immer wieder selbst hinterfragen: Ist es richtig, was ich mache? Gebe ich meinen Mitarbeitern den richtigen Input? Stimmt die Zielrichtung? Wenn man sich nicht selbst hinterfragt, ist die Gefahr groß, dass man etwas Falsches macht. Man braucht Abstand, aber Angst ist nicht im Spiel.
Aufgang: Was muss konkret hinterfragt werden?
Lanzl: Von einfachen fachlichen Dingen angefangen, z.B., ob Methode oder Arbeitsgeschwindigkeit richtig sind, bis hin zum Führungsstil: Habe ich mit meinen Mitarbeiter passend kommuniziert? Es gibt auch Konflikte und Krisengespräche, bei denen man durchaus kritische Worte finden muss. Dann muss geprüft werden, ob man den betreffenden Mitarbeiter verletzt hat und er sich deswegen vielleicht zurückzieht. Oder: Bin ich gegenüber einem Mitarbeiter nicht klar genug, bin ich zu nachgiebig, woraufhin der Mitarbeiter zu viel Eigennutz durchsetzt. Diese Situationen mit den richtigen Worten auszubalancieren ist sehr schwer.
Aufgang: Sich selbst hinterfragen heißt auch, offen zu sein für andere und seine Position nicht absolut zu setzen. Hier geht es um bewusstes Wahrnehmen. Herbert von Karajan hat diese Rolle bei der Führung der Berliner Philharmoniker nicht gespielt.
Lanzl: In einem Orchester kann man kaum darüber diskutieren, welche Interpretation die richtige ist. Sie wird vom Dirigenten vorgegeben. Ich denke aber, dass Karajan sich die Frage, welche Interpretation die angemessene ist, sicherlich gestellt hat. Und in diesem Punkt war er dann bestimmt auch selbstkritisch, wenngleich er sich nach außen hin als Autorität zeigen musste. In der Industrie kann man als Führungskraft mit guten Mitarbeitern durchaus diskutieren und ihnen die Frage stellen, was sie vom eingeschlagenen Weg halten.
Aufgang: Ich denke beim Führen auch noch an eine andere Persönlichkeit: Steve Jobs, von dem berichtet wird, er führte die straffe Regentschaft auf Kosten seiner Mitmenschen.
Lanzl: Ich habe gehört er sei ein Genie gewesen, mit dem die Leute zusammengearbeitet haben oder auch nicht. Aber scheinbar gab es auf menschlichem Gebiet genügend Konflikte.
Aufgang: Steve Jobs hat seine Ziele scheinbar mit aller Härte verfolgt. Das Menschliche war für ihn weniger wichtig. Priorität hatte der Erfolg des Produkts. Sie aber berichten von der Kunst der Menschenführung. Für den menschlichen Menschen steht das Phänomen des Staunens und der Offenheit gegenüber Mitmenschen im Vordergrund. Von hier aus ist der Bogen zum Sich-selbst-Hinterfragen nicht weit. Die Kunst der Menschenführung ist nicht selbstverständlich. Es wird hier sehr viel Missbrauch getrieben. Menschen in Führungspositionen stellen sich oft zu wenig die Frage nach dem richtigen eigenen Handeln.
Lanzl: Es gibt Dinge, die man lernen kann. Gerade von meinem ersten Vorgesetzten in der privaten Wirtschaft habe ich in dieser Hinsicht sehr viel gelernt, zum Beispiel, dass man sich als Führungskraft hinterfragen muss. Wenn Mitarbeiter nur zehn Prozent weniger Leistung erbringen, weil sie sich über den Chef ärgern, dann wird bei zehn Mitarbeitern eine ganze Stelle verschwendet. Solche Dinge wurden mir von meinem Chef ans Herz gelegt. Er hat mit mir darüber diskutiert, ob ich als Führungskraft richtig handle. Vor allem aber hat er einer Führungskraft zugestanden, auch einmal Fehler zu machen.
Aufgang: Wir sind alle nicht perfekt, machen alle Fehler. Als Junglehrer macht man viele, aus denen man dann lernt. Heißt sich selbst hinterfragen auch sich Fehler eingestehen können?
Lanzl: Auf alle Fälle. Ich möchte die Führungskraft sehen, die keine Fehler macht. Sie wäre nicht menschlich. Mittlerweile ist es Standard, sich bei Mitarbeitern zu entschuldigen, wenn man Führungsfehler gemacht hat. Diese Verhaltensweise ist heute nicht nur akzeptiert, sondern erforderlich. So autoritär führen wie in den 50er-Jahren ist nicht mehr möglich. Diesen Führungsstil lässt sich kein Mitarbeiter gefallen. Er sucht sich dann sehr schnell eine andere Firma.
Aufgang: Kann man sich das als Mitarbeiter leisten?
Lanzl: Selbstverständlich. Ich würde sogar sagen: wesentlich mehr als früher. Früher war man mit der Firma vielleicht sogar „ein bisschen verheiratet“, aber heute gibt es den familiären Zusammenhalt zwischen Angestellten und der Firma nicht mehr.
Aufgang: An vielen Schulen haben die Rektoren heute die Qual der Wahl. Sie brauchen ihren Führungsstil oft nicht zu hinterfragen, weil sie bei der Einstellung von Bewerbern meist aus dem Vollen schöpfen können. Wenn jemand die Schule verlässt, wird eben ein anderer eingestellt.
Lanzl: An einer Schule kann man sich das vielleicht eher erlauben, weil man weniger im Team arbeitet. Im industriellen Unternehmen ist es fast immer auch ein finanzieller Verlust, wenn ein Mitarbeiter die Firma verlässt. Ein neuer Mitarbeiter muss sich erst einarbeiten und mit den Kollegen vernetzen. Es ist auch nicht klar, ob und wie er in die Gesamtkonstellation passt. Das kostet Geld, Zeit und Aufwand, ist also unökonomisch. An der Schule hingegen arbeiten Kollegen eher unabhängig voneinander. In der Industrie versucht man – mit Ausnahmen – Mitarbeiter zu halten.
Aufgang: Über finanzielle Anreize?
Lanzl: Unter Umständen ja. Man kann mit Geld kaum zusätzlich motivieren, aber man kann demotivieren. Wenn ein Mitarbeiter den Eindruck hat, er verdiene zu wenig, kann das so demotivierend sein, dass er kündigt. Dann muss auch an der Gehaltsschraube gedreht werden.
Aufgang: Welche anderen Möglichkeiten gibt es, Mitarbeiter zu halten?
Lanzl: Viele. Alle Mitarbeiter brauchen positives Feedback und Anerkennung. Hier können Vorgesetzte zur Motivation beitragen.
Wenn jemand unterfordert ist, kann man diesen Mitarbeitern spezielle Projekte übertragen. Es gibt die Möglichkeit einer Beförderung. Manchmal passt auch nur der Arbeitsplatz nicht, wenn es z.B. zu laut ist oder die Beleuchtung nicht stimmt.
Aufgang: Sie waren sieben Jahre in diesem Unternehmen. Was kam danach?
Lanzl: Ich war sieben Jahre in der Entwicklung von spezifischen Automobilkomponenten in den Funktionen Entwicklungsspezialist, Projektleiter und Abteilungsleiter. Das war interessant, aber auf Dauer auch etwas eintönig. Auf Basis meiner sehr fundierten Kenntnisse in der Automobilbranche habe ich mir eine Aufgabe gesucht, mit der ich meinen Horizont entscheidend erweitern konnte. Diese Aufgabe habe ich bei einem japanischen Unternehmen im Vertrieb von Automobilkomponenten gefunden.
Aufgang: Waren Sie öfters in Japan?
Lanzl: Ich war bis jetzt 15 Mal in Japan.
Aufgang: Sind Sie mit der Kultur des Landes auch in Kontakt gekommen?
Lanzl: Natürlich. Es gibt japanische Kollegen und Vorgesetzte, an deren Arbeitsstil man sich kulturell anpassen muss. Es war eine sehr reizvolle, schöne Aufgabe. Vorher war ich bei dem regional verwurzelten Unternehmen tätig und plötzlich fand ich mich in einem internationalen Konzern mit japanischer Führung wieder.
Aufgang: Was hat Sie an der japanischen Kultur besonders beeindruckt?
Lanzl: Die langfristige Denkweise.
Aufgang: Eine vorausschauende, philosophische Denkweise? Was machen die Japaner anders?
Lanzl: Unser Menschenbild ist mehr individuell ausgerichtet, während in Japan die Gruppe wichtiger ist. Bei uns bringt jeder seine eigenen Ideen ein und möchte diese oft durchsetzen, was natürlich auch eine unserer Stärken ist. Deswegen gelingen uns viele Erfindungen. Ein solches Verhalten finden wir in Japan weniger. Die Menschen sind sehr stark in Gruppen integriert. Aufgrund dieser Gruppendynamik überlegen die Mitarbeiter gemeinsam, welches Ziel sie verfolgen wollen. Entscheidungsprozesse dauern für europäische Maßstäbe sehr lange. Als Europäer braucht man hier viel Geduld. Aber wenn einmal eine Entscheidung vorliegt, ist sie Ergebnis eines Gruppenprozesses, die ein Einzelner dann kaum mehr umdirigieren kann. Dieser Findungsprozess ist langfristig angelegt. Es war für mich faszinierend, mit welcher Geduld, Entschlossenheit und Geschlossenheit eine japanische Firma agiert.
Aufgang: Ein kultureller Unterschied, Geduld, Geschlossenheit, Gruppenbewusstsein. Der Zen-Buddhismus ist eine seit vielen Jahrhunderten wichtige Tradition in Japan. Das Aufgehen in einem großen Ganzen und geistig-praktisches Handeln sind wichtig. Ein solcher Geist ist in Japan lange Zeit gepflegt worden. Anscheinend ist er trotz der Globalisierung heute immer noch anwesend.
Lanzl: Trotz der anscheinend globalisierten Welt gibt es immer noch regionale Unterschiede. Es ist sehr spannend in einer wirklich internationalen Umgebung zu arbeiten. Ich habe mich deshalb sehr gefreut, dass mir in diesem Unternehmen eine Beförderung zur Direktorin für Marketing im Bereich Bau und Industrie angeboten wurde. Ich konnte hier meine bisherigen Erfahrungen aus der Entwicklung und dem Vertrieb einbringen. Jetzt war ich dafür verantwortlich, die Produkte zu definieren, die diese Firma in der Zukunft braucht, um erfolgreich zu bleiben. Die technische Beratung und die Kommunikation gehörten ebenfalls zu meiner Aufgabe. Die Stelle war in Brüssel angesiedelt. Ich bin dazu drei Jahre zwischen Brüssel und München gependelt und habe in beiden Städten gelebt.
Aufgang: Sie waren also immer offen für Veränderungen in Ihrem Leben?
Lanzl: Ja. Das Grundlegende nimmt man natürlich immer mit. Wie führe ich Leute? Wie gehe ich mit Menschen um? Wie strukturiere ich meine Arbeit? Wichtig ist auch Verständnis für Technik und Physik.
Aufgang: Offenheit ist ein Aspekt dafür, sich verändern zu können. Viele Menschen haben Angst vor Veränderung. Hängen Offenheit und Angst indirekt zusammen? Kennen Sie Lebensangst?
Lanzl: Nein. Ich kann mich auch nicht erinnern, in der Kindheit Angst gehabt zu haben. Vielleicht waren hier Verhaltensweisen meiner Eltern maßgebend, die uns Kindern gesagt haben: Probiert doch etwas aus! Dieses Experimentieren-Dürfen wurde vom Elternhaus gefördert.
Aufgang: Und es scheint ein wichtiger Faktor für ein gesundes menschliches Wachstum zu sein.
Lanzl: Dazu kommt die Erlaubnis, auch Fehler machen zu dürfen.
Aufgang: So kommen Sie in der Führungsposition dahin zu sagen, ich kann mir Fehler eingestehen und korrigieren.
Lanzl: Wenn ich den Anspruch hätte, nie Fehler machen zu dürfen, wäre ich blockiert und damit handlungsunfähig. Mittlerweile hat sich in vielen Management-Schulen diese Haltung durchgesetzt: Verschleiere die Fehler nicht! Fehler zu verschleiern kostet sehr viel Geld. Fehler zu machen ist menschlich.
Aufgang: Sie haben noch einmal die Firma gewechselt und arbeiten als Global Marketing Direktorin wieder in München. Welche Aufgabe haben Sie jetzt?
Lanzl: Ich bin bei einem amerikanischen Unternehmen für das weltweite Marketing einer Division verantwortlich. Diese Division hat ihren Hauptsitz in Deutschland und stellt Komponenten her, die in der Labor-, Medizin- und Umwelttechnik eingesetzt werden.
Aufgang: Sie müssen eine Gruppe von Menschen führen. Wie viele Leute sind das?
Lanzl: Das sind im Moment fünfzehn, vier davon in USA, zwei in China, der Rest ist hier in München.
Aufgang: Dann fliegen Sie öfters nach USA und China?
Lanzl: Gott sei Dank ersparen Internet-Konferenzen heute viele der anstrengenden Flüge. Man muss sich natürlich auch persönlich treffen, damit man adäquat führen kann. Der menschliche Aspekt ist sehr wichtig.
Aufgang: Was würden Sie jetzt angesichts Ihrer langen beruflichen Erfahrung zum Thema Wachstum sagen? Was bedeutet für Sie ein gutes persönliches Wachstum?
Lanzl: Ich glaube, es ist wichtig, sich immer persönlich und fachlich zur eigenen Zufriedenheit hin zu entwickeln.
Aufgang: Eine sehr philosophische Antwort. Und was gehört für Sie zu einem guten ökonomischen Wachstum? Kann man es unabhängig vom Faktor Mensch sehen oder muss der Mensch in Analyse und Reflexion immer mit einbezogen werden?
Lanzl: Das ökonomische Wachstum hat nur dann Bestand, wenn der Mensch einbezogen wird. Es kann zwar kurzfristig auch einmal unabhängig vom Menschen wachsen, aber daraus ergeben sich für mich die sogenannten „bubbles“. Irgendwann bricht eine vom Menschen unabhängige Wachstumsentwicklung ein. Wachstum wird vom Menschen erzeugt. In der Thermodynamik habe ich physikalische Grundregeln kennengelernt, die nach meiner Meinung weit über die Physik hinaus gelten. Eine davon ist: Jedes System strebt zum Gleichgewicht. Wenn ich ein System habe, das ein tolles ökonomisches Wachstum zeigt, aber die Menschen nicht mitnimmt, dann befindet sich das System im Ungleichgewicht. Dieser Zustand ist instabil und wird sich früher oder später ändern. Im schlimmsten Fall mit Gewalt. Eine weitere Regel aus der Thermodynamik lautet: Wenn man Wachstumsfortschritt möchte, muss man Energie in das entsprechende System stecken.
Aufgang: Frau Lanzl, ich bedanke mich für dieses wunderbare, aus meiner Sicht sehr philosophische Gespräch.
1Das Gespräch mit Frau Dr. Ingrid Lanzl führte der Schriftleiter von Aufgang, Dr. Rüdiger Haas.