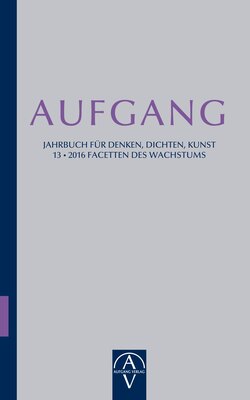Читать книгу Aufgang. Jahrbuch für Denken, Dichten, Kunst - Heinrich Beck Barbara Bräutigam Christian Dries Silja Graupe Anna Grear Klaus Haack Rüdiger Haas Micha - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Hauptthema: Facetten des Wachstums Rüdiger Haas ALDI und das Phänomen des Unpersönlichen
ОглавлениеEine Betrachtung über die Wurzeln des Wachstums
Im Jahr 1946 übernahmen Karl und Theo Albrecht die Leitung des elterlichen Lebensmittelgeschäfts in Essen und eröffneten zwei Jahre später ihre erste Filiale in der Schonnebecker Saatbruchstraße. Nach weiteren zwei Jahren gab es 13 Albrecht-Filialen, sieben Jahre später bereits 30; ein zentraler Verwaltungsbau musste errichtet werden. 1955 waren es 100 Filialen, 1959 hatten die Albrechts 300 Geschäfte mit 90 Millionen DM Umsatz. Es folgte eine kurze Wachstumskrise und die Umstellung auf Selbstbedienung. 1970 hatte ALDI 600 Filialen mit einer Milliarde DM Umsatz und 1975 etwa 1000 Läden mit einem Umsatz von 6 Milliarden DM. Geschäftsniederlassungen gab es zu dieser Zeit in den Niederlanden, den USA, in Dänemark und Österreich. 1985 erwirtschafteten 2000 ALDI-Läden 17 Milliarden DM. Die Brüder wurden 1996 – 50 Jahre nach Übernahme des elterlichen Geschäfts – als reichste Deutsche eingestuft und belegten 2002 Platz drei der Welt-Milliardäre. Erst im Jahr 2003 war das Ende des ALDI-Wachstums in Deutschland erreicht, die Discounter-Konkurrenz ließ die Zahl der Läden stagnieren.1 Worin gründen das Geheimnis dieses schnellen Wachstums und der Erfolg von Karl und Theo Albrecht?
Daten und Informationen über Betriebsinterna von Aldi zu bekommen, war seit jeher schwer; denn ein betriebliches Strukturmerkmal der Albrechts ist (nach wie vor) die konsequente Abschottung des Unternehmens nach außen. Mitarbeiter wurden zu rigorosem Schweigen verpflichtet; Karl und Theo mieden die Öffentlichkeit bis zuletzt. Als Karl endlich zu einem Gespräch über sein Unternehmen bereit war, starb er 94-jährig.2 So sind wir beim Versuch unserer Interpretation über den Erfolg des Konzerns auf Sekundärquellen angewiesen. Dieter Brandes hat 1998 ein Buch veröffentlicht, das den Betrieb in seiner Erfolgsgeschichte von innen her ausleuchtet. Als langjähriger Geschäftsführer und seit 1975 Mitglied des Verwaltungsrates weist er darauf hin, dass der ALDI-Erfolg auch mit der ethischen Einstellung des Unternehmens zusammenhänge. ALDI sei in vielen Punkten ein „moralisches Unternehmen“.3 Er vertritt den Standpunkt, Geldverdienen an sich sei nichts Unmoralisches (pecunia non olet). Insofern lebten mit der Strukturbeschreibung des ALDI-Konzerns alte Tugenden wieder auf.
Eine der wenigen öffentlichen Beschreibungen des ALDI-Systems stammt aus einem Vortrag von 1953. Karl Albrecht betont darin die zwei wichtigsten Grundsätze des Unternehmens: das kleine Warensortiment und der niedrige Verkaufspreis. Auch mit einem kleinen Sortiment sei ein gutes Geschäft zu machen, weil damit die Unkosten des Betriebs sehr niedrig gehalten werden können. Bei der Kalkulation interessiere nur, wie billig eine Ware verkauft werden kann. Die Intention eines möglichst hohen Verkaufspreises wäre ökonomisch falsch und sei deswegen kein Management-Ziel. Beide Grundsätze seien nicht voneinander zu trennen. Eine Umsatzsteigerung ergebe sich dann, wenn die Werbung stark eingeschränkt ist und die Grundsätze strikt eingehalten werden. Theken und Regale sind einfach konstruiert, auf Dekorationen wird verzichtet. Das Warensortiment umfasste in der Anfangszeit 250 bis 280 Artikel und wurde bei ständiger Kontrolle bewusst klein gehalten. Es werden keine Parallelartikel geführt und bestimmte Waren überhaupt nicht verkauft. Der Grund dafür liege im Ziel einer wachsenden Umsatz- und Verkaufsgeschwindigkeit. Das Verkaufsprogramm soll nur umschlagsfähige Konsumartikel führen. In der Anfangszeit wurde auf eine Vorverpackung generell verzichtet, weil diese oft wesentlich teurer war als die gesamten Personalkosten, was sich wiederum auf die Waren ausgewirkt hätte. Es wurde immer nur der Markenartikel geführt, der am besten geht. Weiter gab es feste Kalkulationssätze, die das ständige Rechnen vermieden. Ein wesentliches Ziel war, den Kunden davon dauerhaft zu überzeugen, nirgendwo billiger einkaufen zu können als bei ALDI. Werde dieses Ziel erreicht, nehme der Kunde alles dafür in Kauf.
Weil die aus der notwendigen Sparsamkeit entstandene Vermeidung von Verschwendung konsequent eingehalten wurde, avancierte ALDI 1980 zum erfolgreichsten Lebensmittel-Einzelhändler aller Zeiten. Bis in die Neunzigerjahre hat sich am Konzept des Unternehmens nichts geändert. Die landläufige Meinung vieler Analysten war, ALDI müsse sein Sortiment irgendwann ausdehnen und andere, bisher nicht praktizierte Prinzipien aufnehmen, um weiteres Wachstum erzeugen und so dem Wettbewerbsdruck standhalten zu können. Aber ALDI verfolgte die eigene Politik, die eigenen Grundsätze konsequent weiter. Die Artikelzahl wurde im Wesentlichen nicht erhöht, obwohl nach Erreichen einer bestimmten Umsatzgröße auch Non-Food-Aktionsartikel und Obst- und Gemüseartikel in das Sortiment aufgenommen wurden. Der Erfolg des Unternehmens ist nach wie vor ungebrochen.
1. Das ALDI-Konzept
Der heute inflationär verwendete Begriff „Unternehmensphilosophie“ ist bei ALDI nicht vorhanden. Das Unternehmen passte sich zwar schrittweise an die Bedingungen des Wettbewerbs und die Märkte an, die dahinterstehende Strategie war aber eher intuitiv geleitet, das praktische Handeln durch wachsende Reflexion kontrolliert. Nach dem ersten Jahrzehnt schien sogar alles auf einen Zusammenbruch hinzusteuern, als 1959 die aufkommenden Selbstbedienungsmärkte die Preise von Albrechts Tante-Emma-Läden unterboten. Aus der Not musste ein neues Geschäftsmodell entwickelt werden. Die Albrechts stellten auf Selbstbedienungsläden unter dem Namen „Alio“ um, die aber mit roten Zahlen floppten. Das Unternehmen stagnierte im Jahr des Mauerbaus 1961, der Unternehmenskurs war desorientiert, der Erfolg gefährdet. In dieser Krisenzeit teilte sich das Unternehmen in ALDI Nord und ALDI Süd, ein wichtiger Schachzug, der dem Konzern weiteres Wachstum bringen sollte.4 Zur selben Zeit teilte sich Deutschland in Ost und West.
ALDI hatte nie ein ausgeklügeltes Geschäftskonzept entwickelt, sondern hielt sich an einige wichtige Grund-Prinzipien: Askese, Bescheidenheit, Detailarbeit und strenge Konsequenz.5 Diese vier für wirtschaftliche Analysen wenig aussagekräftigen Faktoren entstammen nicht so sehr dem rein ökonomisch ausgerichteten Denken, als vielmehr einer menschlich orientierten Lebenseinstellung. Sie zielt auf den Erfolg der Gemeinschaft, hier der Kundenklientel. Aus dem Gelingen des Sinnganzen kann auch individueller Erfolg hervorgehen. Die vier Prinzipien offenbaren ein Geschäftsbewusstsein, das zwar den eigenen Erfolg anstrebt, diesen aber nur durch den Erfolg des Gemeinwohls garantiert sieht. Eine solche Grundhaltung ist deshalb nicht „unternehmensphilosophisch“ abgegrenzt, sondern überschreitet die Grenzen partikularer Unternehmenspolitik; sie gründet in einer ethischen Einstellung. Es ist ein besonderes Verdienst von Dieter Brandes, diese vier Grundprinzipien herausgestellt zu haben, denn sie laufen für die meisten Menschen unbewusst und meist selbstverständlich, d.h. unerkannt ab. Wenn diese Eigenschaften analysiert werden, bewegen wir uns auf geisteswissenschaftlichem Gebiet, denn hier wird etwas ins Bewusstsein gehoben, das dem Menschen als Menschen eine besondere Stellung verleiht. Askese, Bescheidenheit, Detailarbeit und strikte Konsequenz sind als ethische Qualitäten schon im Altertum bekannt. Hier war der Grundsatz noch selbstverständlich, der besagte, nur in einem Staat, in dem es weder Armut noch Reichtum gebe, können sich die edelsten Sitten entwickeln.6 Von solchen Einsichten sind wir heute weit entfernt. Blickt man auf die Realität, müssen wir uns eingestehen, dass das Gegenteil in unserer globalisierten Gesellschaft gerade Gestalt annimmt.7 Ein unternehmerischer Erfolg, der sich ökonomisch ausweist, liegt aber primär im Vollzug allgemeinmenschlicher – und insofern nicht bloß ökonomischer – Qualitäten begründet. Was den Brüdern möglicherweise nicht bewusst war, was sie aber praktizierten (der Umfang wird noch zu untersuchen sein), war der Vollzug bereits vorliegender alter ethischer Einsichten.
Auf der Grundlage dieser Prinzipien galten bei Aldi weitere Strukturen, wie das der Geheimhaltung und der konsequenten Dezentralisation. Mit der klugen Politik der Konstruktion einer Familienstiftung verhinderte man zudem die Zerlegung des Unternehmens durch gerichtliche Auseinandersetzungen.
2. Der ALDI-Unternehmens-Geist
Für den Erfolg wesensbestimmend sind die unsichtbaren Dinge, die ungeschriebenen Regeln des Unternehmens, die – bis auf eine Ausnahme in der Stellenbeschreibung8 – bei ALDI niemals festgehalten worden sind. Sie bestimmen als kulturelle Werte und Normen den Betrieb von innen her und steuern das Denken, die Gefühle und das Handeln der Mitglieder. Es komme darauf an, allen Mitgliedern Klarheit darüber zu verschaffen, was „gut“ und „nicht gut“, was „erlaubt“ und „nicht erlaubt“ sei und was „belohnt und bestraft“ werde.
Wichtig sei hier das Vorbild und Beispiel von Inhaber und Führungskräften, die solche Regeln bei Besprechungen immer wieder thematisierten. Es komme darauf an, dass der Appell an solche Regeln nicht nur mechanisch und unmotiviert geschehe, sondern mit Leidenschaft erfolge. Sei die Unternehmenskultur in sich stimmig, dann sei sie auch effizient; ein aufwendiges Koordinations- und Kontrollsystem könne entfallen. Die dezentrale Führung, die kurz und präzise formulierten Stellenbeschreibungen und das ausgeklügelte Kontrollsystem in Form von Stichproben trügen zur Qualitätssicherung bei. Innerhalb des Kontrollsystems spiele die „Kulturkontrolle“ eine wichtige Rolle. Hier werde geprüft, ob Vorgesetzte Werte wie Glaubwürdigkeit und Übereinstimmung von Reden und Handeln an ihre Mitarbeiter weitergäben. Handeln heiße bei ALDI immer auch Beispiel sein.
Wichtigstes Wesensmerkmal bei ALDI ist das Grundprinzip Askese. Am Anfang wurde z.B. auf Telefone verzichtet, die Pausenräume für das Personal waren mit einfachem, zweckmäßigem Mobiliar ausgestattet und die Firmenwagen nicht luxuriös. So fuhr der Verwaltungsrat die kleinste Ausführung der S-Klasse ohne Sonderausstattung. Hier spielt die Einstellung der Bescheidenheit9 eine Rolle, die wahrscheinlich die Erklärung für die Unterschiede in den Erfolgsbilanzen liefert.
Ein weiteres Grundprinzip ist das der Sparsamkeit. Extremes Kostenbewusstsein vermeidet unnötige Ausgaben auf allen Ebenen. Dies wird z.B. bei der Verwendung der Rückseite von bereits beschriebenem Papier umgesetzt, beim Ausschalten des Lichts, wenn ein Raum genügend hell ist, bei der Optimierung der Lux-Zahlen in den Läden oder bei der Verwendung optimaler Kartongrößen (Efficient Consumer response). Theo Albrechts Büro war einfach ausgestattet. Er fuhr bis zu seiner Entführung 1971 keine Luxuslimousine und hatte bis zu diesem Zeitpunkt auch keinen Fahrer.
Bescheidenheit und Sparsamkeit bedingen den freiwilligen Verzicht auf Luxus und Statussymbole, aber auch ein damit verbundenes menschliches Auftreten, das wiederum sparsame und bescheidene Führungskräfte rekrutiert, die diese Werte weitertragen. Deshalb wird von ihnen eine bestimmte Selbstdisziplin erwartet, die für die Umsetzung der Prinzipien Sparsamkeit, Zurückhaltung gegenüber der Öffentlichkeit und Fairness gegenüber anderen erfordern. Weil es nicht leicht ist, eine solche Lebensweise zu praktizieren, müsse der Führungsnachwuchs aus den eigenen Reihen kommen. Er werde beobachtet und müsse sich über mehrere Jahre hinweg in diesen Tugenden durch verschiedene Abteilungen hindurch beweisen. Ein zum Geschäftsführer Berufener müsse zunächst Filialleiter, dann Lagerleiter, Verkaufsleiter und Bezirksleiter gewesen sein, bevor er seine Verantwortung als Geschäftsführer oder gar Verwaltungsrat wahrnehmen könne. Schon bei der Einstellung werde also darauf geachtet, ob die Persönlichkeit eines Mitarbeiters entsprechende kulturelle Werte verkörpere, denn diese seien wichtiger als ein Harvard-Diplom oder einschlägige Erfahrungen bei McKinsey. Mitarbeiter werden also primär nach diesen kulturellen Persönlichkeitskriterien ausgewählt und eingestellt, erst in zweiter Linie nach ihrer Qualifikation.
Für den wirtschaftlichen Wachstumserfolg bei ALDI sind also psychosoziale, d.h. menschlich-geistige Werte von zentraler Bedeutung. Die Frage nach der Persönlichkeit des Mitarbeiters steht im Vordergrund. Kann ein Mitarbeiter die Werte der Grundprinzipien selbst leben und damit weitergeben? Welches Phänomen bedingt die Haltungen von Bescheidenheit und Sparsamkeit, Askese, Detailliebe und strikter Konsequenz? Dieter Brandes antwortet: „Das Unpersönliche ist durchaus Teil der ALDI-Kultur.“10 Was aber ist das Unpersönliche? Dies wird von Brandes nicht weiter thematisiert. Mit dem Begriff wird ganz selbstverständlich umgegangen, ohne ihn zu hinterfragen. Wir wollen versuchen, dieses Phänomen aufzuhellen.
3. Das Phänomen des Unpersönlichen
Die Klärung des Phänomens des Unpersönlichen erfolgt über die Öffnung des Menschen zu sich selbst. Der Schlüssel für ein tieferes Verständnis des Phänomens liegt in der Erhellung der Motive (inneren Beweggründe) des Menschen.
In der abendländischen Geschichte wird von Plato bis Heidegger immer wieder auf diese Erhellung hingewiesen. Vollendet liegt sie schon im 13. Jahrhundert bei Meister Eckhart vor, der zwischen dem „natürlichen“ und „göttlichen“ Menschen differenzierte.11 Richtiges Handeln erfolge nach Eckhart nicht allein im äußeren Tun, sondern in der richtigen inneren Einstellung dazu. Sie wird erreicht, indem der Mensch lernt, seinen ich-zentrierten Willen loszulassen, um vom göttlichen Willen geführt zu werden. Die Dynamik dieses Prozesses führt über eine geistige Umkehr hin zu einem übergeordneten (bei Eckhart „göttlichen“) Ganzen, von dem der Mensch geleitet und bestimmt wird.
Zu unterscheiden sind zwei Motivzusammenhänge, zum einen die Ausrichtung des Menschen auf seine ausschließlich ich-orientierten Bedürfnisse und zum anderen die Ausrichtung auf die Wirkkräfte eines über seine eigenen Bedürfnisse hinausgehenden Ganzen (eines Gemeinwesens, welcher Art auch immer). Beide Motivzusammenhänge sind gegenläufig, ergänzen sich aber gegenseitig. Sie konstituieren das Paradoxon Mensch. Diese gegenläufigen Bewegungen sind miteinander verbunden. Die eine Dynamik hat die Orientierung der Verengung, zieht den Menschen nach unten und begrenzt ihn in seinen Möglichkeiten, die andere hat die Orientierung der Weitung und Öffnung, befreit den Menschen aus der Verengung, zieht nach oben und will ihn zur vollendeten Wirklichkeit führen. Das Zusammenspiel beider Richtungen fördert den Wachstumsprozess des Menschen.
3.1 Die ich-orientierten Bedürfnisse
Das Kriterium für die Ausrichtung des Motivs auf ein ich-orientiertes Bedürfnis liegt nicht im sichtbaren Tun einer Sache, auch nicht im Erleben des Bedürfnisses an sich, sondern darin, wie stark das verengte, angstbesetzte Ich des Menschen am Erleben beteiligt ist. Beim Phänomen der Bedürfnisorientierung verstehen wir Menschen, deren Tun und Handeln zu stark auf die eigenen Bedürfnisse und Wertvorstellungen ausgerichtet sind. Beobachtungen solcher Art sind unbewusst oft von einer abwertenden Haltung begleitet. Grund dafür ist, dass sich hinter der Maske der Bedürfnisorientierung oft eine egoistische Haltung verbirgt, die der Beobachtende als negativ empfindet. Die negative Reaktion erfolgt aufgrund einer unbewussten Nicht-Akzeptanz dieser Haltung. Doch es ist nicht das Leben der Bedürfnisse, sondern die Orientierung des Menschen auf sich selbst, die ihn verengt und vereinzelt. Solange er diese negative Haltung nicht aufgibt, bleibt er primär in seinem verengenden Ich und sekundär in der Abhängigkeit seiner Bedürfnisse gefangen. Er urteilt über andere negativ und erkennt nicht, dass er seine eigene Lebenshaltung auf den anderen projiziert. Dadurch verdrängt er die eigene existenzielle Problematik, meint frei zu sein, ist es aber nicht. Im Gegenteil: Nach und nach wird er Sklave seiner Begierden und negativen Werthaltungen, obwohl er zunächst im Glauben lebt, mit der Erfüllung seiner Bedürfnisse glücklich und gut zu sein.
Ursache des Festhaltens an dieser verengenden Lebensform ist die Motivdynamik, die sich der Öffnung und Weitung des Menschen verschließt. Sie möchte Absicherung, führt zum Stillstand und verhindert geistiges Wachstum. Wir bezeichnen sie als das Ego des Menschen. Wird es nicht infrage gestellt, verfestigt es sich durch Wiederholung und Gewöhnung weiter und verwickelt den Menschen in seelisches Leid. Diese Ver-Wicklung ist die Gegenorientierung zu seiner geistigen Ent-Wicklung, die Reibungskraft, die bei der Selbstfindung zu überwinden ist. Je stärker der Mensch von seinem Ego geleitet wird, desto mehr wird er von seinen eigenen Bedürfnissen abhängig sein und in Negationen verfallen. Alles kreist dann nur um ihn und seine Welt, d.h. die ganze Welt und die anderen sollen für seine Bedürfnisse bereitstehen. Hier liegt die Wurzel der Macht verborgen, die in die Tyrannis führt, der Lebensform ohne jegliche Selbsterkenntnis.
Die Motivdynamik, die sich ausschließlich auf die Bedürfnisse des Egos hin ausrichtet, ist Antriebskraft in jedem Menschen. Meist werden wir von ihr unbewusst geleitet, ohne von ihr zu wissen. Beginnt sie aber im Wachstumsprozess zu wuchern, wird das Phänomen der Gier sichtbar.12 Der Mensch gerät aus seinem seelischen Gleichgewicht und wird mit den Abgründen des Lebens konfrontiert. Für die Erhellung des Unpersönlichen ist es wichtig, diese Dynamik bewusst zu machen, um aus ihrer Dominanz befreit werden zu können.
3.2 Die über die eigenen Bedürfnisse hinausgehende, auf ein Ganzes gerichtete Motivdynamik
Das Phänomen, einem Ganzen (Gemeinwesen) unter Zurückstellung eigener Bedürfnisse dienen zu können, zeigt, dass es phasenweise möglich ist, Arbeiten und Dienste nicht verengt ich-orientiert auszuführen.
Die Rückstellung eigener Bedürfnisse zugunsten des Engagements für andere Menschen oder einer transzendentalen Welt hat als Handlungsgrundlage das Motiv der Unter- und Einordnung des eigenen verengenden Ichs (Ego) im hierarchischen Prozess. Diese Handlungsweise zielt auf den Dienst am Ganzen, wenn der Mensch lernt, sein Ego schrittweise loszulassen, um sein Ich zu öffnen. Sie beschreibt den eigentlichen Freiheitsprozess des Menschen zu sich selbst. Er findet bei allen Zen-Künsten Anwendung, die auf die Erfahrung des ursprünglichen Wesens vorbereiten wollen. Wer sich diesem Prozess schon einmal unterzogen hat, weiß, dass er anstrengend ist, wie alles Lernen, das am Anfang steht. Beim Phänomen der Anstrengung geht es darum, das Ego zurückzustellen. Dieser schwierige Prozess wird auch als Annäherungsprozess an das Ziel der Selbstlosigkeit bezeichnet. Hier muss der Widerstand der gegenläufigen Dynamik der verengenden Ich-Orientierung immer wieder überwunden werden. Streng ist jemand, der bei der Durchführung seiner Arbeit bestimmte Tätigkeiten (seien sie „gut“ oder „schlecht“) konsequent bis zum Ende durchhält und sich von keiner anderen Person oder anderen Umständen ablenken lässt. Strenge erfordert Konzentration: ein Gerichtetsein auf das Wesentliche und Wichtige unter bewusster Vernachlässigung von Unwichtigem und Nebensächlichen. Es stößt in die Tiefe vor, wenn der Mensch sich über sein kleines Ego hinaus zum gegenläufigen Selbst-Befreiungsprozess öffnet.
3.3 Das Spektrum der unpersönlichen Einstellung
Von einer unpersönlichen Einstellung sprechen wir, wenn die Primärmotivation einer Handlung nicht auf die verengende Ich-Orientierung des Menschen ausgerichtet ist, sondern sich auf ein überindividuelles, fürsorgendes Ganzes richtet, dem der Mensch dienen kann.
Als Paradoxon ist der Mensch eine Mischung aus persönlichen und unpersönlichen Handlungsweisen. Dieser Spektrumsbereich reicht von der extremen Ich- und Bedürfnisorientierung bis zum vollkommen überdauernden unpersönlichen Leben. Unser Verhalten bewegt sich meist in einem Zwischenbereich, gemäß unserer Entwicklung auf je verschiedenen Entwicklungsstufen. Die Schwierigkeit besteht darin, auszumachen, wo wir im Spektrum individuell stehen, da sehr schwer zu erkennen ist, wann, wo und vor allem in welchem Ausprägungsgrad unser Ego am Tun unserer Handlungen beteiligt ist. Das in der Bhagavadgita richtig verstandene Nicht-Handeln meint kein Nicht-Handeln schlechthin (das es nie geben kann, da alles Leben immer Handeln ist), sondern ein Handeln ohne Ego-Beteiligung.
Die eigentliche unpersönliche Einstellung beginnt, wenn der Mensch eine relativ überdauernde, stabile positive, d.h. angstreduzierte Stimmung erreicht hat. Kennzeichen dieser Stimmung ist eine abgesenkte manifeste Angst, die aus einem vorherigen Zustand von relativ hoher manifester Angst hervorgeht. Der Hervorgang erfolgt über eine Transformationserfahrung, die der Mensch nicht willentlich erreichen kann. Sie ist Kern und Schlüssel für die Entwicklung der eigentlichen unpersönlichen Einstellung. Eine kleine Anekdote von Eugen Herrigel soll der Verdeutlichung dienen:
Yagyu Tajima-no-kami war ein großer Meister im Schwertkampf und unterwies den damaligen Shogun Tokugawa Jyemitsu in dieser Kunst. Einer der Leibwächter des Shogun kam eines Tages zu Tajima-no-kami und bat ihn um Unterricht im Fechten. Der Meister sprach: .Soviel ich sehe, scheint ihr selber ein Meisterfechter zu sein. Bitte, teilt mir mit, welcher Schule Ihr angehört, bevor wir in das Verhältnis von Lehrer und Schüler treten.ʻ Der Leibwächter sprach: ‚Zu meiner Beschämung muß ich bekennen, daß ich die Kunst nie erlernt habe.ʻ ‚Wollt Ihr mich verspotten? Ich bin der Lehrer des ehrwürdigen Shogun selber und weiß, mein Auge kann nicht trügen.ʻ ‚Es tut mir leid, wenn ich Eurer Ehre zu nahe trete, aber ich besitze wirklich keine Kenntnisse.ʻ Dieses entschiedene Bestreiten machte den Schwertmeister nachdenklich, und schließlich sagte er: ‚Wenn ihr es sagt, muß es so sein. Aber ganz sicher seid Ihr in irgendeinem Fache Meister, wenn ich auch nicht genau sehe, worin.ʻ ‚Ja, wenn Ihr darauf besteht, will ich Euch folgendes berichten. Es gibt ein Ding, in dem ich mich als vollkommenen Meister ausgeben darf. Als ich noch ein Knabe war, kam mir der Gedanke, als Samurai dürfe ich unter gar keinen Umständen mich vor dem Tode fürchten, und seither habe ich – es sind jetzt einige Jahre – mich fortwährend mit der Frage des Todes herumgeschlagen, und zuletzt hat diese Frage aufgehört, mich zu bekümmern. Ist es vielleicht dies, worauf ihr hinauswollt?ʻ ‚Genau diesʻ, rief Tajima-no-kami, ‚das ist’s, was ich meine. Es freut mich, daß mein Urteil mich nicht betrog. Denn das letzte Geheimnis der Schwertkunst liegt auch darin, vom Gedanken an den Tod erlöst zu sein. Ich habe viele Hunderte meiner Schüler im Hinblick auf dieses Ziel unterwiesen, aber bis jetzt hat keiner von ihnen den höchsten Grad der Schwertkunst erreicht. Ihr selber bedürft keiner technischen Übung mehr, Ihr seid bereits Meister.ʻ13
Das Beispiel bezeugt, dass die eigentliche unpersönliche Einstellung mit Furchtlosigkeit vor dem Tod verbunden ist. Sie ist selten und bedarf einer längeren geistigen Vorbereitungszeit. Der Grad in dieser Kunst wird nur von wenigen Schülern erreicht. Wird dem Menschen diese Stimmung offenbar, transformiert sich das Phänomen der Anstrengung in Gelassenheit. Ein solcher Gestaltwandel ist verbunden mit einer veränderten Art der menschlichen Wahrnehmung. Auf dieser Stufe handelt der Mensch nicht mehr auf dem Fundament subjektiver Neigungen, sondern aus einer überpersönlichen Kraftquelle, die ihm bei seinen Tätigkeiten eine andere Art der Freude vermittelt.
Beim Phänomen der Ego-Rückstellung ist die Anstrengung noch dominant. Während die eigentlich unpersönliche Einstellung sehr selten vorkommt, ist das Phänomen der phasenweisen Ego-Rückstellung relativ häufig. Wir treffen es an, wenn Menschen anderen Menschen – aktuell in der sogenannten Willkommenskultur – helfen, bei konzentrierten, genau durchgeführten Arbeitsprozessen, die sich Zeit für das Detail nehmen, bei der Ausübung von Ehrenämtern, bei denen nicht Zeit gespart, sondern geopfert wird, aber auch bei anderen Handlungen, bei denen Anstrengung und ein bestimmtes Maß an Selbstdisziplin verlangt werden, bei Handlungen, die ein gewisses Maß an Rückstellung von Eigennutz und Eigeninteresse beinhalten. Wird auf dieser Stufe unpersönlich gehandelt, ordnet sich der Mensch in einem zeitlich begrenzten Rahmen einer Sache unter, der er dient. Er schränkt während dieser Zeit eigene Bedürfnisse ein und stellt sein Ego hintan.
Das Phänomen der phasenweisen Ego-Rückstellung ist ein oft gefordertes Verhalten. Die Welt verlangt in vielen Situationen, unser Ego zurückzunehmen, um das Weltganze zu achten. Die Ethik der natürlichen Welt misst sich an solchen Handlungen, die nach außen hin als „uneigennützig“ gelten. Was „eigennützig“ und „uneigennützig“ ist, klärt die Frage: Wo ist das Ego an der Handlung beteiligt? Wo versteckt sich Eigennutz? Erst wenn der Mensch sein Motiv erkennt, gelangt er auf eine tiefere ethische Ebene. Oft sind die gutgemeinten Handlungen vom Antrieb des Egos manipuliert und bleiben in der persönlichen Handlungsdimension gefangen. Der Mensch im Widerspruch entspricht der ethischen Pflicht nach Vorgabe und kann zumeist nicht differenzieren, wo sein Ego an der Handlung beteiligt ist.
Es gibt aber noch eine dritte, untere Stufe im Spektrum des Unpersönlichen, die mit dem Phänomen des Unpersönlichen scheinbar nichts mehr zu tun hat. Sie beschreibt die Entwicklung der reinen Egodimension, die Voraussetzung für die Entwicklung des Unpersönlichen ist. Erst in der Angsterfahrung, im Erleiden der Enge kann der Umschlag in die Befreiung des Menschen zu sich selbst erfolgen. Das Ego-Wachstum ist auf den Besitzmodus der Bedürfnisund Konsumorientierung ausgerichtet. Diese Dimension findet ihren Sinn im Zusammenbruch des Menschen, aus dem eine andere Dynamik hervorgehen kann. Deshalb ist das Ego-Wachstum notwendige Voraussetzung14 für eine spätere Transformation. Denn einem Ego kann nur Einhalt geboten werden, wenn es Stärke besitzt. Ohne ein sich hartnäckig behauptendes Ego gibt es keine echte menschliche Transformation. Deswegen ist auch diese untere Stufe des Spektrums der Motivdynamik vom Entwicklungs- und Wachstumsprozess her betrachtet nicht nur durch und durch positiv zu sehen, sondern auch als not-wendig zu akzeptieren.
3. Inwieweit ist der ALDI-Unternehmensgeist unpersönlich?
Rufen wir uns Dieter Brandes’ Feststellung noch einmal ins Gedächtnis: „Das Unpersönliche ist durchaus Teil der ALDI-Kultur.“ Nach dem bisher Betrachteten kann man Brandes nicht widersprechen, obwohl sein Urteil – differenziert betrachtet – sehr mit Vorsicht zu genießen ist. Die entscheidende Frage ist nämlich: Wo ist der ALDI-Unternehmens-Geist im Spektrum des Unpersönlichen anzusiedeln?
Wir erinnern uns, dass bei ALDI darauf geachtet werde, dass Mitarbeiter Persönlichkeitskriterien wie Verschwiegenheit, Sparsamkeit, Askese, Detailliebe, Konsequenz oder Selbstdisziplin erfüllen sollten, da für einen wirtschaftlichen Wachstumserfolg psychosoziale Werte von zentraler Bedeutung seien. Wir prüfen diese Vorgaben anhand der Recherchen von Martin Kuhna und der kritischen Ausführungen des ALDI-Managers Eberhard Fedtke. Unter dem Thema „Charakterfragen“ beschreibt Kuhna die herausragenden Wesenszüge der beiden Brüder – Sparsamkeit, Uneitelkeit, Bedürfnislosigkeit, Scheue und Verschwiegenheit – in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit.
Fedtke betont, die öffentliche Zurückhaltung sei im Blick auf die Konkurrenz eine sinnvolle Strategie, nennt dieses Phänomen aber provokant „ALDI-Burka“ und unterstellt den Albrechts, sie „hätten sich ihrer regionalen Geschäftsführer ‚bedientʻ, um das Publizitätsgesetz zu umgehen. Er sieht sogar einen leichtfertigen Umgang mit dem Gesetz an der Grenze zur Sittenwidrigkeit. Für ihre höherwertige Tätigkeit werde den Geschäftsführern auch nicht mehr Geld bezahlt.15 Richtet sich das Motiv des Verschweigens nur auf die Konkurrenz- und Wettbewerbsfähigkeit, ist es kein eigentlich unpersönliches, sondern ein auf sich selbst gerichtetes.
Auch sei das Harzburger Modell der Kompetenz- und Aufgabendelegation in Wirklichkeit ein frei über allem schwebendes, zentrales Machtorgan, in dem der Verwaltungsrat von oben nach unten regiere und der Geschäftsführer nur der verlängerte Arm des Verwaltungsrates sei. Weil Erfolg recht gebe, sei es zwar legitim, Milliarden mit einem autoritären Unternehmenskonzept anzuhäufen. Peinlich sei aber der Selbstbetrug durch Vorgabe des Harzburger Modells. Gibt sich das Motiv der Kompetenz- und Aufgabendelegation nach unten nur den Anschein der Machtabgabe, ist es kein eigentlich unpersönliches, sondern ein auf sich selbst gerichtetes.
Nicht bestritten wird das Merkmal der Sparsamkeit, wenngleich die Grenze zum Geiz betont wird. Die Albrechts trugen dazu bei, dass sich auch ärmere Leute genügend Lebensmittel leisten können. Durch ihre Strategie lernten die Deutschen, Lebensmittel müssen nicht teuer sein. Die Kehrseite der Medaille sei aber im Ursprung der Lebensmittel-Produktionskette angesiedelt. Bei Niedrigmilchpreisen gerieten Preise allgemein unter Druck und für die Milchbauern werde es immer schwerer, kostendeckend zu arbeiten.
Wenn Aldi Fleisch, Eier, Gemüse und Obst zu Kampfpreisen feilbietet, dann kann beides nur unter extrem industrialisierten Bedingungen produziert worden sein: Massentierhaltung mit allen Begleiterscheinungen, intensive Landwirtschaft, massiver Einsatz von Medikamenten, Dünger und Pestiziden. Eigentlich gefällt so etwas den Deutschen gar nicht, aber sie haben sich eben, nicht zuletzt durch die Albrecht’sche Sparsamkeit, daran gewöhnt, im europäischen Vergleich extrem wenig für ihr Essen auszugeben.16
Obwohl ALDI-Mitarbeiter zu jeder Zeit vorbildlich bezahlt wurden, sind die Personalkosten dort niedriger als anderswo, insbesondere bei ALDI Süd. In den 90er-Jahren und nach der Jahrtausendwende seien die Filialen häufig unterbesetzt gewesen, einzelne Mitarbeiter mussten ohne Lohnausgleich schneller oder länger arbeiten, zudem sei Druck auf Kranke ausgeübt worden, zur Arbeit zu erscheinen. Länger dienende Angestellte höherer Gehaltsklassen seien durch neue ersetzt worden, Vollzeitkräfte durch Teilzeitkräfte und Angestellte durch Azubis und Praktikanten, immer unter der Maßgabe, der Ersatz sei billiger als der Ersetzte. Der Kampf um die Stellen hinter dem Komma lasse ALDI zu einem rücksichtslosen Arbeitgeber werden. Geht das Motiv der Sparsamkeit in Form von Dumpingpreisen zulasten der Umwelt, der Tiere und Landwirte, ist es kein eigentlich unpersönliches, sondern ein auf sich selbst gerichtetes.
Auch beim Wertkriterium der Bedürfnislosigkeit stellten sich Zweifel ein. So sollen die Brüder in späterem Alter golfsüchtig geworden sein und sich deshalb häufig im exklusiven Essener Haus Oefte getroffen haben. Karl baute in Donaueschingen sogar ein Hotel mit Golfplatz und nebenan sein – zwar unauffälliges – Haus. Theo Albrecht sei ein Milliardär von trauriger Gestalt gewesen, der sich bis auf die täglichen Kaffeeproben selten über etwas freuen konnte. Dabei sei die Freudlosigkeit keineswegs die Folge seines katholischen Arbeitsethos’ gewesen, sondern eher einer protestantisch-puritanischen Weltsicht entsprungen, in der Fleiß und Genügsamkeit nicht der Befriedigung weltlicher Begierden dienen sollten. Die Albrechts hatten keine Yacht, keinen Privatjet oder exklusive Ferienhäuser. Ihre Genügsamkeit prägte das Unternehmen. Aber an ihrem Vorbild an Schlichtheit hatten sich auch die Mitarbeiter zu orientieren. Deren Lebensstil sollte ebenfalls ohne Extravaganzen und soziale Auffälligkeiten bleiben. Eigentlich ein schönes Motiv, aber für Kuhna grenzwertig, weil zwei Männer ihren Lebensstil zum Maßstab für ein ganzes Unternehmen machten. Wird das Motiv der individuellen Bedürfnislosigkeit zur verpflichtenden Vorschrift für eine ganze Gemeinschaft, ist es kein eigentlich unpersönliches, sondern ein auf sich selbst gerichtetes.
Nicht zuletzt wird auch das Phänomen des Menschlichen angesprochen. Den Brüdern wird bescheinigt, dass sie außerhalb der Familie nur wenig soziale Kontakte pflegten und kaum Freunde hatten. Für Karl gab es außer der Nähe zu seiner Frau nur menschliche Distanz. Bei aller Höflichkeit und Freundlichkeit waren beide Brüder „distanziert“. Es gab keine betrieblichen Veranstaltungen, keine Feste oder Feiern, Geschäftsführertreffen galten als qualvoll monoton, Diskussionen seien nur vorgetäuscht worden, in Wirklichkeit galt es, Vorgegebenes zu übernehmen. Gemeinsame Abendessen unterlagen bizarren Ritualen:
So wurde gemeinsamer Gesang typischer Volkslieder immer mit ‚Prost, prost, meine Herren, wir wollen uns einen verlötenʻ beschlossen, wobei im zweiten Durchgang immer an derselben Stelle gestoppt wurde. Wer weitersang, musste Strafe zahlen. Anschließend: Bettruhe. Das Essen war bescheiden, ‚verlötetʻ wurde gar nichts, und Theo Albrecht hatte sich meist zu Beginn des Gesangs verabschiedet.17
Ein Ex-ALDI-Manager kommt 2012 zu dem Urteil, ALDI sei letztlich ein System, das versuche, frei von Menschen zu sein. Es bezahle gut, aber damit sei gleichzeitig auch der menschliche Faktor abgegolten. Der ALDI-Kritiker Straub bezeichnete das Unternehmen gar als „gnadenloses System“.
Wie es anders als bei den Albrechts gehen könnte, zeigt Kuhna am Beispiel des Schuhkönigs Horst Deichmann, der nach der Aushilfe im elterlichen Geschäft Medizin studierte und bis 1956 als Arzt arbeitete. Auch er entwickelte eine Filialkette, machte Milliardenumsätze und expandierte ins Ausland. Doch er erhob die Sparsamkeit nicht zum persönlichen Markenzeichen, sondern legte Wert darauf, dass das Denken grundsätzlich über ein Renditedenken hinausgehen und Geld einem guten Zweck dienen müsse. Ein Unternehmen solle den Menschen, den Kunden, den Mitarbeitern und der Gesellschaft dienen. Deichmann bezahlte überdurchschnittliche Löhne, bot sichere Arbeitsplätze und ein gutes Betriebsklima. „Auf Kritik an der Schuhproduktion in Entwicklungsländern reagierte Deichmann sensibel und verwies auf aktive Bemühungen um faire Arbeitsbedingungen. Seit 1977 betrieb Deichmann ein Hilfswerk zur Verbesserung von Bildung, medizinischer Versorgung und Infrastruktur in Indien und Afrika.“18 Er war indischer Honorarkonsul, trat als großzügiger Förderer kultureller, schulischer und medizinischer Projekte in Erscheinung, hatte Charme und war bescheiden, aber nicht knausrig.
Bei der Frage, wo der ALDI-Unternehmens-Geist im Spektrum des Unpersönlichen anzusiedeln sei, müssen wir unser anfängliches Urteil der Albrecht’schen Tugendhaftigkeit relativieren. Die ethischen Intentionen gehen weit, aber vielleicht nicht weit genug. Am Ende wird deutlich, dass auch Tugenden wie Askese, Sparsamkeit, Bescheidenheit, Detailliebe und Konsequenz nicht unbedingt mit einer egoüberschreitenden Motivdynamik zusammengehen müssen. Möglicherweise ist auch hier die Angst im Spiel, einmal erreichten Besitz wieder verlieren zu können. Angst vor der wiederkehrenden Enge der Nachkriegszeit? Verschwiegenheit als Angstmotiv, im Wettbewerb von anderen ausgebootet zu werden? Wie dem auch sei, die wahre Motivdynamik konnten die Brüder nur in sich selbst erkennen. Jeder Blick von außen, jedes an bestimmten Verhaltensweisen gefällte Urteil, kann die tieferen Motive des anderen – wenn überhaupt – nur bedingt erreichen. Es gelingt treffend, wenn der Urteilende selbst einen Meistergrad im Urteilen erreicht hat. Dies aber ist, wie wir gesehen haben, sehr selten.
So meinen wir: Das Unpersönliche ist ein Teil der ALDI-Kultur, aber es ist kein eigentlich Unpersönliches. Natürlich ist ALDI auch kein nur auf den eigenen Profit hin ausgerichtetes Unternehmen, sondern hat den Menschen in der Gesellschaft im Blick, vielleicht nicht so congenial wie Deichmann, was auch mit dem Bildungsstand der Brüder zu tun haben mag. Wie dem auch sei, sie verliefen sich, obwohl in redlicher Absicht, immer wieder in den Fängen des Egos. So siedeln wir den ALDI-Unternehmensgeist irgendwo in der Mitte des Spektrums des Unpersönlichen an. Denn gemäß der Heisenberg’schen Erkenntnis lässt sich der Ort nicht genau bestimmen, wenn Impulsmessungen präzise festgehalten werden. Und da wir die Impulse der ALDI-Kultur sehr genau nachgezeichnet haben, entzieht sich uns der Ort des unpersönlichen Geschehens zwangsläufig. Dieses Gesetz scheint insbesondere für ALDI zu gelten, einem Phänomen, das sich der Öffentlichkeit nur sehr widerwillig zu zeigen wagt.
1Martin KUHNA, Die Albrechts. Auf den Spuren der ALDI-Unternehmer. München 2015. Vgl. 179ff.
2 Ebd., 79: „… sie werden voraussichtlich bis an ihr Lebensende schweigen und schweigen lassen.“
3Dieter BRANDES, Konsequent einfach. Die ALDI-Erfogsstory. Frankfurt/a.M. 1998, 14. Martin Kuhna (a.a.O., 57) sieht die Darstellung von Dieter Brandes allerdings „extrem wohlwollend“, an einer anderen Stelle auch „verklärend“ (95). Er vergleicht die Beschreibungen der Ex-ALDI-Manager Dieter Brandes und Eberhard Fedtke (ALDI Geschichten. Ein Gesellschafter erinnert sich. Herne 2012), die den Konzern von innen kennen, einschlägige Erfahrungen besitzen, aber zu sehr unterschiedlichen Beurteilungen kommen. Während Brandes ALDI sehr zugetan ist, bringt Fedtke auch Kritik am Unternehmen. Wir folgen zunächst Brandes, weil dessen Sichtweise eine philosophisch-ethische Dimension öffnet. Später werden wir sehen, inwieweit diese Dimension bei ALDI der Realität standhält.
4 Martin KUHNA, a.a.O., vgl. 55ff. Kuhna bezweifelt die Meinung von Brandes, die Teilung als wichtigste Dezentralisation des Unternehmens sei damals Konzept-Punkt gewesen und meint, die Brüder hätten es wegen ihrer unterschiedlichen Geschäftsauffassungen miteinander einfach nicht mehr ausgehalten.
5 Dieter BRANDES, a.a.O., vgl. 24. Martin Kuhna urteilt etwas vorsichtiger: „bedürfnislos bis an die Grenze der Askese“.
6 PLATO, Die Gesetze. Vgl. III. Buch, 678E-679C. Dort heißt es: „In einer Gesellschaft aber, bei der es weder Reichtum noch Armut gibt, dürften sich wohl auch die edelsten Sitten entwickeln; denn weder Überheblichkeit noch Ungerechtigkeit, weder Eifersucht noch auch Neid kommen in ihr auf.“
7 Vgl. dazu den Artikel von Alexander HAGELÜKEN, Ungleichheit schadet der Wirtschaft. In: SZ vom 22.05.2015. Hagelüken zeigt anhand einer neueren Studie der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), dass die Ungleichheit in den meisten Industriestaaten rasant zugenommen habe. Der Unterschied zwischen Arm und Reich sei in der westlichen Welt so groß wie in 30 Jahren nicht. Immerhin werde jetzt von den Vordenkern mit der vorherrschenden Meinung aufgeräumt, Ungleichheit fördere das Wachstum: „Provozierend neu ist, dass die OECD an einer ökonomischen Theorie rüttelt. Bisher wird oft behauptet, dass ein gewisses Maß an Ungleichheit gut für eine Gesellschaft ist: Sie gebe den Ärmeren den Anreiz, sich hochzuarbeiten und sich um bessere Bildung zu kümmern. Die empirischen Belege für oder gegen diese These sind nicht eindeutig. Nun versucht die OECD nachzuweisen, dass es ganz anders ist: Demnach vergrößert eine zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich das Wirtschaftswachstum nicht – sie reduziert es.“
8 Dieter BRANDES, a.a.O., vgl. 48. In der Stellenbeschreibung heißt es: „Der Vorsprung vor der Konkurrenz ist durch extreme Anwendung des Wirtschaftlichkeitsprinzips zu sichern.“
9 David GODMAN, Leben nach den Worten Sri Ramana Maharshis. Die spirituelle Biographie des Sri Annamalai Swami. Interlaken 1996, vgl. 195. Von Sri Raman Maharshi ist bekannt, dass er bis zuletzt ein Leben in Bescheidenheit geführt hat. Folgender Ausspruch wird von ihm bei der Begegnung mit seinem Schüler Sri Annamalai Swami überliefert, als der sich gerade ein bescheidenes Essen zubereitete: „‚Sehr gut!ʻ rief er aus. ‚Anspruchslos zu leben ist am bestenʻ.“ Verkannt werden Platos Philosophenkönige übrigens immer wieder darin, dass sie nur als autoritär gelten. Entscheidend ist an ihrer Autorität aber, dass sie gelernt haben, ihre Bedürfnisse zu minimieren, also gelernt haben, anspruchslos zu leben.
10 Dieter BRANDES, a.a.O., 58.
11 Rüdiger HAAS, Über das Wesen des Todes. Eine tiefenphänomenologische Betrachtung konkret dargestellt am dichterischen Werk Hermann Hesses. Würzburg 1998, vgl. 108ff.
12 Vgl. dazu José SÁNCHEZ DE MURILLO, Über Spiritualität – tiefenphänomenologisch. In: AUFGANG, Bd. 12, 2015, 22ff. Sánchez de Murillo thematisiert die sich verschließende, ichorientierte Motivdynamik als die Abgründe des Menschen, deren Erscheinung in der tiefenphänomenologischen Gier als blinder Urkraft zum Ausdruck kommt. Sie tritt in vielfältiger Verkleidungsform immer unter einem „Zu viel an“ auf und führt den Menschen bei kontinuierlichem Wachstum in die Selbstzerstörung.
13 Eugen HERRIGEL, Zen in der Kunst des Bogenschießens, München 1984, 91ff.
14 Die Bedeutung des Wortes Notwendigkeit offenbart sich von sich selbst her. Aus einer entstandenen Notsituation und damit verbundenem Leid hat ein Bewusstsein die Möglichkeit zu einer Wende in seiner Befindlichkeit zu gelangen. Wird diese Wende Wirklichkeit, verwandelt sich Furcht in Furchtlosigkeit, Angst in Freiheit.
15 Martin KUHNA, a.a.O., vgl. 97.
16 Martin KUHNA, a.a.O., 103ff. Erich Reimann schrieb dazu am 8.5.2015 in der SZ unter dem Titel „Tierschützer kritisieren sinkende Milchpreise“, dass durch die von ALDI initiierte Senkung der Preise für einige Milchprodukte um mehr als 10 Prozent bei Umweltschützern und Bauern auf heftige Kritik stieß. Der Deutsche Tierschutzverband monierte, dass dies zulasten der Tiere und Landwirte gehe und die von einer Mehrheit der Gesellschaft geforderten höheren Tierschutzstandards mit solchen Dumpingpreisen nicht möglich seien.
17 Martin KUHNA, a.a.O.,113.
18 Ebd., 118.