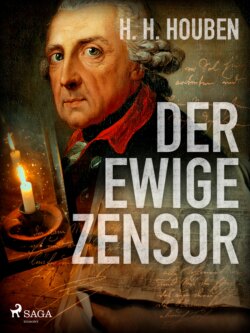Читать книгу Der ewige Zensor - Heinrich Hubert Houben - Страница 5
2. Eine kaiserin der zensur.
ОглавлениеDie Kaiserin Maria Theresia (1717—1780) war bekanntlich eine heftige Feindin aller religiösen Aufklärung und verfolgte mit harter Unduldsamkeit alles, was Macht und Ansehen der katholischen Kirche und ihrer Diener verletzen konnte. Mit „Inquisition und Mission“ führte sie die Gegenreformation in den österreichischen Erblanden durch, und die Pflege der kulturellen Güter sah sie am liebsten ausschließlich in der Hand der Jesuiten.
Die wirksamste Waffe in der Hand des Protestantismus war das Buch; ihm galt deshalb der glühende Haß der geistlichen Machthaber. Seit 1623 war die Wiener Universität unter Verwaltung der Jesuiten; ihnen lag auch fast die gesamte Bücherzensur ob, ohne deren Genehmigung in Österreich nichts gedruckt und kein fremdes Buch verbreitet werden durfte. Gegen die katholische Kirche und ihre Vertreter durfte infolgedessen nichts, gegen die Ketzer alles geschrieben werden. Wegen Übersetzung einiger antikatholischen Streitschriften wurde der evangelische Prediger Mathias Bohil, erzählt ein Biograph des Kaisers Joseph II., eingekerkert, und er entging nur durch die Flucht schlimmerem Schicksal; man fand aber nichts darin, daß der Bischof Martin Bird in seinem „Enchiridion“ die Ausrottung der Ketzer predigte; erst der Papst selbst mußte eingreifen, um dieses Buch zu unterdrücken. Wissenschaftliche Werke hatten keinen Anspruch auf mildere Behandlung. Noch im Jahre 1750, versichert der Reformator des österreichischen Schrifttums, Joseph von Sonnenfels (der keineswegs für Preßfreiheit eintrat, sondern die Zensur noch als „eine der notwendigen Polizeianstalten“ bezeichnete), konnte es Stand und Glück kosten, wenn man sich anmerken ließ, in Montesquieus „Esprit des lois“ geblättert zu haben. Die Verfasser protestantischer und antikatholischer Schriften erwartete Verbannung und Kerker. Schon der Besitz lutherischer, ketzerischer, überhaupt unkatholischer Schriften war aufs strengste verpönt; sie standen außerhalb allen Eigentumsrechtes; jeder Geistliche durfte sie konfiszieren, wo er sie fand, jeder Privatmann war bei Strafe verpflichtet, anzugeben, wo immer er sie gesehen hatte. Wer ein neues Buch kaufte, mußte es innerhalb der Zeit von vier Wochen seinem Pfarrer zur Prüfung und Genehmigung vorlegen, sonst erhielt er drei Gulden Strafe, die sich im Wiederholungsfall empfindlich steigerte. Ein Drittel des Strafgeldes fiel dem Denunzianten zu; daher stand die niederträchtigste Spionage in voller Blüte. Haussuchungen waren an der Tagesordnung. Das Gepäck der Reisenden wurde auf den Mautämtern an der Landesgrenze und in den Städten durchsucht, alle irgendwie bedenklichen Bücher wurden ihnen weggenommen, die verbotenen verbrannt. Verkleidete Beamte der geistlichen Bücherpolizei, sogar die Präsidenten der Zensurkommission, wie Graf Saurau in Wien, besuchten als harmlose Kunden die Buchläden, schlichen sich in das Vertrauen der Händler und drangen in sie, ihnen verbotene Bücher zu verschaffen; ließen die Buchhändler sich überreden, so entdeckten sich die Spitzel als Polizisten, beschlagnahmten die Werke und denunzierten die Verkäufer.
Die Kaiserin ärgerte sich wohl gelegentlich, wenn einer der Hoftheologen und Beichtväter seine Bücherrazzia bis in den kaiserlichen Palast ausdehnte, und jagte den allzu Dreisten davon; auch hob sie wohl einmal das Verbot eines Buches des von ihr geschätzten oder — gefürchteten Göttinger Publizisten und Geschichtsschreibers von Schlözer auf, wenn sie selbst es gelesen und gut gefunden hatte. Aber für die Schmach der geistigen Knechtschaft, in der sie ihre Völker hielt, hatte sie keine Empfindung. Der beschränkte Untertanenverstand hatte das auf Treu und Glauben hinzunehmen, was ihm von einer über alle Zweifel erhabenen, von Jesuiten beherrschten Regierung als allein seligmachend verkündigt wurde. Die Absperrmaßregeln gegen die im Reich, besonders in Preußen, herrschende Cholera der Aufklärung waren großzügig organisiert — kein Wunder, daß Österreichs geistige Entwicklung um Jahrhunderte zurückblieb. An der schönen blauen Donau nahm man an dem Aufschwung des deutschen Schrifttums so wenig Anteil, daß man noch zur Zeit der großen Kaiserin diejenigen verlachte, die sich, statt des einheimischen Dialektes, der hochdeutschen Schriftsprache, des „lutherisch Deutsch“, bedienten. Noch im Jahre 1780 war, wie Lessings Freund Nicolai versichert, auf der Universität Innsbruck ein Werk wie Jöchers Gelehrten-Lexikon, das 1750/51 erschien, nicht einmal dem Namen nach bekannt, und ein hochverdienter Mann wie der schon erwähnte Sonnenfels bewarb sich bei der ihm sehr gewogenen Kaiserin vergeblich um ein Amt, weil er seiner hochdeutschen Aussprache wegen als Protestant und überhaupt als verdächtig galt. Wo jedoch keine religiösen Rücksichten bestimmend waren, bewies Maria Theresia auch in Zensurentscheidungen die unbestechliche Gerechtigkeit, die einen Teil ihres Regentenruhmes ausmacht. Als der Wiener Schriftsteller und Hofagent Joseph Rautenstrauch, der Verfasser eines viel gegebenen Lustspiels „Der Jurist und der Bauer“, ein Lebensbild der Monarchin herausgab, dessen literarischer Wert in keinem Verhältnis zu seiner prahlerischen Ankündigung stand, und ein Kritiker eine scharfe Satire dagegen losließ, hatte Rautenstrauch die Anmaßung, die Kaiserin um Verbot dieser Kritik zu bitten, erhielt aber die energische Abfertigung: „Der Rautenstrauch soll seine Händel mit jenen des Staates nicht vermengen. Sind die ihm gemachten Vorwürfe ungegründet, so zeige er es dem Publico und beschäme dadurch seinen Gegner als einen Verleumder“. In einem Punkte aber war auf die gepriesene Gerechtigkeit der Kaiserin doch kein Verlaß, das sollte eben jener Hofrat Sonnenfels erleben, als er sich in einer dringenden Zensurangelegenheit eines Tages bei ihr melden ließ. Ungemein lebhaft, wie die Kaiserin noch in ihren alten Tagen war, kam sie nach wenigen Minuten aus dem Spielzimmer, strich sich mit den Fingern Haube und Haar aus dem Gesicht, und heftig die Karten drehend fragte sie den Besucher:
„Nun, was ist’s denn? Sekieren sie Ihn schon wieder? Hat Er etwas gegen uns geschrieben? Das ist Ihm von Herzen verziehen. Ein echter Patriot muß wohl manchmal ungeduldig werden; ich weiß aber schon, wie Er’s meint. Oder gegen die Religion? Er ist ja kein Narr. Oder gegen die guten Sitten? Das glaube ich nicht; Er ist ja kein Saumagen. Aber wenn Er etwas gegen die Minister geschrieben hat, ja mein lieber Sonnenfels, dann muß Er sich selber heraushauen; da kann ich Ihm nicht helfen. Ich habe Ihn oft genug gewarnt.“
Damit machte die Kaiserin kehrt und eilte wieder an ihren Spieltisch zurück. —
So eifersüchtig Maria Theresia die Rechte der Kirche zu wahren bestrebt war, konnte sie es doch nicht verhindern, daß schon unter ihrer Regierung der Machtkampf zwischen Staat und Kirche entbrannte und mit einer Niederlage der letzteren endete. Ein wesentlicher Teil dieses Kampfes vollzog sich im Rahmen der Zensurgesetzgebung.
Bisher hatte der Protestantismus als der alleinige Hort aller Opposition, auch der politischen, gegolten; seine Bekämpfung durch die Kirche beseitigte auch das, was dem Staat gefährlich werden konnte. Deshalb ließ man die Diener der Kirche über den Geistesschatz der Nation schalten und walten. Jetzt aber dämmerte auch dem Hause Habsburg allmählich die Erkenntnis, daß die werdende absolute Souveränität bei der Kirche selbst auf Widerstand stieß, daß die beiderseitigen Vorteile sich nicht mehr in allen Punkten vereinigen ließen, und daß der Absolutismus, der das frühere Feudalsystem rücksichtslos verdrängte, der Kirche einen Teil ihrer Rechte streitig machen mußte, wenn er sich mit Erfolg durchsetzen sollte. Die politischen Ereignisse, besonders der verhängnisvolle Erbfolgekrieg, zeitigten eine ausgesprochen politische, staatsrechtliche Literatur, von der die Theologen nichts verstanden und deren mögliche Wirkung sie als Zensoren nicht beurteilen konnten, oft wohl auch mit Fleiß übersahen.
Aus solchen Gründen hatte schon Maria Theresias Vater, Kaiser Karl VI. (1711 bis 1740), nach dem Beispiel seines Vorgängers 1725 die Zensur politischer Schriften mit Einschluß der Zeitungen den Jesuiten der Universität entzogen und den Regierungsbehörden zugewiesen. Denselben Gründen konnte sich auch seine Nachfolgerin nicht verschließen. Nach anfänglicher Unsicherheit ließ Maria Theresia 1743 jene Verfügung bestehen: die Zensur der politischen Druckschriften blieb endgültig Sache der Regierung und ihrer Zensurpolizei.
Andere Hände sorgten dafür, daß sich das geistliche Netz bald noch weiter lockerte. 1745 wurde der Holländer Gerard van Swieten als Leibarzt der Kaiserin nach Wien berufen. Er war ein frommer Katholik, aber ein Gegner der Jesuiten und vor allem ein strenger Vertreter der Wissenschaft; ihm hat der geistige Aufschwung Österreichs unendlich viel zu verdanken. Auf seinem eigensten Gebiete gewann er schnell Raum, denn die praktische Kunst des Arztes war ja die einzige, die die Jesuiten nicht übten; er gewann berühmte Ärzte für Wien und wurde so Begründer der dortigen medizinischen Schule. Daß die Geistlichkeit anatomische Lehrbücher der unvermeidlichen „Nuditäten“ wegen verbot, hörte nun gänzlich auf. Bald aber dehnte Swieten seine Reformarbeit auf das ganze geistige Leben Österreichs aus und stieß nun überall auf die Schranke der geistlichen Zensur, die die wichtigsten Bildungsmittel der Öffentlichkeit vorenthielt. Unerschrocken nahm er den Kampf gegen sie auf. Der Übermut seiner Gegner selbst drückte ihm die siegreiche Waffe in die Hand; als die geistliche Behörde sich anmaßte, sogar den Reichshofrat ihrer Zensur zu unterstellen, setzte es van Swieten bei der Kaiserin durch, daß die Prüfung zunächst der philosophischen und historischen Werke der Universität abgenommen und besonderen Zensurkommissionen in Wien und in den Provinzen anvertraut wurde. Von 1753 an mußten auch alle zum Druck bestimmten Manuskripte der unterdes gebildeten Bücherzensur-Hofkommission in Wien und nicht mehr den Jesuiten der Universität vorgelegt werden, und die bisherige völlige Zensurfreiheit der geistlichen Orden für ihre eigenen theologischen und philosophischen Schriften wurde aufgehoben — eine gewaltige Kraftprobe van Swietens, die der späteren josephinischen Reform (1780—1786) mächtig vorarbeitete.
An die Spitze dieser Wiener Zensurkommission, die bisher ein Hofkavalier geleitet hatte, trat 1759 van Swieten selbst. Sie war jetzt eine rein staatliche Behörde, aber die Hälfte ihrer Mitglieder bestand noch aus Geistlichen; zwar wurden diese Kleriker nicht mehr vom Jesuitenorden, sondern von der Kaiserin gewählt, und seit 1764 war kein Jesuit mehr darunter, aber den unmittelbaren Einfluß des Ordens auf die fromme Fürstin konnte auch van Swieten nicht völlig ausschalten.
Auch konnte er sich auf seinem heftig angefochtenen Posten nur dadurch halten, daß er gegen alles, was der Religion, dem Staate, den Sitten und überhaupt der „guten Denkungsart“ gefährlich erschien, fast ebenso unduldsam vorging wie seine geistlichen Gegner, besonders nachdem er als Direktor der K. K. Bibliothek mit Hilfe seiner Unterbeamten auch die Zensur der periodischen Schriften und der schönen Literatur, der „materia mixta“, selbst zu überwachen hatte. Ihm lagen nur die „nützlichen Bücher“ der Fachwissenschaft wahrhaft am Herzen. Deshalb setzte er, den Jesuiten zum Trotz, 1753 die Freigabe von Montesquieus „Esprit des lois“ durch, und des Weihbischofs von Hontheim (Febronius) Buch über die rechtmäßige Gewalt der römischen Päpste wurde nach langjährigem, erbittertem Kampf wenigstens in den Händen der Gelehrten geduldet. Aber van Swieten selbst verbot zahlreiche Schriften von Rousseau und Voltaire, von Maupertuis und Lamettrie, Thomas Hobbes und Christian Thomasius, von Crébillon und Fielding, Boccaccio und Sterne, Swift und Holberg, den Macchiavell und Ariosts „Rime satire“, Grimmelshausens „Simplizissimus“ und „Vogelnest“ und Rollenhagens „Froschmäusler“, Philander von Sittewalds „Gesichte“ und Reuters „Schelmuffsky“ und von Erzeugnissen der neu aufblühenden deutschen Literatur Albrecht von Hallers „Kleine Schriften“ und Gedichte von Joh. Christ. Günther, Wielands „Idris“, „Agathon“ und „Sieg der Natur“ nebst seiner französischen Übersetzung, die Leipziger und Göttinger Musenalmanache, Mendelssohns „Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele“ und die beiden ersten Bände der Schriften Lessings von 1753. Im ersten Bande erregten die satirische Fabel „Der Eremit“ und das tiefsinnige Gedicht „Die Religion“ großen Anstoß, ferner die Epigramme „Turan“, „Auf die Thestylis“ und „Die Nachahmung des 84ten Sinngedichts im dritten Buche des Martials“; im zweiten Bande der siebente Brief über eine lateinische Schmähschrift des Lemnius gegen die Priesterehe, im besonderen gegen Luther, aus der Lessing einige derbe, nur lateinische, nicht etwa übersetzte Proben gegeben hatte. Einzig des „Eremiten“ wegen wurde auch später noch einmal ein Band Lessingscher Schriften in Österreich verboten. Gegen diese übertriebene Strenge van Swietens einzuschreiten war eine der ersten Regierungshandlungen des jungen Kaisers Joseph nach seiner Erhebung zum Mitregenten seiner Mutter (1765).
Van Swieten war auch der Begründer des österreichischen „Catalogus librorum prohibitorum“, des gedruckten Verzeichnisses verbotener Bücher, das zur schnelleren Unterrichtung der Behörden und Buchhändler und zur nachdrücklicheren Durchführung seiner Verbote von 1754 bis 1780 in immer wieder revidierten und bereicherten Neuausgaben im Druck erschien und alsbald ein — sehr gesuchter Führer durch die anrüchige Literatur wurde, der, wie der schon oben erwähnte Berliner Schriftsteller und Buchhändler Friedrich Nicolai mit Recht sagte, die schlechten Leute die schlechten und die klugen Leute die klugen Bücher erst kennen lehrte. So wurde die löbliche Zensurhofkommission selbst die Verfasserin des gefährlichsten aller Bücher, und es ist erstaunlich genug, daß sie erst 1777 zu dieser Erkenntnis kam und daraus den logischen Schluß zog: sie setzte den von Sammlern und Buchhändlern vielbegehrten Katalog selbst auf den Index; er war von da ab nur noch Beamten und „erga schedam“ (gegen schriftliche, nur persönlich bewilligte Erlaubnis) Gelehrten zugänglich, die ihn von Amts oder Geschäfts wegen brauchten. —
In den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts war der Geschäftsgang der Zensur in Österreich folgender:
Was an Büchern von auswärts nach Österreich gesandt wurde, landete zunächst an der Grenze auf der Büchermaut, in deren unmittelbarer Nähe der Sekretär der Zensurkommission sein Amtszimmer hatte. Ihm wurden die Bücherpakete zugestellt und die Namen der Besitzer gemeldet. Was dem Sekretär als erlaubt bekannt war, wurde bald wieder zurückgegeben; was ihm unbekannt war, also jede Neuerscheinung, oder sonstwie bedenklich erschien, überwies er den zuständigen Mitgliedern der Zensurkommission. Bücher, die schon auf dem Index standen, beschlagnahmte er.
Die sieben Mitglieder der Wiener Zensurhofkommission versammelten sich nebst dem Sekretär monatlich ein oder mehrere Male, und die einzelnen Zensoren berichteten über die von ihnen geprüften Bücher. Die bedenklichen Stellen las man vor, und wenn die sieben Weisen sich darüber einigten, daß durch jene Äußerungen die Religion, der Staat, die guten Sitten, die Liebe des Nächsten oder die Ehrfurcht, die man „denen Hohen“ schuldig war, gefährdet seien, wurde darüber ein Protokoll aufgenommen. Dieses wanderte zur Hofkanzlei und von da zur Kaiserin, der auf diese Weise nicht nur die epochemachenden wissenschaftlichen Werke, sondern auch der massenhafte Abhub der unsittlichen Literatur vor Augen kam. Bestätigte sie das Urteil der Kommission, so wurde der Titel des Buches in den Katalog der verbotenen Bücher aufgenommen. Die Exemplare selbst versiegelte man, sandte sie an den Absender zurück oder schaffte sie sonstwie über die Grenze. Bücher, die man nicht unbedingt verbieten wollte, gab man ihren Besitzern zurück, wenn sie ausdrücklich um die Erlaubnis baten, „erga schedam“ (gegen Erlaubniszettel); manchem war natürlich diese Formalität unbehaglich, und er verzichtete lieber auf sein Eigentum. Auch unkatholische Bücher, falls sie keine Lästerungen der katholischen Kirche enthielten, wurden den Andersgläubigen zum Gebrauch überlassen, wenn die betreffende Religion in dem jeweiligen Landesteil geduldet war. Diese ganze Prozedur dauerte natürlich etliche Monate, und jede auch harmlose Neuerscheinung kam daher mit großer Verspätung in die Hände der österreichischen Leser.
Nur die Bücher, die schon geprüft und verboten waren, verfielen der Beschlagnahme oder Vernichtung. Zu den Sitzungen der Kommission brachte der Sekretär diese von ihm angehaltenen Bücher mit, las das Verzeichnis derselben vor nebst den Namen der Besitzer, und dann machten sich die würdigen Herren daran, eigenhändig diese Kontrebande zu zerreißen und zu verbrennen. Theologische und staatswissenschaftliche Schriften verschonte man und überwies sie der Kaiserlichen und Erzbischöflichen Bibliothek, wenn sie dort noch fehlten. Solche verbotene Schriften wurden, wenn sie nicht unbedingt verwerflich waren, sondern nur anstößige Stellen enthielten, wenigstens seit 1766 Jurch die Initiative Kaiser Josephs den Gelehrten, die sie für ihren Beruf brauchten, „erga schedam“ ausgeliehen. „Professoren wird so ziemlich alles in die Hand gegeben“, schrieb Sonnenfels am 17. Dezember 1768 an Klotz. Die anstößigen protestantischen Bücher wurden im hintersten Zimmer der Kaiserlichen Bibliothek verwahrt; wer eines davon entleihen wollte, mußte sogar erst beim päpstlichen Nuntius in Wien gegen Bezahlung von Gebühren die Erlaubnis erbitten, die ganz nach Gutdünken erteilt oder verweigert wurde. Dieser Unterschied zwischen dem kleinen Kreis der Gebildeten und der großen Masse blieb von da ab ein Merkmal der ganzen Zensurgesetzgebung Österreichs.
Natürlich gab es bei dem Verfahren auch Hintertüren. Nicht immer wurden die ganzen Bücher verboten, oft nur einzelne Bogen oder Blätter daraus. War man mit dem Sekretär befreundet, berichtet Nicolai, so wurden die beanstandeten Blätter nicht heraus-, sondern nur durchgeschnitten. Außerdem trieben die Unterbeamten mit den herausgeschnittenen Blättern einen schwunghaften Handel. Selbst die zum Feuertode verurteilten Bücher oder Blätter waren durch die käufliche Gunst der Unterbeamten zu retten; sie wurden nur angebrannt.
Derselben Zensurkommission wurden, seitdem die Prüfung der in Österreich selbst zu druckenden Bücher den Jesuiten durch van Swieten endgültig entzogen war, auch die Manuskripte vorgelegt, und zwar mußten sie in zwei Exemplaren eingereicht werden, was in einer Zeit, wo man noch keine Schreibmaschine besaß, eine große Last für die Verfasser bedeutete. Das eine Exemplar wurde vom Zensor begutachtet und dann auf dem Zensuramt zur späteren Kontrolle behalten; das zweite erhielt der Verleger oder Autor mit dem Vermerk der Erlaubnis oder des Verbotes zurück. —
Nach van Swietens Tode 1772 fiel die Zensur bald in ihre alten Übel zurück, und der Klerus gewann in der Kommission wieder das Übergewicht. Der neue Präsident der Zensurhofkommission stand den mit frischer Keckheit auftretenden Anmaßungen der Geistlichkeit hilflos gegenüber, und so konnte es nicht fehlen, daß die Jesuiten, obgleich ihr Orden 1773 auch in Österreich aufgelöst wurde, verstärkten Einfluß auf den Gang der Zensurgeschäfte gewannen. Besaßen sie doch noch immer das Ohr der Kaiserin, der jetzt ein energischer Berater wie van Swieten fehlte. Hatte ein Jesuit oder sonst ein Betbruder, erzählt Nicolai, an einem Buche Ärgernis genommen, so steckte er sich hinter eine Kammerfrau der Fürstin; er zeigte ihr etliche mit Rotstift angestrichene Stellen des Buches, die anstößig erscheinen konnten, und die Kammerfrau legte sie der Kaiserin vor. Auf den Zusammenhang des Textes wurde keine Rücksicht genommen, und ein kaiserliches Handbillett verfügte kurzweg das Verbot. Auf diese Weise soll 1774 wegen einer falschen Interpunktion, die eine Stelle über Christus und Mohammed verunstaltet hatte, Wielands „Deutscher Merkur“ wegen vermeintlicher Gotteslästerung verboten worden sein. Als schließlich vernünftige Leute die Kaiserin über den Zusammenhang aufklärten, wurde das Verbot wieder aufgehoben.