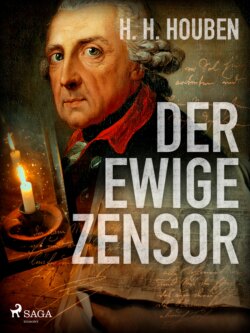Читать книгу Der ewige Zensor - Heinrich Hubert Houben - Страница 8
5. Zensurflüchtlinge.
ОглавлениеSo lange man Bücher druckt, hat man Bücher verboten, und so lange man Bücher verbietet, haben findige Schriftsteller, Verleger und Drucker Mittel und Wege gefunden, hinter die Schule des Gesetzes zu gehen, dem Zensor ein Schnippchen zu schlagen und den Fangeisen der Polizei zu entrinnen. In einer politisch aufgewühlten Zeit, im Sommer 1811, klagte der Berliner Zensor Himly, oft vergingen Wochen, ohne daß er etwas „handschriftlich Politisches“ vorgelegt erhalte, und doch erschien eine so unübersehbare Fülle derartiger Literatur, daß die preußische Regierung in einem Rundschreiben vom 25. Dezember 1811 allen Landesjustizkollegien, denen nach dem Wöllnerschen Zensuredikt die Aufsicht darüber zustand, die größte Aufmerksamkeit über solche Flug- und Gelegenheitsschriften einschärfte. Was irgendwie den Rotstift des preußischen Zensors scheute, flüchtete ins Ausland, in die Preußen feindlich gesinnten oder einstweilen seiner Machtsphäre entzogenen Nachbarstaaten, oder wurde auch ohne Zensurerlaubnis im geheimen gedruckt. Als Verlagsorte prangten dann auf den Titeln dieser Schriften „Germanien“ oder „Deutschland“, „Helvetien“ oder „Paris“, „Babylon“, „Tobolsk“ oder „Austerlitz“ usw. Der Name des Verfassers, des Druckers oder des Verlegers war wohlweislich verschwiegen oder durch einen falschen ersetzt, und es wimmelte täglich von neuen Firmen, die in keinem Handelsregister standen und auch nie um Aufnahme darin ersuchten. Das war schon seit der Reformation des Landes so der Brauch. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde politische und religiöse Oppositionsliteratur meist in Holland gedruckt, aber mit französischen oder deutschen Verlagsorten bezeichnet. Was ganz orthodox erscheinen wollte, es aber keineswegs war und sich unter falscher Flagge einzuschmuggeln gedachte, wählte dazu die Residenzen der katholischen Kirchenfürsten. Köln am Rhein war besonders beliebt, und unter seinen falschen Verlagsfirmen gewann der Name Pierre Marteau, auf deutsch: Peter Hammer, eine gewisse Berühmtheit. Die Verlagsangabe: „Cölln, bei Pierre Marteau“ findet sich in der französischen Presse zuerst 1663, um 1685 auch in der deutschen. Ob ein Setzer oder Drucker dieses Namens wirklich gelebt hat, ist ungewiß. 1786 tauchte die Übersetzung „Peter Hammer“ auf; seit Anfang der neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts, also seit der französischen Revolution und Napoleons Aufstieg, wurde sie zu politischen Tagesschriften immer häufiger benutzt; zur besseren Beglaubigung gab man ihr noch einige Varianten: „Hammers Erben“, „P. Hammer der ältere“, und in Köln, Reutlingen und Mainz, in Amsterdam und Petersburg schien diese gewaltig rührige und unternehmende Firma Filialen zu haben. Berliner Verleger wie Nicolai und Voß, Leipziger wie Fleischer und Hartknoch legten diese Maske an; seit Beginn des 19. Jahrhunderts begegnet man ihr allenthalben. Friedrich Maximilian Klingers „Betrachtungen und Gedanken“ (1802) und Mahlmanns „Herodes und Bethlehem“ (1803) bedienten sich ihrer; in Wirklichkeit bezahlte die Druckkosten der Verlag Hartknoch in Leipzig. Wilhelm Neumann und Varnhagen von Ense sandten unter der Kölner Firma ihre „Testimonia auctorum de Merkelio“ (1806) hinaus, und der junge Joseph Görres legte scherzhafte „Schriftproben von Peter Hammer“ vor (1808). Berüchtigt wurde die Firma durch die „Vertrauten Briefe über die innern Verhältnisse am preußischen Hofe“ (1807—1809) und die „Neuen Feuerbrände“ (1807), deren Verfasser, der preußische Kriegsrat Friedrich v. Cölln, vom Staatskanzler von Hardenberg heftig verfolgt, aber schon 1811 wieder zu Gnaden aufgenommen wurde; der wirkliche Herausgeber beider Werke war der Verlag Heinrich Gräff in Leipzig, ein Geschäft, an dem Friedrich Arnold Brockhaus beteiligt war. „Zeter! Zeter! — Jammer, Jammer!! Peter, Peter, Hammer, Hammer — Streut ohn’ Ende Feuerbrände“ sang, Schillers „Glocke“ parodierend, 1807 der ungenannte Verfasser der „Löscheimer“, die, ebenso wie die „Feuerschirme“ von Friedrich Wilhelm Gubitz, gegen Cöllns Lästerzunge aufgetreten waren. Der junge Verlag Brockhaus, der sich 1805 in Amsterdam und 1811 in Altenburg etabliert hatte, bediente sich auch für eigene Preßerzeugnisse dieser falschen Flagge; sie deckte u. a. zwei Schriften, deren Verkauf in Preußen mit schwerster Strafe belegt wurde (bis zu 100 Dukaten pro Exemplar!): die „Briefe eines reisenden Nordländers“ (1812) von dem Schriftsteller und Musiker Johann Friedrich Reichardt, und die „Handzeichnungen aus dem Kreise des höhern politischen und gesellschaftlichen Lebens“ (1812), die, wie hier zum erstenmal festgestellt sei, ebenfalls von Reichardt herrühren.
Schriften mit falschen Druckorten und Verlagsangaben, von denen manche bis heute Geheimnis geblieben sind, waren durch das Wöllnersche Zensuredikt in Preußen streng verboten; neue Verfügungen vom 18. November 1811 und 15. Dezember 1812 schärften den Buchhändlern nochmals ein, ja nicht solche zweifelhaften Neuerscheinungen zu vertreiben, ehe die einheimische Zensur ihr ausdrückliches Plazet dazu gegeben habe. Das half alles nichts, im Gegenteil, der Verlagsbuchhändler Peter Hammer wurde so populär, daß sogar ein Porträt des geheimnisvollen Unbekannten erschien! (Vgl. die Abbildung.) Die alte, ursprüngliche Firmierung „Paris, Pierre Marteau“ benutzte noch Karl von Holtei, als er 1834 anonym seinen „Don Juan, Dramatische Phantasie in 7 Akten von einem deutschen Theaterdichter“ herausgab, „frei von den Fesseln, die zufällige Bühnenform, Theaterzensur, Hofetikette und Prüderie des tugendsamen Publikums auflegen“, ein herzlich unbedeutendes und harmloses Erotikon, obgleich die Szene anmutig wechselt zwischen Notzucht im Schlafzimmer, in Garten-Freiluft, im Kloster, im Bordell, und der Held sich sogar durch andere vertreten läßt, um allen Geliebten gerecht zu werden. Das Buch wurde in Preußen im November 1833 verboten. Neuerdings hat ein skrupelloser Spekulant den Schmarren sogar unter dem längst fadenscheinig gewordenen bibliophilen Deckmantel in neuer Form auf den Markt gebracht. In seinen hübschen Lebenserinnerungen „Vierzig Jahre“ deutet Holtei nur ganz verstohlen auf diese Jugendsünde hin; ihr wirklicher Verleger war Otto Wigand in Leipzig. Der deutsche Peter Hammer starb erst im Revolutionsjahr 1848: der in allen Zensurpraktiken erfahrene Hamburger Verlag Hoffmann und Campe setzte als letzter jenen Namen auf die anonyme Broschüre „Des Österreichers richtiger Standpunkt“ (von Karl Möring). Seitdem verschwand die Firma „Cöln, Peter Hammer“ endgültig aus dem Buchhandel.
Hammers erfolgreiches Wirken hatte aber Schule gemacht, und besonders nach der Julirevolution, als der Kampf zwischen Literatur und Zensur seinen Höhepunkt erreichte, schossen die fingierten Verlagsorte und -firmen wie Pilze aus der Erde. Als Ludwig Börnes „Briefe aus Paris“ (Band 1 und 2, bei Hoffmann und Campe, 1832) allenthalben heftig verboten wurden, erschien die Fortsetzung, Band 3 und 4, unter dem humoristisch harmlosen Titel „Mittheilungen aus dem Gebiete der Länder- und Völkerkunde“ bei L. Brunet in Offenbach (1833), einer völlig unbekannten Firma, der Schluß, Band 5 und 6 (1834), wieder unter dem richtigen Titel bei derselben Firma, die diesmal in Paris domizilierte. In Wirklichkeit steckte natürlich der Hamburger Verlag dahinter, der die Fortsetzung wenigstens vertrieb, wenn auch der Verfasser vom 3. Bande ab, da er mit Campe die üblichen Honorardifferenzen gehabt hatte, hier den Selbstverleger gespielt zu haben scheint. Als die preußischen und sächsischen Behörden nach dem geheimnisvollen Unbekannten Brunet eifrig recherchierten, versicherte der Kommissionär dieser neuen Firma, F. Volckmar in Leipzig, Brunet sei niemand anders als Börne selbst, der unerreichbar und sicher in Paris saß. Und „L. Brunet“ klang ja auch fast wie L. Börne. Tauchte solch eine Novität auf, so wußte jeder Buchhändler, was das zu bedeuten hatte, daß dies Opus in weitem Bogen um jede Zensurstelle herumgegangen war, und meist stand auch ein entsprechender Hinweis auf der Buchhändlerfaktur, auf der Rechnung, die der Sendung beilag. Die nachstehende Abbildung ist ein interessantes Dokument: mit dieser Faktur sandte der unbekannte Verleger L. Brunet die „Mittheilungen aus dem Gebiete der Länder- und Völkerkunde“ Band 1 und 2 an eine Torgauer Buchhandlung, fügte aber handschriftlich hinzu, daß es sich um Band 3 und 4 der überall bekannten Börneschen „Briefe“ handle, die in den meisten deutschen Bundesstaaten verboten waren; und daß es mit dieser Fortsetzung ähnlich ergehen werde, besagt die gedruckte Nachschrift. Behielt der Empfänger die Sendung, so war es seine Aufgabe, die gefährliche Kontrebande sogleich an den Mann zu bringen, ehe die Polizei in seinem Laden erschien und sie beschlagnahmte; das dauerte allerdings meist eine gute Weile. Als die gefährlichen „Deutsch-französischen Jahrbücher“ von Karl Marx und Arnold Ruge 1845 von der Schweiz aus verbreitet wurden, figurierten sie auf den Fakturen als „Deutsch-französische Gespräche“.
Noch größeres Kopfzerbrechen als Brunet verursachte den deutschen Polizeibehörden eine Firma, die 1833 die unverstümmelte Vorrede zu Heines „Französischen Zuständen“ herausbrachte, von der in Kapitel 8 ausführlicher die Rede ist. „Heideloff und Campe in Leipzig“, meldete sogleich der preußische Gesandte in Dresden, gebe es nicht, wohl aber in Paris. Der Leipziger Kommissionär der Pariser Firma, J. C. Ch. Kirbach (Dycksche Buchhandlung), war natürlich unschuldig wie ein Kind; er bekam von Paris nur verschnürte Ballen; was darin stecke, wisse er nicht. Als der preußische Gesandte in Paris ein Verzeichnis der Verlagswerke der Pariser Firma liefern sollte, erklärte er, das sei unmöglich, denn die meisten davon gingen unter falscher Firma hinaus. Bei „Karl Heideloff in Paris“ erschien 1831 eine Flugschrift „Ueber die polnische Frage“; in Wirklichkeit war F. A. Brockhaus der Verleger; in Leipzig wurde sie gedruckt, mit Fakturen Heideloffs versandt, dieser rechnete auf der Messe mit den Buchhändlern ab und setzte sich dann mit dem wirklichen Unternehmer auseinander. So wahrte man das Gesicht. Leipzig war überhaupt ein Zufluchtsort der polnischen Revolutionäre bis in die fünfziger Jahre hinein, und die meisten dortigen Buchhändler machten mit ihnen Geschäfte. Über die Pariser Firma führten nun die preußischen Behörden eine gewaltige Untersuchung. Friedrich Napoleon Campe, der Teilhaber, war ein Neffe des berüchtigten Hamburger Verlegers, Heideloff selbst war Mitglied des deutschen revolutionären Komitees in Paris; in Nürnberg fand sich eine „Kommandite“ des Pariser Hauses, dort betrieb Friedrich Campe, der Bruder des Hamburgers und Vater des jungen Napoleon, eine Druckerei, aus der auch Börnes „Briefe aus Paris“ hervorgegangen waren. Man verkehrte untereinander nie direkt, alles ging durch die Hand des Leipziger Kommissionärs. Auf preußische Reklamation mußte der Nürnberger Verleger und Druckereibesitzer, Doktor und „Magistrat“ Friedrich Campe vor dem Stadtrichter erscheinen. Er wies jeden Schatten eines Verdachtes mit verräterischem Pathos von sich; Heideloff und Campe seien fern von allem revolutionären Treiben und wegen ihrer legitimistischen Gesinnung bei allen Pariser Demagogen verhaßt; er selbst, so beteuerte er „vor Gott“, sei ebenfalls „rein von jeglicher Verbreitung revolutionärer Schriften“ — denn Drucken und Verbreiten der Börneschen „Briefe“ war ja zweierlei! Er habe „mit Indignation“ alle ihm erreichbaren Exemplare der Heineschen Vorrede vernichtet. Statt nach Heideloff und Campe solle sich die Polizei lieber in Leipzig bei Volckmar nach L. Brunet erkundigen, dann werde er, „der graue Vater“, und ebenso sein „braver Sohn“, der gleichwohl mit dem Pariser assoziiert war, ehrenvoll dastehen. Jeder redete sich so gut heraus wie er konnte, völlige Klarheit gewann die Behörde nicht, die Akten darüber schwollen unheimlich an und endeten am 21. Juni 1834 mit einem Generalverbot aller Schriften, die die verdächtigen Firmen Heideloff und Campe und ebenso L. Brunet auf dem Titelblatt trugen oder noch tragen würden; denn in solchen Fällen machte man in Berlin kurzen Prozeß und verbot auch das, was noch gar nicht erschienen war. 1842 erreichte auch die Hamburger Firma Hoffmann und Campe dieses Schicksal; der Brand von Hamburg im Mai dieses Jahres erweichte dann aber das Herz des Königs, und die Maßregel wurde wieder aufgehoben.
Um diese Zeit war ein großer Teil der jungen deutschen Literatur, vor allem die sich mächtig entfaltende politische Lyrik, völlig ins Ausland abgewandert, und zwar nach der Schweiz, nach Zürich, wo der Publizist und Politiker Julius Fröbel, ein Neffe des bekannten Pädagogen, einen Buchverlag, das „Literarische Comptoir“ (Zürich und Winterthur), gegründet hatte, um der jungen Literatur eine Gasse durch das Sperrfeuer der deutschen Zensur zu brechen. Fröbel war damals Professor der Mineralogie an der Züricher Universität; die buchhändlerische Tätigkeit nahm ihn aber bald so stark in Anspruch, daß er seine akademische Laufbahn aufgab, um sich ganz dem Geschäft zu widmen. Der bekannte Demokrat und Dichter August Follen war Mitinhaber dieses Verlagsunternehmens, das trotz großer Erfolge und kaufmännischer Geschicklichkeit durch steten Mangel an Betriebskapital nie recht auf einen grünen Zweig kam. 1845 war auch Arnold Ruge daran beteiligt. Im „Literarischen Comptoir“ erschienen 1841 Georg Herweghs „Gedichte eines Lebendigen“, deren Zauber ganz Deutschland berauschte und selbst Friedrich Wilhelm IV. Bewunderung abnötigte; als der Dichter ein Jahr darauf eine Triumphreise durch Deutschland machte, beschied ihn der preußische König zu einer Audienz, in der er ihn seiner Vorliebe für eine „gesinnungsvolle Opposition“ versicherte. Das hielt aber die preußische Zensur nicht ab, zur selben Stunde eine von Herwegh angekündigte neue Zeitschrift, den „Deutschen Boten aus der Schweiz“, zu verbieten, noch ehe das erste Heft im „Literarischen Comptoir“ erschienen war. Herwegh beschwerte sich darüber in einem kecken Brief an den König; indiskrete Freunde brachten das Schriftstück alsbald in die Presse, und das Ergebnis der Begegnung zwischen Sänger und König war, daß dem ersteren dringend geraten wurde, sich nicht mehr innerhalb der preußischen Grenzpfähle blicken zu lassen. Die ganze Audienz, ihre Vor- und Nachgeschichte, machte damals ungeheures Aufsehen; die Gesinnungsgenossen des Dichters waren von seinem Auftreten auf dem höfischen Parkett keineswegs erbaut, und ein anonymer Karikaturenzeichner stellte die zwei Szenen nebeneinander: links Herwegh, wie er trotzig vor dem Bilde des Königs steht, dem er mit seinen „Gedichten eines Lebendigen“ den Handschuh hingeworfen; rechts die Vorstellung des Dichters vor dem König selbst durch dessen Leibarzt Schönlein, wobei der Dichter seinen devoten Bückling macht wie jede andere Hofschranze (vgl. Abbildung S. 48). Heine hat die „Audienz“ in einem boshaften Gedicht verewigt und die Veröffentlichung des Briefes köstlich persifliert mit den Versen:
Er hat mir Beifall zugenickt,
Als ich gespielt den Marquis Posa;
In Versen hab’ ich ihn entzückt,
Doch ihm gefiel nicht meine Prosa.
Die „Gedichte eines Lebendigen“, deren außerordentlicher Erfolg sich durch zahlreiche Auflagen bewies, enthielten unter anderen meisterhaften Versen das „Reiterlied“ („Die bange Nacht ist nun herum“), das unsere Feldgrauen während des Weltkrieges so oft sangen, wenn sie durch die Straßen ihrer Heimat zur Eisenbahn marschierten, die sie an die Front bringen sollte.
In Zürich bei demselben Verlag erschienen als Zensurflüchtlinge auch die politischen „Gedichte“ von Robert Prutz (1841) und seine aristophanische Komödie „Die politische Wochenstube“, die seiner akademischen Laufbahn ein vorschnelles Ende machte. Das „Literarische Comptoir“ brachte ferner mehrere Gedichtsammlungen von Hoffmann von Fallersleben, darunter seine „Deutschen Lieder aus der Schweiz“ (1842) mit dem „Lied der Deutschen“, das jetzt unsere eigentliche Nationalhymne geworden ist; auf neutralem Schweizer Boden ist also „Deutschland, Deutschland über alles“ als Zensurflüchtling zuerst — wenigstens in einer Liedersammlung des Dichters selbst — an die Öffentlichkeit getreten. Auch die „Hoffmannschen Tropfen“ und Hoffmanns „Deutsche Gassenlieder“, die „Unterthänigen Reden“ des Königsbergers Ludwig Walesrode, Ruges „Anekdota“, Schriften von Ludwig und Friedrich Feuerbach, von Bruno und Edgar Bauer, Johann Jacoby, Wilhelm Schulz und zahlreichen anderen kamen aus Zürich.
Im „Literarischen Comptoir“ erschien 1843 auch ein Bändchen, das diesem Kapitel den Namen gegeben hat: zwölf Freiheitslieder unter dem Titel „Zensur-Flüchtlinge“. Ihr ungenannter Verfasser war der junge Rudolf Gottschall, der damals in Königsberg die Rechte studierte. Bei einem dortigen Verleger hatte er soeben, gleichfalls ohne Namen, seine ersten lyrischen Versuche als „Lieder der Gegenwart“ herausgebracht. Der ihm von der Gymnasialzeit her gewogene Schuldirektor Lucas hatte dabei als Zensor gewaltet; bei einer gemütlichen Tasse Kaffee hatten Zensor und Autor in aller Freundschaft beraten, welche der Gedichte ihres Freisinns wegen dem Rotstift zum Opfer fallen mußten. Dabei hatten sich die obigen zwölf Freiheitslieder, die besten der ganzen Sammlung, als unrettbar erwiesen; für sie konnte der Schulmann als amtlich bestallter Zensor die Druckerlaubnis nicht geben. Sie wanderten also nach der Schweiz, und so spie das „doppelt geöffnete“ Tor zwei Gottschallbändchen auf einmal hervor.
Wie die deutschen Dichter des Vormärz mit ihren Büchern nach der Schweiz gingen, so die österreichischen nach Deutschland, wo man, wenigstens über Österreich, noch immer mehr sagen durfte als innerhalb der schwarzgelben Grenzpfähle. Dem Gesetz nach durfte kein k. k. Österreicher im Ausland irgend etwas drucken lassen, was nicht die einheimische Zensur gebilligt hatte, und sie billigte sehr wenig. Grillparzer und v. Zedlitz unterwarfen sich ihr ohne Widerrede. Der Dramatiker Eduard v. Bauernfeld war so kühn, ihr offen zu trotzen. Er ließ 1837 sein Lustspiel „Der literarische Salon“ unter seinem Namen bei Brockhaus in Leipzig, in dessen „Taschenbuch dramatischer Originalien“ (II. Jahrgg.), erscheinen, obgleich das Stück — eine völlig berechtigte Satire auf die damals in Wien tätigen Revolverjournalisten Saphir und Bäuerle — nach der ersten Aufführung am Burgtheater verboten worden war und die Wiener Zensur die Veröffentlichung ausdrücklich untersagt hatte. Ein Strafverfahren gegen den Dichter wurde begonnen, aber niedergeschlagen; die Polizei fürchtete jedenfalls Bauernfelds scharfe Zunge, wie sie ja auch Saphir fürchtete, dem zuliebe das Verbot des „Literarischen Salons“ ergangen war. Wem aber diese Kühnheit fehlte, dem blieb nichts übrig, als seine Werke unter fremdem Namen als Zensurflüchtlinge ins Ausland zu schicken oder selber einer zu werden. Daher die bekannten Decknamen hervorragender österreichischer Dichter in jener Zeit. Graf Anton von Auersperg verbarg sich unter dem Namen Anastasius Grün und verleugnete diesen selbst dann noch, als der Chamisso-Schwabsche Musenalmanach 1836 das getreue Jugendporträt des schnell berühmt gewordenen Lyrikers brachte. Erst 1837 zwang ihn eine persönliche Ehrenkränkung durch einen Polizeispitzel, den Dichter Braun von Braunthal, öffentlich für sein Pseudonym einzutreten. Als er kurz darauf beim österreichischen Staatskanzler, dem Fürsten Metternich, eine Audienz hatte, weil er nach dem Beispiel vieler anderer Landsleute auswandern wollte, und dabei aus seiner Identität mit Anastasius Grün zum erstenmal kein Hehl machte, lauschte der Wiener Polizeipräsident hinter einer spanischen Wand. Beinahe wäre Auersperg im Paletot des Präsidenten nach Hause gegangen; der Irrtum des Dieners in der Garderobe klärte ihn zufällig darüber auf, was die Geräusche zu bedeuten hatten, die er während der Unterredung mit Metternich zwar gehört, aber nicht beachtet hatte. Er war vornehm genug, dem Polizeipräsidenten die Beschämung zu ersparen, die Tatsache seiner Lauschertätigkeit zu den Akten geben zu müssen: er veröffentlichte alsbald ein neues Gedicht und unterzeichnete es mit seinem richtigen Namen und dem bekannten Pseudonym. Das Gedicht wurde von der Zensur durchgelassen. Damit war nun endlich der juristische Beweis für die Identität Auerspergs mit Grün in den Händen der Polizei, und prompt erhielt der entlarvte Verbrecher eine mit Rücksicht auf seinen hohen Stand noch niedrig bemessene Geldstrafe, weil er „höchst anstößige“ Schriften im Ausland habe drucken lassen. Diese Schriften waren seine „Blätter der Liebe“ (1829) „Der letzte Ritter“ (1830) und „Schutt“ (1835)! Das berühmteste seiner Werke, die „Spaziergänge eines Wiener Poeten“ (1832), das in Österreich und Deutschland ungeheuer zündete und die gesamte politische Lyrik des Vormärz aufs stärkste beeinflußte und befruchtete, war 1832 völlig namenlos bei Hoffmann und Campe in Hamburg erschienen, aber Auersperg hütete sich sorgfältig, auch dessen Urheberschaft zuzugeben, sonst wäre es mit einer Geldstrafe nicht abgetan gewesen.
Aus demselben Grunde nannte sich Niembsch von Strehlenau als Dichter Nikolaus Lenau, nahm Heinrich Landesmann den Namen Hieronymus Lorm an. Wer aber dieses Versteckspiel nicht durchführen zu können glaubte, denn unter Umständen gehörte dazu eine große Geistesgegenwart, dem blieb nichts anderes übrig, als den Staub des unbehaglichen Vaterlandes von den Füßen zu schütteln und außerhalb Österreichs das unsichere Leben eines Zensurflüchtlings zu führen. So kamen die Lyriker Karl Beck, Moritz Hartmann, Alfred Meißner und Karl Herlossohn, Ignaz Kuranda, der Begründer der „Grenzboten“, und andere dii minorum gentium nach Deutschland, und wenn sie sich dort nicht mehr sicher fühlten, gingen sie gleich Börne, Heine, Herwegh, Ruge, Karl Marx und zahllosen andern nach Paris, dem eigentlichen Sammelpunkt aller Zensurflüchtlinge. Denn die deutsche Polizei war gar zu gern bereit, der österreichischen Kollegin Helfersdienste zu leisten. Ein Erlebnis Alfred Meißners ist für diese vormärzlichen Zustände bezeichnend. Er hatte 1846 sein Epos „Ziska“ ohne Vorwissen der österreichischen Zensur in Leipzig herausgegeben und sich, um allen Verfolgungen zu entgehen, in Dresden niedergelassen. Da wurde eines Morgens ein Brief ohne Unterschrift an ihn abgegeben; er enthielt ein lithographiertes „Kreisrundschreiben“ seiner Prager Heimatbehörde, das alle böhmischen Amtsvorsteher auf den von der Zensur streng verbotenen „Ziska“ aufmerksam machte. Ein unbekannter Freund wollte offenbar den Dichter warnen. Als Meißner am Abend desselben Tages von einem Zusammensein mit Richard Wagner, dem Maler Friedrich Pecht und dem Bildhauer Hähnel nach Hause ging, redete ihn auf der dunklen Straße ein Unbekannter an und teilte ihm mit, zwei Polizeikommissare hätten sich sein Zimmer aufschließen lassen und erwarteten ihn dort; auch ein Schlosser sei geholt worden, und die unwillkommenen Gäste hätten unterdes gewiß schon jede Schublade erbrochen und alle Papiere untersucht und beschlagnahmt. Der freundliche Warner — ein in Meißners Nähe wohnender Friseur — hatte Mitleid mit dem jungen, fröhlichen Dichter empfunden, den er von Ansehen kannte, und es sich nicht verdrießen lassen, mehrere Stunden im Regenwetter der Straße auf ihn zu warten. Meißner wußte, was ihm bevorstand, die Dresdener Polizei besorgte die Geschäfte der benachbarten böhmischen; aber er hütete sich, ihr ins Garn zu gehen, sondern eilte sofort zum Bahnhof, um mit dem nächsten Zug das auslieferungslustige Sachsen zu verlassen. Und wenn die beiden Zensurkommissare in Dresden nicht gestorben sind, so warten sie auf den Dichter des „Ziska“ noch heute.