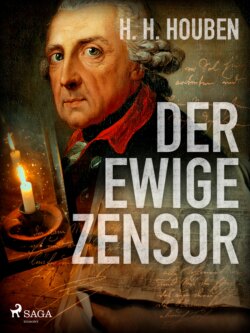Читать книгу Der ewige Zensor - Heinrich Hubert Houben - Страница 6
3. Philosoph und könig.
ОглавлениеDas trübste Zensurwetter, das die deutsche Literatur je zu verzeichnen hatte, herrschte unstreitig unter der Regierung Friedrich Wilhelms II. und seines Justizministers Wöllner, von dem Friedrich der Große in einer seiner lapidaren Marginalien zu den Akten gegeben hatte: „Der Wöllner ist ein betrügerischer und intriganter Pfaffe, weiter nichts.“ Das von ihm selbst geschaffene Zensuredikt vom 19. Dezember 1788 genügte ihm schon nach zwei Jahren nicht mehr, und die oberste Zensurbehörde, das Oberkonsistorium, gefiel ihm schon gar nicht, da es „viel zu leichtsinnig“ verfuhr. Durch neue Bestimmungen wurde die Zensurschraube immer schärfer angezogen, und dem Oberkonsistorium wurde eine von ihm unabhängige geistliche Aufsichtskommission auf die Nase gesetzt, die „Immediat-Examinationskommission“, die alle preußischen Pfarramtskandidaten zu prüfen hatte und deren spiritus rector ein ehemaliger Breslauer Oberlehrer, namens Hillmer, war, der durch seine mystischen Neigungen das Vertrauen des Königs gewonnen hatte. Diese Kommission wurde zunächst mit der Zensur der theologischen und moralilischen Schriften beauftragt, und sie wußte sich nach und nach des ganzen Zensurgeschäftes zu bemächtigen. Nach dem Vorbilde Österreichs sollte auch in Preußen kein gedrucktes Blatt verbreitet werden, das nicht von der Zensur genehmigtwar, ein Index verbotener Bücher wurde geplant, und die ganze Büchereinfuhr wurde einer scharfen Kontrolle unterworfen. Der König stand ganz auf seiten dieser Kommission, drohte gelegentlich mit „Leib- und Lebensstrafen“ für Zensurvergehen, und ein Mann wie Immanuel Kant, der berühmte Königsberger Philosoph, mußte sich durch ein geradezu beispielloses Ministerialreskript vom 1. Oktober 1794 wie ein Schulbube herunterputzen lassen (vgl. das Faksimile auf Seite 31). Auf der Gegenseite standen natürlich die Schriftsteller und Buchhändler, die mit Recht über den Rückgang ihres Gewerbes klagten, denn eine förmliche Literaturflucht aus Berlin hatte eingesetzt, und ihre Proteste wurden in einer bewundernswert kühnen Art durch die gesamten Ministerien unterstützt, die mit überlegenem Geschick jeder Maßregel der Immediatkommission die Spitze abbrachen und selbst den Ausbrüchen königlichen Zornes mannhaft entgegentraten, bis endlich die Götzendämmerung erfolgte und mit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms III. eine neue Morgenröte der Freiheit heraufzudämmern begann — eine Morgenröte, die sich allerdings nur zu bald in tiefe Nacht verlor. Vier Monate nach seiner Thronbesteigung entließ der junge Monarch den allmächtigen Minister; Wöllners Kreaturen von der Immediatkommission wurden mit kleinen Pensionen abgebaut, und das Ministerium stellte ihnen das Abgangszeugnis aus, daß sie „in ihren bisherigen Verhältnissen nichts geleistet hätten und auch fernerhin keinen Nutzen bringen würden“.
Dieser verheißungsvolle Umschwung soll durch ein Literaturereignis illustriert werden, das zwei Jahre später die gesamte wissenschaftliche Welt in Aufruhr brachte. In seinem Mittelpunkt steht ein jüngerer Zeitgenosse Kants, Johann Gottlieb Fichte, dessen „Reden an die deutsche Nation“, gehalten 1807/08 unter den Augen und vor den gespitzten Ohren der französischen Machthaber in Berlin, eines der heiligen Bücher unseres Volkes geworden sind.
Seit 1793 lebte Fichte als Professor der Universität in Jena, wohin ihn Karl August von Sachsen-Weimar auf Anregung des berühmten Mediziners Hufeland und unter Goethes lebhaftem Beifall berufen hatte. Mit seinem Fachkollegen Niethammer gab er 1798 ein „Philosophisches Journal“ heraus, um das sich keine Behörde kümmerte; nur in Österreich wurden die einzelnen Hefte fast regelmäßig verboten, denn dort stand man mit jeder Philosophie auf gespanntem Fuße. Für dieses Blatt schrieb ein Rektor Forberg in Saalfeld, vordem Fichtes Schüler, eine Abhandlung: „Entwicklung des Begriffs der Religion“, worin kurzweg gesagt war, daß man in Ermangelung einer „logischen Notwendigkeit“ zwar nicht an eine göttliche Weltregierung glauben, aber doch so handeln müsse, als ob man nicht daran zweifle. Anmerkungen, die Fichte dazu machen wollte, verbat sich der Verfasser; daher stellte der Herausgeber dem Aufsatz eine eigene Abhandlung „über den Grund unseres Glaubens an eine moralische Weltregierung“ voran. Er ging dabei zwar von der Existenz einer Gottheit aus, die alles durchdringe und belebe, doch dürfe man ihr nicht mit den allzu menschlichen Vorstellungen der natürlichen Theologie nahen. Gegen diese im Januarheft 1798 erschienenen Abhandlungen wandte sich alsbald eine anonyme, von einem Gegner Fichtes, einem Jenenser Mediziner, verfaßte Flugschrift: „Schreiben eines Vaters an seinen studierenden Sohn über den Fichteschen und Forbergschen Atheismus“. Damit war das Stichwort gefallen, das dem nun einsetzenden Kampf, dem Fichteschen Atheismusstreit, verblieben ist.
An Gegnern fehlte es dem temperamentvollen Philosophen in seinem nächsten Wirkungskreise nicht; mit jener anonymen Broschüre wurde eine systematische Hetze gegen ihn veranstaltet. Exemplare wurden nach Leipzig zu unentgeltlicher Verteilung geschickt, ebenso nach Dresden an das dortige Oberkonsistorium. Am 29. Oktober 1798 richtete dieses an den Kurfürsten von Sachsen eine umfangreiche Vorstellung; es forderte nicht nur Konfiskation des „Philosophischen Journals“, sondern, „um dem Unheil der anstößigen Schriften wirksam zu steuern“, außerdem eine Beschwerde „bei den Fürstl. Sächsischen Höfen, auf deren Akademie zu Jena die gefährlichen Grundsätze ... am lautesten gelehrt und am eifrigsten verbreitet werden“, damit „diejenigen Lehrer jener hohen Schulen, welche sich dabei am geschäftigsten beweisen, darüber in Anspruch genommen und nach Befinden bestraft werden möchten“. Auch sei die Drohung angebracht, daß man im Notfall den sächsischen Untertanen den Besuch Jenas verbieten werde; außerdem solle man sich mit der preußischen Regierung in Verbindung setzen. — Daraufhin befahl Kurfürst Friedrich August III. am 8. November, das Journal zu konfiszieren, festzustellen, ob es etwa in Leipzig gedruckt und zensiert sei, und die einheimischen Universitäten nachdrücklichst zu ermahnen. Am selben Tag entwarf das Geheime Consilium entsprechende Schreiben an die Erhalter der Universität Jena, die Herzöge von Sachsen-Weimar, Sachsen-Gotha, Sachsen-Meiningen und Sachsen-Coburg-Saalfeld, mit der Aufforderung, Verfasser und Herausgeber des Journals zur Verantwortung zu ziehen, um „dergleichen Unwesen“ Einhalt zu tun. In der ersten Hälfte des Dezembers gingen die vom Kurfürsten unterzeichneten Schriftstücke ab, das an Sachsen-Weimar erst am 18. Außer Preußen (wegen der Universitäten Halle und Frankfurt a. O.) wurden auch Braunschweig-Wolfenbüttel und Hannover (wegen der Universitäten Helmstedt und Göttingen) zu Maßregeln gegen „solche gemeinschädlichen Grundsätze“ aufgefordert.
Hannover antwortete schon am 14. Januar 1799, es habe das Journal sofort verboten und die „diensam scheinenden besonderen Ermahnungen“ nach Göttingen gerichtet. Braunschweig folgte mit einer ähnlichen Mitteilung am 11. Februar. Sachsen-Gotha wollte (25. Januar) den Rektor Forberg vor das Altenburger Konsistorium stellen, ebenso Sachsen-Coburg (26. Januar). Herzog Georg von Sachsen-Meiningen antwortete (26. Januar), er habe schon früher eine genauere Aufsicht auf diese Dinge beantragt, sei aber „nicht so glücklich gewesen, dieserhalb eine conforme Entschließung zu bewürcken“. — Aus Weimar ließ die Antwort auf sich warten. Das Geh. Consilium in Dresden wollte daher schon am 14. März den Besuch Jenas kurzweg verbieten, besonders da Fichte „sich nicht entblödet“ habe, wider die Unterdrückung seines Journals eine Appellation an die Öffentlichkeit erscheinen zu lassen.
Die „Appellation an das Publicum über die durch ein Churf. Sächs. Confiscationsrescript ihm beigemessenen atheistischen Äußerungen“ — eine Schrift, wie es auf dem Titel hieß, „die man erst zu lesen bittet, ehe man sie confiscirt“ — überreichte Fichte am 19. Januar 1799 dem Herzog von Weimar. Was man hier von dem ganzen Handel hielt, besagt am klarsten ein Brief Schillers vom 26. Januar an Fichte. Karl August dachte nicht daran, seinen Professoren im Schreiben irgendwelche Beschränkungen aufzuerlegen, nur wollte er „gewisse Dinge“ nicht auf dem Katheder gesagt wissen; das sei aber nur seine Privatmeinung, erklärte er; seine Räte würden nicht einmal diese Einschränkung machen. Doch ärgerte sich auch die Weimarische Regierung, daß Fichte vorschnell die Sache vor die Öffentlichkeit gebracht hatte. Über die Konfiskation seines Journals in Sachsen mochte er Lärm schlagen, soviel er wollte, da war man ganz der Ansicht Schillers, daß „eine aufgeklärte und gerechte Regierung keine theoretische Meinung, welche in einem gelehrten Werke für Gelehrte dargelegt wird, verbieten könne“. Aber die von Sachsen geforderte amtliche Maßregelung des Jenenser Professors hätte dieser in ruhigem Vertrauen seiner vorgesetzten Regierung überlassen sollen. Für diese diplomatisch feine Unterscheidung hatte aber Fichte keinen Sinn, der Vorstoß Sachsens hatte ihn aufs äußerste erbittert; er sah sich als Helden eines widerwärtigen öffentlichen Skandals, der in der ganzen Presse breitgetreten wurde; er verlor die Ruhe und witterte Gefahr für seine Stellung, als noch gar keine bestand. Er beanspruchte eine eklatante Genugtuung und glaubte, diese nur durch ein förmliches Gerichtsverfahren finden zu können, das natürlich mit seiner Freisprechung enden müsse. Zu diesem Zweck setzte er auf seine „Appellation“ eine noch viel temperamentvollere „Gerichtliche Verantwortungsschrift gegen die Anklage des Atheismus“ und überreichte auch diese am 18. März seinem Herzog.
Karl August war in diesem Streit entschieden der bessere Philosoph, indem er erklärte, philosophische Systeme könnten nicht Gegenstand richterlicher Entscheidung sein; er wollte die lästige Sache kurz abtun mit einem gelinden Verweis wegen „Unvorsichtigkeit“. Gerade damit aber glaubte Fichte sich nicht zufrieden geben zu dürfen; er drohte mit Demission. Damit hatte der aufbrausende Philosoph die ihm durchaus günstige Stimmung des Herzogs mit einem Schlage verscherzt; selbst Goethe, der ebenfalls über göttliche Dinge „besser ein tiefes Stillschweigen“ beobachtet wissen wollte, ließ jetzt den Freund fallen mit den Worten: „Ein Stern geht unter, ein anderer auf“; Fichtes stolze Sprache erschien ihm unerhört. So erging am 29. März 1799 an den Senat der Universität Jena der Befehl, den beiden Herausgebern des „Philosophischen Journals“ einen Verweis zu erteilen, außerdem aber die von Fichte angebotene Demission „sofort anzunehmen“. Am 5. April teilte man der kurfürstlich sächsischen Regierung das Ergebnis des Verfahrens mit, und in Dresden sah man (15. Mai) darin einen „herrlichen Sieg der Wahrheit und der Religion“.
Nur eines erregte beim sächsischen Hofe großes Befremden: die völlig überraschende Haltung, die Preußen gegenüber der sächsischen Aufforderung einnahm — Preußen, das unter dem Ministerium Wöllner im Kampf gegen die Aufklärung die schärfsten Saiten aufgezogen hatte. Aber Friedrich Wilhelm II. war Ende 1797 gestorben, Wöllner seit März 1798 entlassen, und der Thronfolger Friedrich Wilhelm III. dachte damals ganz anders über diese Probleme, so anders, daß das Geh. Consilium in Dresden völlig konsterniert war, als endlich unterm 16. April 1799 aus Berlin eine sieben eng beschriebene Folioseiten lange Antwort eintraf, die unverblümt erklärte, man finde die Konfiskation des Fichteschen Journals durchaus nicht ratsam! Drei gewichtige Gründe sprächen dagegen: 1. mache man die Schrift dadurch nur um so bekannter; sonst werde sie bald vergessen und „in die Dunkelheit, welche die Fichtesche Philosophie überhaupt umgibt, versunken seyn“; das Verbot mache den Verfasser nur zu einem Märtyrer der Wahrheit; Gottesleugner habe es überdies zu allen Zeiten gegeben; 2. verhindere man durch ein solches Verbot auch die öffentliche Bekämpfung der Schrift, und 3. stehe es in eigenartigem Kontrast zu der Gleichgültigkeit gegen „eine Menge anderer, offenbar sittenverderblicher und zu einer weit schädlicheren praktischen Gottlosigkeit geradezu führenden Schriften“. An diese möge man sich halten, statt an Bücher, die „bloß irrige Theorien, Gegenstände eines vorübergehenden Schulgezänkes und Wortstreites“ enthielten, die aber „übrigens auf Recht und Pflicht als die höchste Würde der menschlichen Natur mit großem und immer schätzbarem Ernste dringen“. Dieses Bestreben werde auch Preußen gern unterstützen; zu besonderen Anweisungen an die Universitäten habe bisher kein Professor Ursache gegeben. Daher könne der König — das war die Quintessenz des preußischen Erlasses — sich dem Verbot nicht anschließen, selbst wenn „alle deutschen Regierungen dem dortseitigen Beispiele“ folgten, er wünsche vielmehr, der Kurfürst möge es wieder aufheben!
Diese kategorische Stellungnahme Preußens ging unmittelbar auf den König zurück. Die Einladung Sachsens, seinem Beispiel zu folgen, war vom Departement des Äußeren an die zuständige Behörde gegeben worden, an das Departement der geistlichen Angelegenheiten, dessen Chef, der Geheime Staats- und Justizminister v. Massow, wiederum die Instanz zu Rate zog, die in der Zeit Wöllners völlig an die Wand gedrückt worden, jetzt aber in ihre Zensurrechte wieder eingesetzt war, das Oberkonsistorium. Dessen vier Mitglieder, die Oberkonsistorialräte Hecker, Zöllner, Sack und Teller, sprachen sich einmütig gegen das Verbot aus, wenn auch vorwiegend aus Zweckmäßigkeitsgründen, die im Punkt 1 der preußischen Antwort deutlich hervortreten. Die kleine Bosheit von dem Dunkel, das die Fichtesche Philosophie umgebe, stammt aus dem Votum des Geheimrats Sack, des ehemaligen Erziehers des Königs. Am nachdrücklichsten und überzeugendsten war der rationalistische Zöllner für die Ablehnung des sächsischen Vorschlags eingetreten; auf ihn geht auch der ideelle Gesichtspunkt zurück, der in Punkt 3 hervortritt: die Heiligkeit des Sittengesetzes, für die Fichte sich so begeistert einsetzte, so hatte Zöllner ausgeführt, müsse gerade als eine mächtige Stütze aller Religiosität betrachtet werden; deshalb hatte er geraten, abzuwarten und „durch Mitteilung der Bedenken die Aufhebung des Verbotes zu erstreben“. Mit den vier Gutachten des Oberkonsistoriums war das Departement des Auswärtigen aber schlecht zufrieden; um die Konfiskation wenigstens des inkriminierten Heftes glaubte es nicht herumzukommen. Das Oberkonsistorium aber blieb (4. März) bei seiner Meinung, damit nicht „die Grundsätze der Pressefreiheit, Zensur und Toleranz sehr bald in ihrer Festigkeit erschüttert und wir in die Notwendigkeit versetzt werden, selbige den Rücksichten auf hierüber abweichende Systeme anderer Höfe aufzuopfern“. Die Akten mit allen Gutachten gingen am 18. März an den König, und dieser trat am 25. März der Ansicht des Oberkonsistoriums ausdrücklich bei.
Diese Willensmeinung des jungen Königs, die dann vom Departement des Auswärtigen (Finkenstein, Alvensleben und Haugwitz) mit Benutzung der Gutachten des Oberkonsistoriums ausführlich begründet wurde, in ihrem vollständigen Wortlaut aber noch nicht gedruckt ist, sprach über alle Verbote philosophischer und theologischer Schriften, die aus dem Drang nach Wahrheit erwachsen, das denkbar schärfste Urteil aus und bewies mit überlegenem Scharfsinn, daß durch Gewaltmaßregeln, durch die Unterbindung der öffentlichen Aussprache für und gegen, die gesundheitsmäßige, das Schädliche auch wieder ausstoßende Entwicklung des Gedankenkörpers nur zum Schaden der Allgemeinheit aufgehalten und durch solche Stockungen weit mehr böses Blut erzeugt wird. Wenn auch Sachsen auf diese Aufforderung aus Berlin verlegen schwieg und das Verbot nicht zurücknahm, so bedeutete sie doch für Fichte eben die Rechtfertigung, auf die er Anspruch zu haben glaubte; sie ist ihm vielleicht auch nicht völlig unbekannt geblieben, denn als er Jena verließ und sogar in Rudolstadt nicht geduldet wurde, wandte er sich, seinen Plan einer Auswanderung nach Amerika aufgebend, nach Preußen; dort werde er, so hatte ihm der preußische Minister Dohm sagen lassen, „gedeckt vor den Bannstrahlen der Priester und den Steinigungen der Gläubigen“ leben können. Und als er im Juli 1799 in Berlin war und durch den ihm befreundeten Kabinettsminister v. Beyme fragen ließ, wie man über seine dauernde Niederlassung dort denke, kam die geradezu friderizianische Antwort: „Ist Fichte ein so ruhiger Bürger, als aus allem hervorgeht, und so entfernt von gefährlichen Verbindungen, so kann ihm der Aufenthalt in meinen Staaten ruhig gestattet werden. Ist es wahr, daß er mit dem lieben Gott in Feindseligkeiten begriffen ist, so mag dies der liebe Gott mit ihm abmachen, mir tut das nichts.“ Daraufhin löste Fichte Ende des Jahres seinen Haushalt in Jena auf, zog nach Berlin und wurde Preuße. Der Kosmopolit, der er ursprünglich war, wandelte sich bald zum glühenden Verteidiger der Nationalität als der Grundlage aller Staatsbildung, und aus seinem ehemals erträumten Weltbürgertum riß ihn die Schlacht bei Jena vollends heraus. So wurde er zum Verfasser der „Reden an die deutsche Nation“. —
Fünfundzwanzig Jahre später aber wurde unter demselben König ein Neudruck dieser „Reden an die deutsche Nation“, die schon bei ihrem ersten Erscheinen 1808 dem damaligen Oberkonsistorium gewaltiges Kopfzerbrechen verursacht hatten, als nicht mehr zeitgemäß durch den Zensor Grano verboten und dieses Votum durch das Oberzensurkollegium vollkommen gebilligt! Die Zeiten waren eben einmal wieder andere geworden!