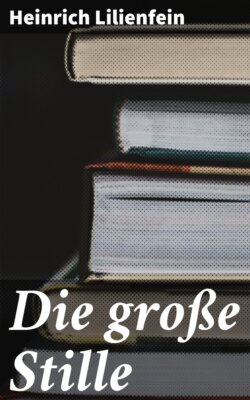Читать книгу Die große Stille - Heinrich Lilienfein - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
Anfangs hatte sich der Geheimrat mächtig gesträubt. In diesem Sommer wollte er von einer größeren Einladung bestimmt nichts hören. Einmal drängte es nicht, dann war es überhaupt ganz überflüssig.
Käthe, die es wagte, Anfang Juni direkt in die Höhle des Löwen zu gehen und ihm ein Gartenfest vorzuschlagen, wurde beinahe hinausgeworfen. Elli, die mitunter Andeutungen in die Unterhaltung warf — über das unerwartet schöne Wetter, über die wundervollen warmen Abende, über die Vorzüge, die es hätte, gerade jetzt, wo noch nicht alle Welt einem zuvorgekommen, gewisse Verpflichtungen zu erfüllen —, fand taube Ohren und bekam schließlich eine grimmige Bemerkung über die Vergnügungssucht junger Mädchen von heute an den Kopf. Marga dachte wohl manchmal daran, daß sie gern mit Doktor Perthes plaudern möchte. Aber sie schwieg. Es wäre zu ungewöhnlich gewesen, wenn sie, die stets widerstrebend an den häuslichen Gesellschaften teilgenommen, die Schwestern plötzlich unterstützt hätte.
Mitte Juni erklärte Vater Richthoff eines Morgens beim Frühstück, es sei doch merkwürdig, daß er an alles denken müsse. Warum man denn heuer die üblichen Einladungen nicht ergehen lasse? Da man ja doch in den sauren Apfel beißen müßte, wäre es das Netteste, die Jugend mal in den Garten einzuladen. Seine Mädels wären Schlafmützen.
Die Gescholtenen horchten hoch auf. Natürlich wagte niemand auch nur mit einer Silbe daran zu erinnern, daß man je selber an so was gedacht habe.
Elli, der das Herz im Leibe lachte, wandte ein Übermaß von Selbstbeherrschung auf, um nicht vom Stuhl aufzufahren. Es war nicht verwunderlich, daß sie Margas halbvolle Tasse umstieß. Käthe, praktisch wie sie war, wußte, daß eine solche Gelegenheit väterlicher Herablassung nicht wiederkehrte, und holte ihre Liste. Sie hub an, die Namen zu verlesen, und über die Morgenzeitung weg brummte der alte Herr zu den Vorgeschlagenen seine Zustimmung. Jetzt nannte sie Erich Wilkens.
„Hört in diesem Semester nicht bei mir,” erklärte ablehnend der Geheimrat.
„Aber er hat Besuch gemacht, Papa! Vorigen Sonntag!” fuhr es Elli heraus.
„Hat er?” gab der alte Herr gutmütig-spöttisch zurück und traf Elli mit einem scharfen Blick über die Brillengläser weg.
Elli ward rot bis über die Ohren. Sie mußte ihr Schuhband festknüpfen, um Verlegenheit und Enttäuschung zu verbergen. Marga strich leise beruhigend ihren Arm.
„Also nicht?” fragte Käthe mitleidig zögernd.
„Meinetwegen,” lautete der erlösende Bescheid.
Elli mußte vor Freude Margas Hand so überkräftig drücken, daß diese um ein Haar aufgeschrien hätte.
Doktor Perthes kam als letzter. Der Geheimrat hatte keine Ahnung mehr. Marga zuckte nicht mit den Wimpern, als Käthe ihm den Hemsbacher Arzt ins Gedächtnis brachte. „Ach der!” meinte er gedehnt. „Na ja — wenn Marga es nicht anders tut.”
„Du hast ja selbst gesagt, er soll auf die Liste kommen,” erklärte Elli kühn, um der Schwester zu Hilfe zu kommen.
Marga rührte sich nicht. Sie schien die Fransen an der Kaffeedecke zu zählen.
„Aber dann Schluß! Die Mädels dazu wählt gefälligst selber aus. Und mich laßt mit allem Drum und Dran aus dem Spiel. Kosten darf die Sache nichts, und stören darf sie mich auch nicht.”
Der Geheimrat erhob sich. Er war jetzt wieder ganz der gestrenge und unwirsche Herr und Gebieter, der sich nicht länger um solche Läppereien kümmerte. Fast schien ihm die Sache wieder leid zu tun.
„Nur noch den Tag, Papa!” bat Käthe. „Wir müssen doch wissen, wann dir's am besten paßt.”
Der Geheimrat war schon aus der Tür und stieg in sein Zimmer hinauf. Er hatte gestern in seiner Kaisergeschichte den segensvollen Titus porträtiert. Jetzt kam er zu dem unsympathischen und grausamen Domitian. Mit der Gnade und Milde war es zu Ende.
Doch zum Glück für das Haus ergaben Richthoffs erneute Forschungen, daß der böse Flavier unter seiner Großmannssucht und rohen Härte die besseren Anlagen seines Hauses wenigstens in seinen Anfängen nicht ganz verleugnete. So wurde es möglich, daß man dem Geheimrat doch auch noch den Termin für das geplante Gartenfest ablocken konnte.
Was gab es dann aber auch alles am Wenzelsberg zu tun! Die Einladungen mußten geschrieben werden. Es galt, den Lohndiener und die Kochfrau zu bestellen. Dann kam das Menü. Das las der alte Herr zwei Tage lang nicht, obwohl Käthe es ihm mit aller Liebe und Sorgfalt bei jeder Mahlzeit neben die Serviette legte. Am dritten Tage steckte er es in die Tasche und schickte es am fünften als völlig unbrauchbar zurück. Nur mit List konnte er schließlich gezwungen werden, Gegenvorschläge zu machen. Mit der Bemerkung, daß die Weibsleute nicht einmal von der Küche etwas verständen, ergriff er selbst das Kochbuch und verlangte die unmöglichsten Gerichte. Das Ungeheuerlichste war, daß er allen Einwendungen zum Trotz auf einer Suppe bestand, einer für eine Abend- und Gartengesellschaft allem Herkommen hohnsprechenden Ouvertüre. Er wollte in Italien eine Wildsuppe gegessen haben, die unbedingt ausprobiert werden mußte, ein unheimliches, höchst apartes Gemächte, von dem er sich für sich und seine Gäste Wunder versprach. Käthe konnte nicht mehr erreichen als ein Kompromiß: dafür, daß er die übrigen Gänge genehmigte, mußte ihm die abenteuerliche Suppe zugestanden werden.
Langsam kamen die Zu- und Absagen.
Je größer die Spannung war, mit der seine Mädels die Post erwarteten, um so weniger eilig hatte es der Geheimrat mit dem Öffnen der Briefschaften. Für Elli gab es Folteraugenblicke am Frühstückstisch. Sie hatte schon die Hoffnung aufgegeben, daß Wilkens käme. Endlich schrieb er zu. Doktor Perthes machte zwar eine korrekte sonntägliche Aufwartung, bei der er seine Karte abgab, aber zusagende Antwort schickte er erst am Abend vorher. Er entschuldigte seine Vergeßlichkeit, wollte aber gern kommen. Käthe konnte es nicht unterlassen, zu bemerken, daß Mediziner das „immer” so machten.
Marga blieb ihr eine Antwort schuldig. Es waren widersprechende Gefühle, mit denen sie an Perthes dachte. Sie verschloß das Hin und Her ihrer Empfindungen nicht nur vor anderen, sondern auch vor sich selbst. Es lag in ihrer Art, daß sie das Unklare und Unfertige von sich schob, weil es sie lähmte und schwächte. Ihre Seele brauchte in ihrer Einsamkeit ungeteilte Kraft, um gesund zu bleiben. Sie hatte ihn seit jener flüchtigen Begegnung am Fluß nicht mehr gesehen. Fast regelmäßig machte sie mit einer der Schwestern, meist mit Elli, gegen Abend einen Bummel. Früher waren sie oft die Uferstraße entlang gegangen. Marga ließ sich dann die Sonnenuntergänge bis ins einzelne schildern und genoß Farbe und Stimmung in ihrer lebendigen Phantasie. Jetzt mied sie diesen Gang. Die Zurückhaltung kostete sie mehr, als ihrem stillen Wesen anzumerken war. Es gab Augenblicke, in denen sie sich dabei überraschte, ein sicheres Bild von ihm zu gewinnen. Die Frage peinigte sie, ob er nur aus gewöhnlichem Mitleid, aus Zufall oder Laune sich ihrer erinnert hätte. Oder ob er ein gewisses Verständnis für ihr Wesen hätte, eine teilnehmende Freundschaft für sie empfände. Und derselbe Mensch sollte an einem leichtmütigen Geschöpf wie Hilde König Gefallen finden? Spielte er nur mit seinen Gefühlen? War er von Natur ernst und gehaltvoll? Oder war er oberflächlich und leer? Ihre Erfahrung gab ihr keine Auskunft. Und sie wollte keine. Sobald sie sich über unnötigen Grübeleien ertappte, dachte sie gewaltsam an anderes.
Je näher der große Abend des Gartenfestes kam, um so weniger fehlte es an Umtrieb und lustiger Geschwätzigkeit. Die Toiletten mußten zwanzigmal besprochen werden. Es wurde auf Leben und Tod genäht. Die Tischordnung gab eine Fülle von Stoff zu immer neuen Diskussionen. Bis endlich auch dieses Ereignis zur Wirklichkeit wurde.
Man hatte an kleinen Tischen im Hof gedeckt.
Das Haus mit seiner Rückwand von Reblaub und Glyzinen auf der einen, der blumenreiche, sommergrüne Weinberg auf der anderen Seite stimmten festlich zu den weißen Tafeltüchern. Den Tafelschmuck hatte Marga ausgedacht. Das war eine besondere Stärke von ihr. Sie gab ganz bestimmte Weisungen, wie sie jeden Tisch innerlich vor sich sah, und Elli führte sie unter lautem Beifall aus. Bald war es ein Gerank von Rosen, das den silbernen Aufsatz umschloß und in duftigen Ketten zwischen die Teller fiel, bald waren es zierliche Kränze von Stiefmütterchen, die die Gedecke besäumten, Sträuße von Margueriten oder blauem Akelei, die in den Servietten steckten. Leuchter mit winzigen bunten Lichtschirmen standen munter dazwischen, und Papierlaternen in gekreuzten Zügen überspannten den Hof von einer Ecke zur anderen. Der Geheimrat, der zufällig einmal während der Anordnung herunterschneite und den Kopf in den Hof streckte, brummte etwas von einer „Blumentrödelbude”, klopfte aber dabei Marga so kräftig auf den Arm, daß sie mit seiner Anerkennung zufrieden sein konnte.
Es war sechs Uhr geworden.
Die Zeit reichte gerade knapp hin, um sich anzuziehen, und die Mädels flogen nach ihrem Dachstock.
Fünf Minuten vor sieben standen sie fix und fertig im Salon. Marga und Elli trugen weiße Tüllkleider. Käthe als älteste prangte in leichter erdbeerfarbener Seide. Das beste war der frische, unschuldige Reiz der Jugend, der wie ein leichtes, helles Lachen von ihnen ausging, wie sie so am Flügel beieinanderstanden. Aus Ellis Augen blitzte der Schalk; in dem ungebärdigen Gewirr ihrer lichten Haare, mit ihrem schlanken, zierlichen Figürchen sah sie wie der Frühling selber aus. Käthe, ein Gewinde von Silberfiligran, ein Erbstück der Mutter, über den dunklen Flechten, gab sich etwas gemessener und selbstbewußter: sie fühlte sich halb und halb als Dame des Hauses. Zwischen beiden stand Marga: von der bezaubernden Leichtigkeit Ellis und der etwas herben Sicherheit Käthes war sie gleichweit entfernt: die weiche Lässigkeit ihrer Bewegungen und der versonnene Ernst ihrer Züge waren nicht dazu angetan, zu bestechen oder zu erobern. Sie wirkte wie ein Bild, das man übersehen zu haben glaubt, um nachher zu finden, daß es kraft eines unbestimmbaren inneren Reizes lebendiger als alle anderen im Gedächtnis haftet.
Noch immer kam Vater Richthoff nicht. Er hatte sich, natürlich zu spät, an seine Festtoilette gemacht. Dann war ihm mitten im Anziehen ein Gedanke gekommen, den er dringend für seine Kaisergeschichte notieren mußte. In einem mehr antiken als modernen Kostüm eilte er in das an sein Schlafzimmer anstoßende Arbeitszimmer und setzte sich an den Schreibtisch.
Die Klingel meldete den ersten Gast. Die Mädels im Salon waren in heller Bestürzung. Elli wagte es: sie schoß die Treppe hinauf und pochte an die Tür des alten Herrn.
„Bitte, bitte, Papa! Eil dich! Die Gäste kommen!” rief sie eindringlich und flehend.
Ein dumpfes Murren antwortete aus dem Arbeitszimmer.
„Es hat schon der erste geklingelt!” setzte Elli beschwörend hinzu.
„Wollt ihr wohl das verwünschte Gehetze lassen. Ich komme ja!” dröhnte es zürnend zurück.
Elli glitt wieder die Treppe hinunter.
Zum Glück war nur etwas für die Küche abgegeben worden.
Die Gäste ließen auf sich warten.
Als der Geheimrat einige Minuten später in den Salon trat — im flatternden Gehrock, die lange goldene Uhrkette auf der von Käthe zu Weihnachten und Ostern gestickten Weste, die dünnen weißen Haare über dem Scheitel und an den Schläfen festgestrichen —, erklärte er ganz empört: „Wo sind denn nun eure Gäste? Natürlich komme ich eine halbe Ewigkeit zu früh!”
Die halbe Ewigkeit dauerte kurz.
Schon öffnete sich die Tür, um sich nicht so bald wieder zu schließen. Im Handumdrehen füllte sich der geräumige Salon. Begrüßungen, Vorstellungen, Freundschaftsbezeugungen schwirrten durcheinander.
Da kam Papa Wilmanns, ein kleiner, lauter, lustiger, hinkender Altphilologe, und seine Gattin, ein stilles, ewig lächelndes, über ihren Mann verwundertes Frauchen. Hinter ihnen drei Töchter, alle flachsgelb von Haar, fast gleich in der Größe, gleich in den Augen und gleich in den lila- und weißgemusterten Kleidchen. Es ging die Sage, daß sogar ihre Eltern sie bisweilen verwechselten.
Der nächste war Trabner, der Flanellstorch, wie Elli der neben ihr stehenden Marga kichernd ins Ohr meldete. Er trug heute übrigens einwandfreie weiße Wäsche und einen Rock, der ihn nach oben und unten in die Unendlichkeit verlängerte. Sein pockennarbiges Vogelgesicht mit den paar Kinnstoppeln zuckte unaufhörlich, man wußte nicht, ob aus Ehrerbietung oder Nervosität. Der zwerghafte Papa Wilmanns sah staunend und beneidend an ihm hinauf. Als Trabner vor dem Geheimrat seinen jähen und tiefen Bückling machte, trat der gute Wilmanns unwillkürlich mit offenem Mund einen Schritt näher und streckte die Arme vor, als gelte es, einen Einsturz aufzuhalten.
Zwei Studenten, blauweiße Bänder um die Brust, blaue Mützen in der Hand, drängten sich nebeneinander zur Tür herein. Sie gehörten der Verbindung Corvinia an, die böse Zungen das „Betkränzchen” nannten und in Verruf brachten, Zuckerwasser statt Bier zu trinken. Elli verbarg sich hinter Margas Rücken und steckte das Taschentuch in den Mund, um nicht loszuplatzen. Inzwischen schritten die beiden in feierlich-plumpem Gleichtritt auf Vater Richthoff zu. Ihre forciert-couleurmäßige Haltung stand in so köstlichem Gegensatz zu ihrem ungehobelten Bauerntum, daß auch Käthe sich auf die Lippen biß.
Ein dicker, jovialer Burschenschafter, der mit seinem Leibfuchs, einem geckenhaften und schmächtigen Bengelchen, zufällig hinter den Corvinen ankam, zog über sein ganzes Gesicht, so rot und zerhauen, wie es war, eine Grimasse, als die Betkränzler beiseite traten. Mit freier, dröhnender Bierstimme begrüßte er Richthoff, der selber „alter Herr” bei einer Marburger Burschenschaft war.
Es trat eine kurze Pause ein. Noch waren nicht alle Geladenen zur Stelle. Aber der Zufluß zum Salon stockte einen Augenblick.
Es bildeten sich Gruppen. Der Flanellstorch verwickelte pflichtmäßig Käthe in ein Gespräch.
Elli und Marga plauderten mit den drei Wilmannstöchtern. Die zwei Burschenschafter traten kühn dazu und erzählten von ihrer nächsten Damenkneipe. Die zuckerwassersüchtigen Corvinen umstreberten Professor Wilmanns und den Geheimrat, während Frau Wilmanns sich selbstgenügsam in ein Familienalbum vertiefte, das auf dem Tisch lag.
Schon tat sich die Tür wieder auf.
Ein derber, struppiger Kopf ward sichtbar, und ein paar runde, graue Augen rollten zwischen unbändigen Büscheln gelblichweißen Haares heraus über das menschenvolle Zimmer.
„Sieh da — Borngräber!” begrüßte Richthoff mit vergnügtem Ruf den Ankömmling.
In komischer Verzweiflung stürmte Professor Borngräber, ein alter Hausfreund, Junggeselle und Indolog, auf den Geheimrat los.
„Aber um Gottes willen! Ihr habt ja richtige Gesellschaft! Ich denke, wir sind drei, vier Personen!” rief er mit hoher, klagender Fistelstimme, während er dem alten Herrn die Hand schüttelte. „Ich bin ja gar nicht feierlich angetan!” Er wies auf seinen moosgrünen, verknitterten Bratenrock, der ihn nicht gerade Lügen strafte.
„Macht ja nichts, alter Freund! So feierlich wird die Sache gar nicht,” versicherte Richthoff beruhigend.
„Ich drücke mich! Hörst du? Ich zieh' mich um!”
„Dageblieben!” Richthoff hielt lachend seine Hand fest.
„Sie haben ja gar keine andere Toga,” schmunzelte Papa Wilmanns boshaft.
Borngräber überhörte ihn entrüstet. Er schlug die Hand vor den Kopf, beteuerte seine Unschuld und widerstrebte nicht mehr. Er kam immer so wie heute. War immer außer sich und wollte fort. Und blieb immer, wenn man ihm gut zuredete.
Jetzt reckte Elli den Kopf. Sie stellte sich auf die Zehen.
Drüben unter der Tür reckte sich ein anderer Kopf ihr entgegen. Blond und kraus wie der ihre. Ein lachendes, verschmitztes Gesicht. Zwei strahlende, siegesgewisse Augen, die in die ihren tauchten. Das war Wilkens.
Kaum war diese stillschweigende Begrüßung erfolgt, so tuschelte Elli mit Marga.
„Doktor Perthes! Dein Doktor von Hemsbach!” verkündete sie, noch aufgeregt von dem Glück, Wilkens gesehen zu haben.
In der Tat zeigte sich Perthes' hochgewachsene Gestalt gleich hinter Wilkens in der Tür. Sein brauner, bärtiger Kopf ragte über die anderen hinaus. Nur der Flanellstorch konnte sich mit ihm messen. Mit dem suchenden Lächeln des Fremdlings überschaute er das Gedränge. Er hatte sich schnell orientiert. Nach Wilkens trat er auf den Geheimrat zu und begrüßte ihn mit unbefangener Höflichkeit.
Der alte Herr sah ihn einen Moment fragend an. Dann besann er sich und schüttelte Perthes die Hand. „Marga erinnert sich Ihrer. Nett, daß Sie kommen. — Kleinchen!” Er erwischte die eben vorbeihuschende Elli an einem Zipfel ihres Ärmels, ehe sie zu dem ersehnten Wilkens durchschlüpfen konnte. „Herr Doktor Perthes — meine Jüngste,” stellte er vor, während er ihr den Arm um die Schulter legte. „Führ' ihn mal zu Marga!” Er deutete aufgeräumt nach der Seite, wo sie stand. Dann mußte er neue Gäste begrüßen: Frau Geheimrat Achenbach, die Witwe eines Kollegen, eine stattliche alte Dame mit gütigen Augen unter schneeweißen Scheiteln, auf einen Krückstock sich stützend; weiterhin einen ehemaligen Schüler und jetzigen Privatdozenten, Bertelsdorf mit Namen, der es kaum erwarten konnte, bis er mit blinzelnder, katzbuckelnder Höflichkeit an die Reihe kam, seinen Gruß anzubringen.
Inzwischen drängelte sich Elli, gewandt wie ein Wiesel, durch die einzelnen Gruppen, Perthes mit übermütigen Gebärden hinter sich her winkend.
Marga stand an der Tür zum Wohnzimmer. Sie hatte sich dorthin zurückgezogen, weil sie sich in dem Geschwirre der Menschen überflüssig vorkam. Es fiel niemand auf, daß sie beiseite trat. Die drei Wilmannsmädchen lachten auch ohne sie über die Aufschneidereien der beiden Burschenschafter. Einsam, mit einem halben, verlorenen Lächeln lehnte sie im Rahmen der Tür.
„Da bring' ich dir Herrn Doktor Perthes, Margakind!” rief ihr Elli schon von weitem entgegen.
Marga richtete sich auf.
„Guten Abend, Fräulein Marga!” begrüßte sie Perthes kameradschaftlich. „Wir haben uns ja furchtbar lange nicht gesehen. Ich dachte immer, ich würde Ihnen mal wieder begegnen. In der Stadt, am Ufer oder sonstwo —”
„Wir sind früher oft dort gegangen,” sprudelte Elli naseweis hervor. „Aber neuerdings — ich glaube, seit Marga Sie dort getroffen hat, will sie partout nicht mehr hin.”
„Aber Elli!” wehrte sich Marga. Doch die Missetäterin war schon lachend davongewischt, um endlich zu ihrem Wilkens zu kommen.
„So, so, Fräulein Marga — Sie weichen mir also aus!” neckte Perthes. „Und warum denn, wenn ich fragen darf?”
„Aber das Kleinchen hat Sie ja angeschwindelt,” erklärte sie ernsthaft.
„Und ich komme Ihretwegen in eine richtige Gesellschaft. Obwohl ich mir vorgenommen hatte, hier gar nichts mitzumachen.”
„Das ist immer noch etwas anderes, als wenn ich Ihretwegen an den Fluß käme,” erwiderte Marga. Ihr Ton war abweisender, als sie wollte. Sie fand sich nicht in eine tändelnde Unterhaltung. Aller Scherz nahm nur schwer den Weg zu ihrer Seele; er machte sie eher scheu und verschlossen als zutraulich. Sie hatte sich wieder an den Türpfosten gelehnt und blickte zu Boden. Ihre ruhige Stirn kräuselte sich einen Moment: ihr offenes Gesicht war nicht darin geübt, ihre Gedanken zu verbergen.
„Was dachten Sie jetzt eben?” forschte Perthes. „Sicherlich nichts Gutes über mich.”
„Sie sind aber eingebildet, Herr Doktor!”
„Ich — wieso?”
„Als ob es nichts anderes zu denken gäbe als —” Marga vollendete den Satz nicht; sie erschrak über ihre eigenen Worte. Sie kamen ungerufen aus ihr hervor. Warum war sie so unfreundlich zu ihm? War sie denn kleinlich? Er hatte von diesem Ufergang gesprochen, von dem sie wußte, daß er einer anderen galt. Es waren nur liebenswürdige Redensarten, wenn er sie damit in Verbindung brachte. Weshalb seine Spielerei? Und doch — als er nun schwieg — tat ihr ihre Äußerung leid. Ohne ihn zu sehen, fühlte sie, daß er sich von ihr weggewandt hatte.
Er schaute in der Tat abgekehrt, mit gekreuzten Armen, auf die vielen schwatzenden Menschen im Salon.
„Sie sind mir doch nicht böse, Doktor Perthes?” fragte Marga mit veränderter, bittender Stimme.
„Warum denn? Ich wundere mich nur, daß Sie heute gar nicht nett zu mir sind.”
„Bin ich das wirklich nicht?”
„Wirklich nicht!” wiederholte er überzeugt.
„Wenn ich Ihnen gesagt hätte, was ich dachte, würden Sie noch unzufriedener mit mir gewesen sein.”
„Oho! Also war's doch was Schlechtes.” Lachend wandte sich Perthes wieder zu ihr.
Margas Züge drückten Unruhe und Verwirrung aus. Die erloschenen Augen mit ihrem sanften blauen Glanz schienen gewaltsam das Dunkel durchdringen zu wollen, um den Ausweg aus diesem unglücklichen Gespräch leichter zu finden. Dann nahm sie die Zuflucht zu ihrer natürlichen Offenheit. „Ich dachte, daß Sie in der Uferstraße jemand anders suchten als mich. Das war alles,” sagte sie kurz und einfach.
Perthes sah sie erstaunt an. Sie wußte also auch bereits, was Markwaldt und alle seine Bekannten wußten — daß er Hilde König nachstieg. Und er durfte ihr nicht einmal böse sein, daß sie es ihm sagte. Er hatte ihr ja ihre Gedanken abgezwungen. Wie peinlich und unbequem diese Mitwisserschaft war! Gerade hier. Er griff sich mit der gebräunten, sehnigen Hand heftig in den Bart. Die Falten auf der Stirn zuckten nervös zwischen den dichten Brauen.
Zum Glück gab jetzt der Geheimrat das Zeichen zu Tisch, indem er Frau Wilmanns den Arm bot.
„Darf ich Sie zu Tisch führen?” fragte Perthes Marga mit einer kurzen Verbeugung.
Sie nickte. Schweigend legte sie ihren Arm in den seinen. Sie wußte nicht, sollte sie sich freuen, daß er sie führte, oder nicht. Sie bereute, daß sie sich hatte verleiten lassen, die Wahrheit zu sagen. Warum hatte er sie gezwungen, und sie sich zwingen lassen?
Plaudernd bewegte sich der Zug der Paare durch das Wohnzimmer und die Eßstube.
An Richthoff und Frau Wilmanns schlossen sich Professor Borngräber und Frau Achenbach, ein sehr ungleiches Paar: sie majestätisch und gemessen, er voll Unbeholfenheit immer einen Schritt voraus oder zurück. Als langjährige Bekannte waren sie trotzdem beide sehr zufrieden miteinander.
Papa Wilmanns bat sich ein für allemal, wohin er kam, ein junges Mädchen zu Tisch aus. Heute, wo man, um der Gemütlichkeit keine Vorschriften zu machen, von einer festgesetzten Tischordnung abgesehen hatte, waren die Jungen schneller gewesen als er und hatten sich schon alle zusammengefunden. Er sah sich verurteilt, Fräulein Grasvogel, eine dürre, etwas spinöse Cousine des Richthoffschen Hauses, die man aus Gutmütigkeit bei keiner Einladung überging, für sich zu erobern. Der kleine lustige Mann, der außerhalb seines Lehramts stets voller Schnurrpfeifereien steckte, schritt mit weltschmerzlicher Biedermannsmiene am Arm der Cousine. In dem beweglichen Gesicht, das sonst so behaglich mit der Hakennase, den Augen einer listigen Spitzmaus und den rosigen Wangen zwischen dem fröhlichen Backenbart saß, lag eine so vorwurfsvolle Anklage, daß Elli, die mit Wilkens hinter ihm kam, nur mühsam ihren Ernst behaupten konnte. Sie nahm sich nur zusammen, weil Käthe mit dem überhöflichen Privatdozenten Doktor Bertelsdorf zur Rechten und dem Flanellstorch zur Linken ihr auf dem Fuße folgte. Käthe war schon durch die in letzter Minute erfolgte Absage Lizzies, ihrer Musikfreundin, betrübt. Elli wollte sie nicht noch durch eine Neckerei erzürnen, die sie auf das seltsame Doppelgestirn ihrer Tischherren beziehen konnte. Der Privatdozent hatte nämlich Käthe dem Flanellstorch vor der Nase weg engagiert; darüber war dieser so fassungslos, daß er sich, kurz entschlossen, rechts von ihr postierte und mit seinem Partner über Käthes Kopf hinweg einen Disput vom Zaun brach — über eine neue Textausgabe von Dio Cassius!
Marga mit Doktor Perthes, die Schwestern Wilmanns mit den Burschenschaftern und Corvinen, einige damen- und couleurlose Philologen im ersten und zweiten Semester beschlossen die Reihe.
Es war noch taghell im Hof, und man hatte deshalb die Kerzen noch nicht angebrannt.
Die Heiterkeit der blumengedeckten Tische steckte an. Man stürmte die Plätze.
Die älteren Herrschaften, die in ihrer engen Auslese als nächste Hausfreunde der Jugend nur zur Folie dienen sollten, hatten ihren Tisch für sich gewählt. Eine Ausnahme machte nur Papa Wilmanns, der die Cousine Grasvogel mitten unter die Jungen hineinschleppte.
Elli mit Wilkens winkte Marga und Doktor Perthes zu sich heran, denen sie an ihrem Tisch heldenhaft zwei Stühle verteidigte. Perthes hatte Marga auf der einen, Elli auf der anderen Seite. Außer Wilkens saßen noch der dicke Burschenschafter mit Heddy, der jüngsten der drei Wilmannstöchter, und Wilmanns selbst mit Fräulein Grasvogel am gleichen Tisch.
Käthe und ihr Privatdozent machten einen entschlossenen Versuch, den Flanellstorch loszuwerden. Sie gerieten dafür mit den Corvinen an eine Tafel.
Es dauerte eine gute Weile, bis die ganze Gesellschaft ihre Plätze innehatte.
Endlich war es so weit, daß der Lohndiener unter Beistand einer Aufwartefrau mit dem Servieren der Speisen beginnen konnte.
Die Wildsuppe, auf der Vater Richthoff so ehern bestanden hatte, dämpfte mit ihrer grausamen Würze für einen Augenblick die allgemeine Fröhlichkeit. Jedermann würgte sie zwar tapfer hinunter, aber man sah doch unterschiedliche Spuren einer gewaltsamen Selbstüberwindung. Nur der Flanellstorch, der aller Vorsehung zum Trotz einen Stuhl neben Käthe gezwängt hatte, erklärte mit der Stimme eines Domküsters, flüsternd und doch allhörbar, er habe nie so etwas Köstliches gegessen.
„Finden Sie das auch?” fragte Elli blinzelnd ihren Nachbar Wilkens. „Papa hat sie befohlen!”
Wilkens drehte statt der Antwort die Augen gen Himmel und legte die Hand auf den Magen.
Papa Wilmanns dagegen konnte die lose Zunge nicht im Zaum halten. So vernehmlich wie der Flanellstorch und mit einer Überzeugungskraft, die fürs erste alle täuschte, durchschnitt er die schweigende Beklommenheit. „Kollege Richthoff, ich denke, Sie werden meiner Frau das Rezept für diese klassische Suppe nicht vorenthalten. Sie kann nur von der Blutsuppe der Spartaner übertroffen werden!”
Die Verdutztheit auf allen Gesichtern löste sich in einem, von unterdrücktem Kichern zu lautem und lauterem Gelächter anschwellenden Heiterkeitsausbruch, dem sich niemand, selbst nicht das entsetzte Fräulein Grasvogel, entziehen konnte.
„Aber Rudolf!” erklang tadelnd die Stimme von Frau Wilmanns über den Hof zu ihrem Gatten, der sich, als wüßte er von nichts, in seine Vatermörder zurückgeduckt hatte.
Geheimrat Richthoff beruhigte seine Tischnachbarin mit einer gravitätischen Gebärde, erhob sich, strich den weißen Bart, tippte hell ans Glas und verschaffte sich Gehör.
„Verehrte Gäste und Freunde!” hub er mit grollendem Ton an. „Der gehässige Vorstoß, den mein Kollege Wilmanns soeben gegen meine Suppe unternommen hat, zwingt mich zu einer wissenschaftlichen Entgegnung. Mein Freund Wilmanns” — er fixierte den Professor durchbohrend — „ist, wie Sie alle wissen, der Mann der lateinischen und griechischen Syntax, also der grauesten, leblosesten Grammatik. Daraus entschuldigt sich seine völlige Unberührtheit in Dingen der Geschichte und des feineren Lebensgenusses. Nur ihm konnte es passieren, meine feurige südländische Wildsuppe mit der Blutsuppe der Spartaner in einem Atem zu nennen. Seine Spartanersuppe ist, wie jetzt männiglich außer ihm weiß, erstens eine Legende und zweitens eine geschmacklose Wurzel- und Kräutersuppe. Also genau das Gegenteil von meiner Suppe. Doch diese historische und kulinarische Zurechtweisung nur nebenher. Überzeugender als der Angriff des Kollegen Wilmanns ist das Urteil, das ich Ihnen allen, meine Herrschaften, von den Zügen ablese: es bedeutet rückhaltlose Anerkennung meiner Suppe! Es schlägt auch den frevelhaften Widerspruch meiner Töchter zu Boden, die, ihres Vaters kochkünstlerische Autorität verkennend, die Wahl jeder und erst recht dieser Suppe verhindern wollten. Um so dankbarer bin ich meinen Gästen für ihre gerechte und sachliche Würdigung. Stoßen Sie mit mir an auf das Wohl meiner Gäste!”
Lachender Beifallsruf und lautes Gläserklingen antwortete dem alten Herrn von allen Tischen. Sein grollender Humor, seine behagliche Selbstironie hatten die gute Stimmung nicht nur wiederhergestellt, sondern erhöht. Die Unterhaltung an allen Tischen kam in lauten, fröhlichen Gang.
Ellis frische Laune war unerschöpflich. Sie und Papa Wilmanns, der sich über Richthoffs Suppenrede königlich gefreut hatte, waren an ihrem Tisch abwechselnd die Wortführer. Wilmanns gab ergötzliche Abenteuer von seiner letzten griechischen Reise zum besten. Er und Borngräber waren zusammen gereist. Sie lagen sich alle Tage morgens über eine Fachfrage in den Haaren und abends bei begeisterndem Hellenenwein in den Armen. Als Wilmanns gerade erzählte, wie sein Gefährte beinahe von einem griechischen Schergen festgenommen worden wäre, weil er durchaus auf der Akropolis eine Nacht zubringen wollte, flüsterte Elli Doktor Perthes zu: „Ich glaube, die ganze griechische Reise hat er nur auf der Landkarte gemacht.”
„Das wollen wir nicht hoffen!” meinte Perthes lächelnd.
„O, Sie kennen die Philologen nicht! Die flunkern alle!” erklärte sie überzeugt. „Wenn ich denke, was nur Wilkens” — sie warf einen vielsagenden Seitenblick auf ihren Tischherrn —, „was der mich schon angeführt hat! Schon zehnmal hat er behauptet: ‚Diesmal steig' ich ins Examen! Diesmal bau' ich bombensicher meinen Doktor!‛ Und zehnmal war's Schwindel!” Ein ganz leiser Seufzer begleitete unwillkürlich den zehnfachen Schwindel.
„Und das geht Ihnen so zu Herzen?” fragte Perthes.
„Mir? Zu Herzen? Wie kommen Sie darauf? Mir geht überhaupt nichts zu Herzen!” verteidigte sich Elli empört. „Von mir aus kann Herr Wilkens zehnmal durch sein Examen fallen. Nicht wahr, Herr Wilkens?”
Der Angeredete schmunzelte nur und drehte sich herausfordernd zu Heddy Wilmanns.
„O, und die anderen Fakultäten,” fuhr Elli zu Perthes fort, „die haben andere Fehler! Die Mediziner zum Beispiel — die sind boshaft, wie Sie! Und schrecklich roh und materialistisch!”
„Hören Sie, wie ich beschimpft werde, Fräulein Marga?” wandte sich Perthes nach rechts, wo Marga geduldig, im Verein mit Cousine Grasvogel, noch immer Wilmanns' griechische Reise miterlebte.
„Wehren Sie sich nur tüchtig!” gab sie zurück.
„Also Sie verteidigen mich nicht einmal? Sie geben am Ende gar Ihrer Fräulein Schwester recht?”
„Um Sie zu verteidigen, müßte ich Sie erst besser kennen!” erwiderte Marga freundlich, aber bestimmt.
„Wie mißtrauisch Sie sind!”
„Mißtrauisch? Marga?” ereiferte sich Elli. „Na, Herr Doktor Perthes, da gratuliere ich Ihnen zu Ihrer Menschenkenntnis! Die ist die Offenste von uns allen! Aber sie flunkert auch! Die schlechte Nachbarschaft —” Sie zwinkerte nach Wilkens und zu Professor Wilmanns hinüber.
„Ich glaube, du bist beschwipst, Elli!” warf Marga vorwurfsvoll ein.
„Noch nicht! Aber wenn du sagst, Margakind, du kennst Herrn Perthes nicht, flunkerst du. Sie kennt nämlich die Menschen in- und auswendig, wenn sie noch nicht zwei Worte mit ihnen gewechselt hat!”
„Fräulein Marga! Wenn das stimmt, sind Sie mir Genugtuung schuldig. Ich möchte schon immer gern wissen, wer ich bin.” Perthes legte etwas Spöttisches in seine Rede, das ebensogut Marga als ihm selbst gelten konnte.
Marga schüttelte leise den Kopf. „Nein, nein — Sie müssen sich selber am besten kennen.”
„Muß ich das?” erwiderte er im selben Ton wie zuvor.
„Dafür sind Sie doch ein Mann,” war Margas halblaute, entschiedene Antwort. Sie zerkrümelte ihr Brot. Ihr Mund war fest geschlossen. Nur das Zittern ihrer Nasenflügel verriet etwas von innerer Erregung. Warum quälte er sie mit so merkwürdigen Fragen? Was konnte ihm daran liegen, wie sie ihn beurteilte? Warum drängte er sich hartnäckig und eigensinnig in ihr Sinnen und Empfinden, um sich und sie zu ergründen? Gewiß, er dachte sich dabei nichts. Er mochte sich in dieser spielerischen Unterhaltung gefallen. Aber sie, Marga, war sich dafür zu gut! In der Furcht, sich und ihr Innenleben unnötig auszugeben, verkroch sie sich in sich selbst, wie eine Schnecke in ihr Gehäus.
Perthes schwieg. Er beobachtete Marga länger und ernsthafter als sonst. „Dafür sind Sie doch ein Mann” — was hieß das? War das ein Zweifel an seiner Reife? Oder war es eine Anerkennung? Dieses so stille und so klare Wesen der Blinden, für die er eine flüchtige, aus Interesse des Arztes und aus mitleidsvoller Teilnahme gemischte Sympathie empfand, begann ihn zu fesseln, weil es ihn reizte. Der Widerspruch zwischen seiner eigenen Zerrissenheit und ihrer ruhigen Geschlossenheit brachte bei ihm eine zwiespältige Wirkung hervor. Das Peinliche überwog das Anziehende. Bah — er würde sich wohl von einem jungen Mädchen imponieren lassen! Was war rätselhaft an ihr? Höchstens, was er aus seiner eigenen Phantasie hinzutat. Sie war wie andere Frauen: nur durch ihren Zustand ein wenig empfindsamer. Es erklärte sich physiologisch wie alles Weibliche.
Elli hatte es inzwischen für zeitgemäß gehalten, ihren Wilkens, der um die Wette mit den Burschenschaftern Heddy Wilmanns den Hof machte, entrüstet zur Rede zu stellen. Wilkens erklärte mit seiner heiteren Unverwüstlichkeit, da er nach ihrer wohlwollenden Ansicht schon einmal ein Flunkerer sei, sei es doch völlig gleichgültig, ob er nach rechts flunkere oder nach links. Elli schmollte eine ganze Minute lang. Dann fand sie sich mit Wilkens in einem versöhnend-heftigen Händedruck unter dem Tisch. Nach dem Friedensschluß wandte sie sich wieder zu Perthes. „Was treiben Sie denn eigentlich hier?” fragte sie in ihrer übergangslosen, zufahrenden Art, als sie bemerkte, daß das Gespräch zwischen ihm und Marga bedenklich im Stocken war.
„Wo? Wie? Hier — wie meinen Sie das?” Perthes richtete sich zerstreut aus seinen Gedanken auf.
„Na, in Ihrem Laboratorium oder Institut oder wie das Ding heißt!” erläuterte Elli ihre unbestimmte Frage.
„Wenn Sie das interessiert, müssen Sie mich mal besuchen. Ich habe einen ganzen Stall Kaninchen und Meerschweinchen. Mitunter auch Mäuse und Ratten.”
„Wozu denn das?” forschte Elli mit gruseliger, ungläubiger Neugier.
„Ich experimentiere mit ihnen.”
„Hörst du, Marga? Er experimentiert mit Tieren! Was hab' ich gesagt! Mediziner sind entsetzlich roh und gefühllos! — Was machen Sie denn mit den armen Tierchen?”
Für Perthes konnte in seiner gegenwärtigen Stimmung keine Frage gelegener kommen. Es war ihm eine Genugtuung, sich nüchterner und gefühlloser zu zeigen, als er war. Auf die Gefahr hin, den Geschmack zu verletzen, gab er sich als den kühlen, überlegenen Wissenschaftler und beschrieb rücksichtslos seine Versuche an lebenden Tieren: wie er ihnen die verschiedenen Gifte einimpfte, Gegengifte erprobte, die Wirkungen von Stunde zu Stunde beobachtete.
Elli war außer sich vor Mitleid und Empörung. „Sie sind ja ein gräßlicher Tierquäler! Und so was machen Sie mit ruhigem Blut? Was müssen Sie für ein Mensch sein!” Ganz erschrocken blickten ihn ihre strahlenden jungen Augen an.
„Das gehört bei uns zum Handwerk!” versicherte Perthes mit Achselzucken. „Wir können ja leider nicht mit Menschen unsere Experimente machen.”
„Leider!” Elli fuhr von ihrem Sitz in die Höhe. „Leider, sagen Sie? Aber das ist ja abscheulich! Dafür könnte ich Sie —” Sie machte eine drastische Bewegung und hielt inne. Sie mußte selbst über ihre Entrüstung lachen. „Und wir sollen Sie besuchen? Ihre Schändlichkeiten mit ansehen? Was sagst du zu dieser Einladung, Margakind?!”
Marga sagte nichts. Sie fühlte, daß Perthes sich mit Absicht schlecht machte. Er übertrieb. Er wollte sein objektives Medizinertum hervorkehren. Er tat sich und anderen mit Bewußtsein wehe. Die Erkenntnis dieser Zwiespältigkeit, dieser unfertigen Halbheit schmerzte sie mehr als seine harten Ausdrücke, seine rohen Schilderungen. Mit unwiderstehlicher Macht überkam sie das Gefühl ihrer Einsamkeit inmitten all der fremden, geräuschvollen Menschen, die in einer Welt lebten, die nicht die ihre war. Sie fror. Wie in einen schützenden Mantel hüllte sie sich in ihre schwere und doch so viel reichere Einsamkeit. Teilnahmlos lehnte sie sich in ihren Stuhl zurück und richtete die Augen in die Ferne.
Elli, die einzige, die mit schwesterlicher Liebe Margas Wesen wenn auch nicht ganz erfaßte, so doch kannte und achtete, drang nicht weiter in sie.
Auch Perthes verstummte.
„Ihr Wohl, Herr Kollege!” prostete der Burschenschafter mit tadellosem Komment und unverkennbarer Hochachtung zu ihm herüber. Er hatte mit halbem Ohr die Unterhaltung gehört und wollte als jüngeres medizinisches Semester dem älteren seine bewundernde Zustimmung zu dem Ideal fachmännischer Gesinnungstüchtigkeit ausdrücken.
Perthes dankte. Er stürzte sein Glas Wein in einem Zug hinunter. Seine Stirn hatte sich verfinstert. Er war verärgert. Er haderte mit sich, weil er sich hatte fortreißen lassen.
Es war eine Erlösung, daß jetzt gleichzeitig zwei Messer an zwei verschiedenen Tischen an die Gläser klangen.
Die beiden Redner, die sich zu Wort meldeten, erhoben sich miteinander und maßen sich mit erstaunten Blicken: es waren Professor Borngräber und Professor Wilmanns, die in einem und demselben Augenblick um die oratorische Palme rangen.
Papa Wilmanns war sonst nicht auf den Mund gefallen. Aber gerade seinen vielverleumdeten griechischen Reisefreund konnte er nicht ohne Verblüffung als Rivalen auftauchen sehen. Und seine Frau warf ihm überdies aus der Ferne einen so flehenden Blick zu.
„Dann werd' ich die Herrschaften eben nach Freund Jakobus langweilen!” murmelte er mit trockener Gutmütigkeit und setzte sich wieder.
Borngräber begann mit seiner hohen, beharrlichen Stimme. Er zitierte einen indischen Spruch über die Freuden der Häuslichkeit. Man durfte hoffen, er würde von dort aus in Kürze und ohne Fährlichkeiten auf das Haus Richthoff kommen. Aber es war anders verhängt. Jakobus Borngräber war nicht der Mann der geraden Fahrstraßen. Bei einem neuen östlichen Sprichwort, das mit dem Ziel seines Toastes schon wesentlich loser zusammenhing, fiel ihm ein, daß er über die Übersetzung gerade dieses Textes mit einem französischen Kollegen in Kontroverse geraten war. Das Unheil war da: er vergaß völlig seine ursprüngliche Absicht, entwickelte mit einer zähen Leidenschaftlichkeit, die im umgekehrten Verhältnis zu seinen Stimmitteln stand, das Für und Wider beider Auffassungen und geriet in eine Vorlesung über vergleichende Textkritik.
Die Gäste sahen sich verwundert an. Da und dort wurde nervös geräuspert. Ein unterdrücktes Lachen wurde gehört. Einzelne fingen an, sich leise, dann lauter zu unterhalten. Dies Beispiel fand jähe, fast allgemeine Nachfolge. Während der Tisch der Alten eine achtungsvolle Ruhe behauptete, hörten von der Jugend bald nur noch der Flanellstorch aus Pietät gegen alles Akademische und die beiden Corvinen aus zuckerwässeriger Wohlerzogenheit dem Redner zu. Sogar Bertelsdorf, dem Privatdozenten, der für die Ordinarien seiner Fakultät einen unbegrenzten Fonds von Ehrfurcht besaß, schien der Wein eine charaktervolle Unabhängigkeit zu geben; er plauderte ungeniert mit Käthe. Wilmanns unterhielt seinen Tisch damit, daß er unter seinen Fingern eine Menagerie aus Brot gekneteter Wundertiere hervorgehen ließ. Wilkens unterstützte den Professor mit ebenbürtigen Kunststücken: er balancierte Zahnstocher auf der Nasenspitze und ließ Brotstückchen, die er über die Fingerspitzen legte, durch einen geschickten Schlag auf seinen Unterarm in den Mund schnellen.
Die Dämmerung hatte begonnen. Die Lichter auf den Tischen und die farbigen Lampions, die in Ketten über den Hof gespannt waren, waren schon seit geraumer Weile angezündet. Die weißen Tafeltücher, auf denen jetzt Kuchen und Früchte vorherrschten, die roten Leuchterschirmchen, die helldunklen Gesichter setzten sich warm und farbenvoll ab gegen das wachsende Dunkel im Weinberg und in den benachbarten Gärten. Darüberhin taumelten ein paar verspätete Käfer. Der Himmel strahlte in einem zarten, milchigen Blau. An dünnen Wolkenstreifen glomm noch ein später Schimmer der gesunkenen Sonne.
Endlich hielt Jakobus Borngräber plötzlich im Strom seiner Rede inne. Die immer ohrenfälligere Unaufmerksamkeit seiner Zuhörer machte ihm nun doch seine Abirrung mit jähem Schreck klar.
Die majestätische Frau Achenbach, seine Tischdame, hatte Gleichmut und Humor genug, um ihm beizuspringen. „In diesem Sinne —” soufflierte sie ihm.
„In diesem Sinne —” stotterte Borngräber und schwang sich mit einem verzweifelten Überschlag seiner Stimme aus dem Wirrsal seiner textkritischen Betrachtungen auf die dargebotene, allumfassende Redewendung: „In diesem Sinne bitte ich Sie, sich zu erheben und zu rufen: Unser verehrter lieber Richthoff und sein gastliches Haus, sie leben hoch!”
Ein schallendes dreifaches Hoch und ein allgemeines Gläserklirren verschlangen Redner und Rede. —
Nach so langer Geduldsprobe wollte sich der frühere Tafelzwang nicht wiederherstellen lassen. Der Tisch der Alten erkannte die Situation richtig, und ehe Papa Wilmanns seine unterdrückte Rede auch noch loslassen konnte, erhoben sich die Herrschaften.
„Ich wünsche gesegnete Mahlzeit!” klang die kräftige Stimme des Geheimrats über den Hof hin.
Zwanglos verteilten sich die Gruppen.
Die Jugend stieg in ihrer Mehrzahl den Weinberg hinan, dessen Wege weit hinauf mit Papierlaternen beleuchtet waren.
Die Alten zogen sich in die Zimmer zurück, bis im Hof die Tische geräumt waren. Die zwei Corvinen und der Flanellstorch hielten jetzt den Zeitpunkt für gekommen, um bei Vater Richthoffs Zigarren ihre Professoren zu poussieren.
Marga war mit im Weinberg emporgestiegen. Perthes hatte sich artig angeboten, sie zu führen. Sie dankte. Darauf gesellte er sich dem ausgelassenen Schwarm zu, den Elli und Wilkens anführten. Dazu gehörten die drei Wilmannstöchter, die Burschenschafter und auch Käthe mit Bertelsdorf.
Auf der Graswiese, wo hinter dem Blumengarten das Obstgelände begann, war es noch heller als in den tieferen Partien des Weinbergs. Elli schlug ein Spiel vor. Sie fand laute Zustimmung. „Hasch, hasch!” wurde nach kurzer Überlegung gewählt, und die Paare traten lachend in die Reihe. Perthes holte sich Heddy Wilmanns. Das Tollen begann, und leuchtend stoben die hellen, fliegenden Mädchenkleider durch die Dämmerung.
Marga stand abseits. Einen Augenblick hatte sie gedacht, es würde jemand zu ihr treten, um sie zu unterhalten. Aber niemand kam. Wie es meist ging, wurde sie und ihre Blindheit jetzt in der allgemeinen Lustigkeit vergessen. Im Grunde war es ihr recht.
Die Geselligkeit solcher Abende ermüdete sie mehr und schneller als andere. Und ihre innere Einsamkeit hatte sich nach der äußeren gesehnt.
Tastend orientierte sie sich an den Johannisbeersträuchern längs des Weges. Dann stieg sie sicher bergan.
Hinter dem Obstplan kam eine Mauer, die das steile Erdreich stützte. Eine Treppe aus Steinen führte an ihr empor. Darüber standen die Weinstöcke, die Sorgenkinder des alten Herrn. Jahr für Jahr gaben sie hartnäckig nur wenige Pfund saurer Trauben, aber es blieb trotzdem ausgemacht, daß hier anno Domini der großartigste Wein in der ganzen Umgegend wachsen mußte. Ein zweites Mauerwerk schloß nach oben ab. Auf seiner Höhe lief eine langgestreckte Laube über die ganze Breite des Richthoffschen Besitzes. Der Laubengang hieß der Philosophenweg; er lag schon hoch über der Stadt in der freien, ziehenden Abendluft.
Dort schritt Marga, die Hände auf dem Rücken, langsam auf und ab.
Das Lärmen und Lachen der Spielenden klang nur gedämpft zu ihr herauf. In vollen Zügen trank sie die Ruhe des späten Abends. Nichts Weichmütiges durfte in ihr aufkommen. Sie ordnete ihre Gedanken und ihre Gefühle zu dem mutigen Gleichklang, in dem sie daheim war. Ihrem festen Willen zum Trotz drängte sich immer noch ein herber Ton vor. Konnte sie es nicht lassen, auf andere Menschen zu bauen, statt nur auf sich? Es war ja doch stets dasselbe: ein Suchen, das müde machte, und ein Finden, das die Enttäuschung war. Zwiespältig und halb und haltlos waren alle, bei denen sie sich die Mühe machte, in sie hineinzulauschen. So wie Perthes. Wie die Mücken tanzten sie um die Sonne, zu schwach, um in sie hineinzufliegen, zu schwach, um sie zu entbehren. Vertraute sie, Marga, denn nicht genug auf sich allein? Was horchte sie überhaupt noch nach Gefährten? Ihre Schwingen reichten aus. Auch wenn sie nur ein Weib war. Sie — sie wollte und konnte in die Sonne des inneren Erlebnisses fliegen, wo die Schönheit war, das Unbedingte und das Unendliche ...
Zwischen den zuhöchst gelegenen Pappeln, wo Margas Lieblingsplatz war, und dem Philosophenweg lag ein Wiesenhang unter alten Kirschbäumen.
Dort streckte sie sich aus.
Die Hände hinter dem Kopf verschränkt, die Augen geschlossen, überließ sie sich ihrem Schauen. Aus dem Schoß ihrer immerwährenden Nacht quoll ihr Bild auf Bild entgegen. Nicht verschwommene, sondern scharfe und klare Gesichte, die ihre Phantasie sich schuf, und in denen ihre reiche Seele sich auslebte und ausruhte. Da war ein fernes, schimmerndes Tal, über und über von rotblühenden jungen Pfirsichbäumen voll. Ein tausendfältiger Schwarm von weißen, samtflügeligen Faltern gaukelte darüber: ein flatterndes Gewölk, das wie eitel Silber gegen den tiefblauen Himmel stand. — Ein verschlafener See blitzte auf, inmitten dunkel wuchtender Tannenberge. Das fahle, magische Licht drang aus gelben Wolkenstreifen über die Landschaft. Der Wind hob leise die Wellen, daß die Seerosen schwankten, und ein schwarzer Schwan zog sanft am Schilf entlang. — Die Berge rückten auseinander. Der See verschwand. Lachende, unabsehbar weite Blumenwiesen taten sich auf: gelbe Königskerzen und weiße Schafgarben und blauer Rittersporn wirrten sich leuchtend durcheinander, so weit der Blick reichte. Darüber, am Horizont, erhoben sich kristallene Sommerwolken, überirdische Berge, himmlische Paläste, in denen die Sonne selbst zu wohnen schien. —
Marga war so entrückt, so selig im Schauen versunken, daß sie nicht hörte, wie ein behender Schritt die Stufen nach dem Laubengang heraufkam. Erst als ihr Name gerufen wurde, zuckte sie auf und richtete sich aus dem Gras empor.
„Fräulein Richthoff!” ertönte es von neuem.
Sie erkannte Perthes' Stimme und gab keine Antwort. Noch war sie nur halb aus ihrer Traumwelt erwacht, und kein Fremder sollte sie stören. Sie duckte sich wieder tiefer ins Gras.
Aber seine Augen hatten ihr helles Kleid in der dunklen Wiese erspäht. „Wo in aller Welt stecken Sie denn? Sie haben sich ja richtig versteckt!”
„Bei mir selber,” gab sie einsilbig zurück.
„Drunten wird eine Bowle gebraut! Ich soll Sie holen.” Perthes war vollends zu ihr heraufgeklettert. „Darf ich mich einen Augenblick neben Sie setzen?” Ohne ihre Zustimmung abzuwarten, streckte er sich neben ihr im Gras aus.
Marga strich die Haare aus dem Gesicht und setzte sich, ihren Haarknoten zurechtsteckend, aufrecht.
Vom tieferen Garten und vom Hof herauf kam der matte Widerschein der Papierlaternen und gab im Verein mit dem sternklaren Himmel gerade Licht genug, um Perthes ihre stillen verschlossenen Züge sehen zu lassen. Nach dem ausgelassenen Spiel mit seiner lauten, übermütigen Lustigkeit, die er eben verlassen, berührte ihn ihre ruhevolle Erscheinung hier oben im Garten seltsam.
„Warum sind Sie denn so mir nichts dir nichts ausgerückt, Fräulein Marga?” fragte er nach einer Weile.
„Was hätte ich denn sonst machen sollen?” entgegnete sie ohne Vorwurf.
Er schwieg. Seine Frage war unbedacht und töricht. Wie konnte sie in dem abschüssigen Garten „Hasch, hasch!” und derlei Dummheiten spielen! Er hatte sie ja überdies mit einer gewissen Absichtlichkeit sich selbst überlassen.
„Sie haben nicht viel versäumt,” fuhr er fort. „Ich alter Esel habe mich wie ein alberner Junge herumhetzen lassen.” Er trocknete sein Gesicht mit dem Taschentuch; er ärgerte sich wirklich, daß er sich wie der krasseste Fuchs in solche Kindereien gestürzt hatte. „Hier oben ist's schöner!” Er schaute hinaus in die Ebene, die nächtlich verschattet sich dehnte.
Marga antwortete nicht. Sie legte ihren Rock zurecht und glättete ihre zerknitterten Ärmel.
„Ich darf ja nicht mehr fragen, was Sie denken,” begann er von neuem, „sonst würde ich's schon wieder tun, weil Sie ja doch von sich aus mir nichts erzählen.”
„Ich denke, warum Sie bei Tisch all die häßlichen Dinge sagten.”
Perthes besann sich. „Ach — Sie meinen über meine Tätigkeit? Die Geschichte mit den Tierexperimenten, und daß man leider nicht mit Menschen experimentieren könne? Aber das ist ja wahr!”
„Vor Ihrem Verstande vielleicht, ja, aber nicht nach Ihrem Gefühl.”
„Und woher wollen Sie das wissen? Du lieber Gott! In der Medizin hört man auf, ein Gemütsmensch zu sein — woher wollen Sie wissen, daß das nicht meine volle Meinung ist?”
„Das will ich Ihnen ehrlich sagen: weil Sie vor uns dummen, gefühlsduseligen Mädels renommieren wollten. Sie hatten ein Bedürfnis, sich schlechter zu machen, als Sie sind.”
Perthes horchte verwundert auf. Er hatte sich auf den Boden gelegt und den Kopf auf die Hände gestützt. Marga saß links hinter ihm. Er sah forschend zu ihr hinüber. „Sie beurteilen mich sehr schmeichelhaft, Fräulein Marga.” Er lachte gezwungen. „Ich glaube, Sie irren.”
„Wenn ich irre, um so schlimmer für Sie!” erklärte Marga mit jener Ruhe und Geradheit, in der sie sich selbst wiederfand. „Dann müssen Sie sich selber sehr niedrig einschätzen und Ihre Mitmenschen auch. — Und besonders uns Frauen!” setzte sie nach einer Weile gedankenvoll hinzu.
„Warum gerade die Frauen?”
„Weil Sie meinen, ihnen im Ernst mit so rohen Dingen zu imponieren.”
Wieder trat eine Pause zwischen beiden ein.
Vom Hof herauf drangen einzelne abgerissene Worte, denen lustiges Gelächter antwortete. Papa Wilmanns hielt bei der Bowle seine aufgeschobene Rede auf die Damen.
„Ich glaube, wir müssen hinunter,” bemerkte Marga kurz.
Perthes rührte sich nicht. Er trommelte mit der rechten Faust erst langsam, dann immer leidenschaftlicher auf den Grasboden.
„Was machen Sie denn?” fragte Marga aufhorchend.
„Ich ärgere mich!” gab er knurrend zurück, ohne in seinem Trommeln aufzuhören.
„Worüber?”
„Über Sie —”
„Über mich?”
„Und noch mehr über mich!”
„Und warum denn?”
„Weil — weil —” Er führte einen letzten grimmigen Hieb gegen den unschuldigen Boden. „Weil Sie verwünscht recht haben!” stieß er knirschend hervor.
Marga mußte unwillkürlich lächeln über das unerwartete, heftige Bekenntnis, das sich so widerwillig von ihm losrang.
Perthes bemerkte es nicht. Ihm war zumute, als wäre jählings etwas geborsten, ein Hemmnis, ein Stauwehr, das den Strom seiner Gedanken und Gefühle aufgehalten. Die offene, stillkräftige Art Margas lockte aus ihm hervor, was er nie einem anderen mitgeteilt hätte. Der Widerspruch seines Herzens, das bald in Sehnsucht nach vertiefter Empfindung, nach einer überlegenen Weltbetrachtung voll Gleichklang und Schönheit sich verzehrte, bald in Verachtung jeder seelischen Regung zur Oberfläche trieb, wo es nichts gab, als die nackte Wirklichkeit, und alles Unbegreifliche unterging in der tristen Biologie des Tiermenschen, wo nur der Genuß des Alltags Sinn und Berechtigung hatte — dieser Widerspruch tat sich in einer Flut von Selbstanklagen auf, die er rückhaltlos in die dunkle, friedvolle Nacht hinausschleuderte. Heute war er weich, mitfühlend, empfindsam und wehleidig wie ein Kind; morgen hart, schroff, roh wie ein zynischer Zweifler, der sich in Kraßheiten überbot. Sein unseliger Hang zum Extremen — war er nicht sogar jetzt lebendig, in dieser Beichte, die er ohne Grund vortrug? die so schamlos war wie die ganze Komödie, die er mit sich und aller Welt aufführte? Er war zur Halbheit, zur Maßlosigkeit, zum Unfrieden verdammt. Wertlos war der ganze Kerl. „Sie irren, Fräulein Marga — Sie irren, sage ich Ihnen! Der bessere Kern, den Sie da in mir vermuten, Gemüt oder Seele oder was es derart geben könnte, der ist bei mir nicht vorhanden! Schale, nichts als Schale — im Rechten und im Schlechten!”
Marga war längst ernst geworden. Sie erschrak über die so wilde, alle Schranken vergessende Entladung, die mit Unreife und Mißklang in ihre eben noch so köstliche Einsamkeit und Harmonie einbrach. Seine Bekenntniswut verletzte sie und tat ihr wohl in einem Atem. Nie hatte ein Mensch, nie zumal ein Mann ihr so sein Innerstes gezeigt. Sollte sie stolz auf dies Vertrauen sein? War sie nur der zufällige Anlaß, die zufällige Zeugin dieser selbstvernichtenden Offenheit? Durfte sie auf ihr Herz hören, das trösten und helfen wollte? Auf ihr Gefühl, das beinahe mütterlich in ihr aufwallte: Gib von deiner Klarheit seiner Unklarheit! Schenke von deiner Kraft! Schenke, schenke mit vollen Händen! — Lohnte es sich denn? Verlangte er überhaupt danach? Verschwende dich nicht! warnte es in ihr. Verschwende dich nicht!
Perthes war verstummt. Er warf sich herum und starrte, von ihr abgewandt, hinaus in die Ebene, aus der schüchtern der Fluß im Licht des gestirnten Himmels aufleuchtete.
Marga fand noch immer kein Wort.
Jenes Schweigen herrschte zwischen beiden, das zwei Menschen beschleicht, wenn der eine sich schrankenlos ausgegeben hat und der andere noch nicht weiß, was er dagegen geben soll. Ein Schweigen, das zum Anfang oder Ende des Verstehens wird.
Marga zitterte in ihrer Unschlüssigkeit.
Wenn sie ihn jetzt hätte sehen können! Einmal ihm ins Gesicht schauen, daß dies Gesicht ihr rate, was sie tun oder lassen müsse! Sie strengte alle Kräfte ihrer Seele an, um den Mangel ihrer Sinne zu ersetzen. Wie durch einen geheimen Rapport fühlte sie, daß er sich innerlich langsam von ihr entfernte. Er räusperte sich; er begann sich über seine Preisgabe zu schämen, zu erzürnen. Ihr Zaudern wich. Sie durfte nicht in seiner Schuld bleiben. Eben war er im Begriff aufzuspringen und sie zum Abstieg aufzufordern, als sie die Sprache fand. „Ich glaube doch an den Kern, den Sie sich absprechen, Doktor Perthes,” sagte sie mit leiser Bestimmtheit.
„Doch? Immer noch?” erwiderte er nach einer Weile ausdruckslos. „Da sind Sie eine beneidenswerte Optimistin.” Der spöttische Ton, den er annehmen wollte, verlor sich in einer bitteren Niedergeschlagenheit.
„All das Leidenschaftliche,” fuhr sie uneingeschüchtert fort, „was Sie vorhin sagten, sagten Sie ja nur deshalb, und deshalb nur so leidenschaftlich, weil Sie selber gern an einen solchen Kern glauben möchten und es nicht immer können.”
Perthes erwiderte nichts. Er hatte das bärtige Kinn auf die Faust gestützt und sah Marga an. Ihre sanfte, klare Stimme wirkte auf ihn wie eine Kinderweise, die sich beruhigend ins Ohr schmeichelt. Sein Verstand sträubte sich gegen die einfache Wahrheit ihrer Worte; das Herz sog sie dankbar in sich.
„Ich kann natürlich nicht wissenschaftlich mit Ihnen streiten,” hub Marga nach einer gedankenvollen Pause noch sicherer wieder an. „Ich habe in allen Dingen nur die Gewißheit meines Gefühls, und die sagt mir, daß es gar nicht zuerst auf die Meinungen ankommt, die man sich von der Welt und dem Leben und den Menschen so im allgemeinen macht, sondern auf das, was man aus sich selbst macht.”
„Meinen Sie? Aber wenn man bald so ist, bald so? Wenn man nach zwei Seiten gezerrt wird? Wenn man, um recht trivial, aber anschaulich zu reden, die bekannten ‚zwei Seelen‛ in der Brust hat?”
„Dann kommt es eben darauf an, durch welche von beiden man glücklicher, man mehr ‚man selber‛ ist!” erwiderte Marga überzeugt. „Wenn man das erst weiß, braucht man nur zu wollen.”
„Und dafür sind Sie doch ein Mann! Sagen Sie das ruhig wieder dazu! Ich kann es ganz gut noch einmal hören!” Es war keine Bitterkeit und kein Spott mehr in seiner Stimme, sondern nur eine schwermütige, dumpfe Verzagtheit. Als sein Blick aus verlorener Weite zurückkam, suchte er Marga.
Ihre Augen hatten einen warmen Glanz angenommen, der sie von innen zu erleuchten schien und ihre Blindheit vergessen ließ. Sie hatte sich höher aufgerichtet. Ihre Hände lagen gefaltet in ihrem Schoß; die Haare über ihrer runden, ebenmäßigen Stirn bewegten sich sacht im Winde, der über den Berg fuhr. Von ihrem geschlossenen, in sich einigen Wesen ging eine stille, fast heitere Gewißheit aus, die Perthes mit Achtung erfüllte, einer Achtung, die er zuvor nicht empfunden hatte.
„Und wenn ich's auf eine Probe ankommen ließe, ob Sie recht haben, Fräulein Marga?” meinte Perthes zögernd. „Wollten Sie mir ein klein wenig dazu helfen?”
Sie überlegte. Nur einen Augenblick. „Das wollte ich!” sagte sie kurz und herzlich.
Perthes stand auf, er reckte seine Arme und streckte die hohe, sehnige Gestalt. „Also auf gute Kameradschaft!” Es klang eine so ehrliche Wärme aus seinen Worten, wie er sie den ganzen Abend noch nicht gefunden hatte.
Margas Gesicht wandte sich arglos und voll Güte zu ihm. Sie bot ihm die Hand.
Er ergriff sie und, einer ungekünstelten Bewegung folgend, drückte er einen Kuß darauf.
„Jetzt ist es aber höchste Zeit, daß wir hinuntergehen!” Auch sie war aufgestanden. Ihre Stimme zitterte von innerer Seligkeit, von frohem Stolz über diesen Beweis der Achtung.