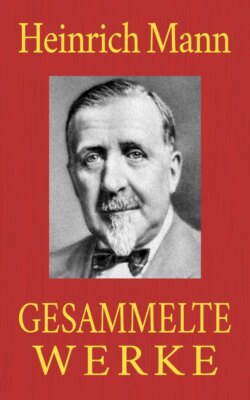Читать книгу Heinrich Mann - Gesammelte Werke - Heinrich Mann - Страница 44
II
ОглавлениеIm Kunstkabinett, am Rande der toten Lagune, und nur durch eine Tür getrennt vom Saal der Venus, unterhielt man sich von Liebe. Die Herzogin und San Bacco gaben Jakobus recht. Siebelind widersprach ihm gereizt. Der alte Dolan grinste faltig. Mortœil und Clelia sahen sich an und zuckten die Achseln, Lady Olympia tat nicht einmal das. Properzias Blick brütete heiß und unbeirrbar auf dem Gesicht ihres Geliebten.
Dem Gespräche lauschten, von der Höhe ihrer Sockel und vor dem Wandbezug aus olivengrüner, gefältelter Seide, Florentinerinnen mit gedankenfeinen Stirnen und junge, träumerische Heidinnen. Sie waren mildweiß; von goldenen Kettchen hing ihnen über der Nasenwurzel eine Gemme. Ihre Stirnen waren gewölbt und ihr Haar wie Schleier zusammengerafft. Sie trugen den Kopf erhaben auf langen, geraden Hälsen und hielten die Augenlider gesenkt; die waren dünn zum Zerreißen. Mit hohen, schwachen Brauen und gespitzten Lippen oder halboffenen und die Zunge im Winkel, lächelten und deuteten sie, kaum wahrnehmbar und auf immer unerklärlich. Sie standen im Halbkreis hinter den Stühlen der Frauen. Jedem der Männer sah ein Knabe über die Schulter, oder ein jugendlicher Krieger. Sie waren nackt oder gepanzert, und aus ihrem gebräunten oder schwarz polierten Marmor spähte ihre Seele hervor, unschuldig und voll Verlangen. Erstarrt trotzten auf ihren hellen Stirnen die Taten, die sie nicht hatten vollbringen können.
Die Hauptwand trug die Pallas des Botticelli. Gegenüber, durch die aufgestellte Terrassentür, schmiegte sich eine zärtliche Luft; es war gegen Abend und noch im Mai. Die Lagune, schräge bestrahlt, ein riesiger Silberspiegel, schien ins Zimmer. Man sah einander auf diesem Hintergrunde von Silber. Die Kunstwerke wachten auf und leuchteten; der Sinn der Menschen belebte sich und ward begehrlich.
Jakobus wiederholte nochmals, daß die Gegenstände der Kunst weit getrennt seien von denen der Liebe.
»Es ist genug, daß ich das Fleisch mit meinen Händen anfasse und mit meinen Sinnen. Mein Herz soll es nicht berühren. Es ist genug, daß ich es male. Ich will es nicht auch noch lieben.«
»Nicht einmal, wenn es beseelt ist?« fragte Clelia Dolan.
»Ah bah! In einer Brust, die ich liebe, will ich harte Diamanten brechen und Eisklötze zum Schmelzen bringen. An ihren weichen Hügeln, um die jeder seine Hände legen kann, liegt mir so wenig wie an einer Leiche.«
Dabei richtete er auf Lady Olympia einen erbitterten Blick.
»Das klingt gewaltsam, mein Lieber«, meinte die Herzogin. »Warum tun Sie sich Zwang an?«
Siebelind, auf den niemand hörte, versicherte einem nach dem andern, mit störrischer und vergrämter Miene, auch die Kunst müsse frei werden vom Fleische. Es genüge nicht, daß sie Seele habe: die Seele solle mystisch sein, die Sinne kasteit und die Formen unterdrückt. Die Frauen maßen ihn kalt und rümpften die Nasen. Er zog unvermutet aus der Tasche ein bronzenes Figürchen, eine Badende, von einem Delphin in die Wade gebissen. Ihr vom Schreck geschlagener Körper warf große Fleischfalten. Dolan drehte sie lüstern zwischen den Fingern.
»In den Vertiefungen liegt verstaubt die alte künstliche Patina«, erklärte er. »Aber die Flächen haben sich längst mit wundervollem, natürlichen Grün überzogen … Woher haben Sie das?« fragte er übelwollend.
»Mein Geheimnis«, erwiderte Siebelind, und bot die Statuette der Herzogin dar. Sie dankte ihm.
»Reden Sie was Sie wollen. Durch solch einen Fund stimmen Sie uns immer wieder zu Ihren Gunsten.«
»Ich habe die Schwäche«, entgegnete er. Dolan brummte:
»Mein Lieber, Sie haben ein konträres Kunstempfinden.«
Properzia sprach für sich, innig und weltvergessen.
»Ach! Wie wäre es klar! So viel wie möglich einander sehen und sich einfach lieben, ohne List und Umwege, ohne Scham noch Lüge, ohne ein getäuschtes Verlangen und ohne Gewissensbisse. Zu Zweien leben und jeden Augenblick sein Herz geben. Unsere Gedanken achten, soweit wie wir hineinzutauchen vermögen. Aus unserer Liebe keinen Traum machen, sondern hellen Tag, und frei darin atmen …«
Sie brach ab, denn sie merkte plötzlich, daß alle verstummt auf sie horchten. Ihre tiefe, dunkel bewegte Stimme klang noch nach; in diesem Augenblick fand jeder Properzia schön. Lady Olympia lehnte sich zurück, schloß die Augen und machte »Ahh!« Jakobus und Graf Dolan klatschten Beifall. Die Bildhauerin sah umher, ohne Verwirrung und ohne Freude.
»Ich habe nur ein Gedicht nachgesprochen«, versetzte sie.
Und darauf ward sie wieder vergessen. Ihre Worte hatten jeden angeregt, und jeder ging seiner Begierde nach. Mortœil flüsterte, mit dem Munde dicht über Lady Olympias stolzer Schulter. Sie stand auf und drehte ihm den Rücken zu. Er begab sich zu Clelia und schaute, ohnmächtig und gereizt, hinter der großen Frau her. Das junge Mädchen schielte, ohne daß Mortœil es merkte, nach Jakobus. Lady Olympia bemächtigte sich des Malers.
Die Herzogin war mit San Bacco und Siebelind im Gespräch. Der ehemalige Kavallerist behauptete verstockt, er habe nie geliebt.
»Nie geliebt?« sagte San Bacco. »Ach ja, Sie werden recht haben. Man liebt immer oder nie.«
Er stand hinter der Herzogin und senkte nachdenklich den Blick auf ihr dunkles Haar. Sie hörte mit halbem Ohr nach dem Liebesgeflüster hin; es durchschwirrte von allen Seiten den Raum, gleich einem Insektenschwarm. Buntschillernd, leichtflügelig, naschhaft und planlos flatterte es an den grünseidenen Wänden hin und über die Füße der Pallas und durch die Olivenzweige, die sie ganz umrankten. Auf einmal aber ward die Herzogin aufmerksam auf das heimliche Gezisch des alten Dolan. Er redete auf Properzia ein, die gepeinigt wegsah. Er machte eine kleine faltige Greisenfaust und schlug sich damit schnell und oft unter das Kinn, auf seinen nackten Hals, der knorplig aufragte aus den zu weiten Kleidern. Der weichliche, haarlose Kopf bebte vor innerlicher Anstrengung. Die große Nase bewegte sich.
»Gehen Sie nach Hause!« rief er tonlos. »Arbeiten Sie! Was wird aus unserm Vertrage! Die lange Mitte meiner Galerie steht noch ganz leer. Bevor Sie sie nicht besetzt haben – meinen Sie etwa, daß ich Sie den Lohn auch nur von ferne sehen lassen werde? Ja doch, sehen sollen Sie ihn, aber nur durchs Schlüsselloch, wie er am Ende meiner Säle steht. Und nicht einmal Ihren Tränen werde ich erlauben, durch das Schlüsselloch zu fließen!«
Sie entgegnete matt und eigenwillig:
»Ich will noch hier bleiben. Lassen Sie mich. Ich leide zu sehr …«
»Sie werden noch viel mehr leiden, wenn Sie nicht sofort Ihre Arbeit aufsuchen.«
Allmählich hatten alle sich umgewandt und bestaunten den Alten: es sah aus, als verschlänge ein kleiner Dämon mit einer feurigen Drachenzunge die große Properzia. Er zitterte ganz und gar unter den Falten seiner Kleider. In seinem altjüngferlichen Gesicht mit den Wuchererzügen spitzten sich unter den hängenden Lidern, schwarz und kalt, die Pupillen. Properzia hatte sich erhoben, sie tat einen Schritt zur Tür. Aber die Herzogin trat ihr in den Weg.
»Bleiben Sie doch«, riet sie leise und leichthin. »Sie können nicht wissen, was heute geschieht. Sehen Sie nicht, daß Ihr Maurice ganz allein steht?«
»Ich bin schon zu lange hier«, versetzte Properzia. »Aber ich bleibe. Ich bin die Abgewiesene, die dem spröden Geliebten nachstellt, ohne Scham und ohne Würde – ich weiß es wohl. Aber auf dem Wege, den ich gehe, sind Würde und Scham längst unter die Kiesel getreten.«
»Unterdrücken Sie die Regungen von Verzweiflung, Properzia. Sättigen Sie auf seinem Gesicht Ihren Blick. Ich versichere Sie, daß es ihm wohltut. Er steht allein und zerbeißt sich die Lippen. Clelia hat nur Augen für Jakobus, und für Lady Olympia lebt er gar nicht mehr.«
»Für sie, seine Geliebte?«
»Geliebte? O, Lady Olympia ist niemandes Geliebte. Sie hat eine halbe Nacht seine Gesellschaft genossen und es längst vergessen. In seinem schwächlichen Blute wirkt der Reiz noch ein wenig nach. Lieben Sie ihn, er wird sich lieben lassen!«
Die Herzogin wollte weiter gehen, aber Properzia machte eine Bewegung des Entsetzens.
»Was ist das für eine Frau! Sie wäre imstande, einen Mann zu vergessen und zu verleugnen, den sie sich gewünscht und dessen Liebe sie angenommen hat! Kann man denn das?!«
»Es wird ihr leicht«, erklärte die Herzogin und entfernte sich.
»Aber das ist ja ein Verbrechen!« rief Properzia sich zu. Sie stand abseits und verschränkte die Finger. »Wie muß man sie hassen und fürchten – und vielleicht auch lieben? … Welch unbegreifliches Verbrechen!«
· · ·
Die Herzogin trat zu denen, die mit Jakobus ein Bild betrachteten. Er hatte es ins Licht gerückt; Lady Olympia saß davor.
»Was für ein liebes, liebes Mädchen«, sagte sie zärtlich. »Von wem ist es?«
»Von einem großen Namenlosen. Wozu würden Ihnen die zwei oder drei Silben verhelfen, die einmal das Zeichen seiner Persönlichkeit gewesen sind? Sie haben ja schon alles von ihm, da Sie über sein Werk geneigt beinahe weinen. Denken Sie, dieses Mädchen wartet vielleicht schon seit dreihundert Jahren darauf, daß Sie, Milady, es lieben. Inzwischen hat es zugesehen, wie seine Farben dunkelten und barsten, und wie das Gold des Rahmens erlosch. Es sitzt vorne, ganz allein auf dem braunen Grase, in einer weiten und strengen Landschaft und stützt den Arm auf einen Hügel. Seine warme Schulter, dem Gewande entstiegen, berührt die dürre Erde. Welche goldblasse Büste, und was für große, begehrliche Augen! Seine Stimme würde klingen wie die Stimmen der mutigen Kinder voll Lebenskraft; aber sein Lockenkopf ist gefangen in dem langsam streichenden Grau eines verhängnisvollen Himmels – und es schweigt.«
Lady Olympia näherte schwesterlich ihr glückliches Gesicht dem schwermütigen der andern. Jakobus’ Kopf war ganz nah; sie sagte ihm ins Ohr:
»Ich empfinde die Kunst unglaublich stark. Die Bilder beleben sich mir … buchstäblich. Sie wissen doch, welcher Mann mich in Stimmung versetzt?«
»Ich will es lieber noch nicht wissen.«
»Also später. Sie sind prachtvoll. Seit vierzehn Tagen könnten Sie mich haben. Was Sie mir inzwischen für Vergnügen gemacht haben! Bedenken Sie, daß ich sonst nur die Arme auszubreiten brauche, und alles fällt hinein. Ihnen danke ich das Glück des Wartens. Sie lieber, lieber Mann! … Übrigens müssen Sie verliebt sein.«
»Ich? Nein, nein. In wen denn?«
»Nun, natürlich in – mich.«
Jakobus errötete. Er suchte, lachlustig und betreten, die Augen der Herzogin, ohne sie zu finden.
Siebelind erhaschte einige von Lady Olympias Worten. Er trank sie gierig und mit saurer Miene; seine Stirn ward sehr feucht. Er unterbrach hastig das heiße Geflüster.
»Betrachten Sie doch die Contessina statt dieser rissigen Leinwand! Clelia sitzt an ihrem Tischchen aus Lapislazuli, und zwischen die etruskischen Vasen, die darin eingelegt sind, setzt sie ihren Arm wie eine alabasterne Statuette. Sie hat, ohne viel zu berechnen, ganz dieselbe Haltung angenommen, wie das wehmütige Fräulein hier im Bilde. Sie schmollt und denkt: ›Die dort geraten in Ekstase über eine gemalte Haut. Warum überzeugen sie sich nicht, daß meine gerade so goldblaß ist, und daß auch ich etwas überaus Liebliches und Lebenduftendes bin auf dem grauen Himmel schwerer Ereignisse.‹«
»Schwerer Ereignisse?« fragte jemand, und man zuckte die Achseln. Aber Mortœil, der immerfort dem Nacken Lady Olympias zugesehen hatte, wie er unter einem Netz schwarzer Spitzen sich gelassen hob und senkte, ging rasch entschlossen zu der Verlassenen.
»Fällt es Ihnen im Grunde nicht auf«, meinte er, »daß wir uns hier treffen? Wir haben uns neulich in etwas übler Laune getrennt, es scheint sogar, daß wir uns gezankt haben …«
»Und daß wir unsere Verlobung aufgehoben haben«, ergänzte Clelia.
»Die Notwendigkeit muß uns wohl beiden eingeleuchtet haben.«
»Allerdings. Denn den so – bürgerlichen Ansprüchen, die Sie an Ihre Gattin stellen würden, fühle ich mich nicht gewachsen.«
»Bürgerlich? Ich bitte Sie um alles. Ich halte mich im Gegenteil für sehr aufgeklärt. Glauben Sie wohl, daß es mich gar nicht aufregen würde, wenn meine Frau mich betröge. Ich bin der Ansicht, man muß der Frau ein wenig mehr Selbstverantwortlichkeit aufbürden. Die Schande ihrer Handlungsweise sollte nicht mehr auf den Mann fallen, sondern auf sie selbst.«
»Ach, das ist interessant.«
Sie dachte: »… und bequem über die Maßen.«
»Nun, das Ergebnis von dem allen«, sagte sie, »ist, daß wir nicht zu einander passen.«
»Wir passen ausgezeichnet«, dachte sie, »und ich werde ihn bekommen.«
»Ich sollte im Gegenteil fast denken …« äußerte er. Er überlegte, angstvoll enttäuscht: »Lady Olympia nimmt sich heraus, mich, der ich ihre Griffe beinahe noch in den Gliedern spüre, ganz einfach zu verleugnen. Und dieses kleine Mädchen tut so, als würde es mich nicht einmal heiraten. Bin ich denn aussätzig geworden?« Er bemerkte:
»Recht bedacht, wüßte ich kaum noch, was wir an einander auszusetzen haben.«
»O, wir wußten es neulich«, behauptete sie. »Trösten wir jetzt ein wenig die arme, große Properzia.«
»Ich danke«, erwiderte Mortœil, und sie verließen sich kühl lächelnd.
Clelia gesellte sich zu Properzia. Sie saß vor dem Kamin, zwischen den vergoldeten Figuren des Feuerbocks, die heraustraten aus der finstern Wölbung. Ihre ausgebreiteten Arme ruhten, links und rechts, auf den Schultern des Vulkan und der Aphrodite. Ihr kleiner Kopf mit der Mauer schwarzer Haare stand vorgestreckt auf starrem Halse. Der Mund war hart verschlossen und seine Winkel abwärts gezogen. Clelia fand sie grausig und schön, mit dem Schwarz der großen, tierisch keuschen Augen in dem weißen Gesicht. Sie kniete auf einen Schemel zu Füßen der Bildhauerin nieder und schmiegte sich an sie, blond und leicht. Siebelind sah es mit an und dachte: »Welch gelungenes Bild! Eine süße Heidin mit wunderbaren Haarmassen im Nacken und die Schenkel der Schicksalsgöttin umklammernd! … Nun wird sie Properzia versöhnen, und zwar nicht aus List, sondern weil sie sie in dieser Minute wahrhaftig liebt. Diese kleine Clelia fühlt, daß alle sie durchaus für etwas sehr Liebliches und Gütiges halten möchten – und darum wird sie es fast in Wirklichkeit. Sie sonnt sich in den Augen, die sie bewundern, und genießt die eigene Lieblichkeit und Güte mehr als alle andern. Solch Kätzchen, lüstern nach sich selber! Und nicht einmal die Genugtuung hat man, es hassen zu dürfen. Es ist zu angenehm – und zu zerbrechlich.«
Clelia bat:
»Meine große, schöne Frau Properzia, glauben Sie doch nicht, ich sei Ihre Rivalin. Nicht wahr, Sie glauben es nicht?«
Properzia wandte dem jungen Mädchen einen leeren, düstern Blick zu und schwieg.
»Ich habe ja mit Maurice gebrochen«, sagte Clelia. »Sie wissen es doch. Wir passen gar nicht füreinander. Und dann quält es mich, daß Sie ihn lieben und unglücklich sind. Als ich mich mit ihm verlobte, wußte ich es noch gar nicht.«
Siebelind spitzte die Ohren.
»Welch süßes Stimmchen«, meinte er. »Und sie streichelt der großen Frau die Hände und küßt sie. Wer ihr jetzt sagte, daß sie fest entschlossen ist, Mortœil zu heiraten, würde sie geradezu überraschen.«
»O, ich könnte es nicht ertragen«, versicherte Clelia, »über Ihr Unglück hinweg nach meinem Glücke zu greifen! Nehmen Sie ihn sich, wenn Sie ihn haben möchten, meine schöne Frau Properzia … Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, in der es so zugeht, wie Sie gewiß wünschen. Hören Sie nur, sie handelt von einem meiner Vorfahren, Venedetto Dolan. Er war Trinitarier, er zerbrach die Ketten der Sklaven. Aber einmal brachte er aus der Berberei eine Sklavin mit, deren Kette konnte er nicht lösen, weil er selbst darin gefangen war. Wie hat er sie lieb gehabt! Er dachte wie Sie, Frau Properzia: soviel wie möglich einander sehen und sich einfach lieben … In einem Saal unseres Palazzo am Großen Kanal schloß er sich mit ihr ein und verließ sie nie mehr. Es gab darin einen hohen, wunderbar geschmückten Sockel, auf den sie sich stellen mußte: ganz nackt, wie eine Statue; eine köstlich ciselierte Silberschale, in die sie sich legen mußte, ganz nackt, ähnlich einer Perle; und einen von erhabenen Bildern umzogenen Marmorsarkophag, auf den sie sich ausstrecken mußte, ganz nackt, gleich einer Toten.
Wenn sie auf dem hohen Sockel stand, so erreichte ihr Kopf mit den langen, langen Haaren die wunderschöne Fensterrose, die in der Mauer unseres Palazzo ist, und von der er seinen Namen führt: Dolan della Finestra. So kam es, daß man sie von draußen sah, von dem Seitengäßchen, das neben unserm Hause herläuft. Und jedesmal sammelte sich dort das Volk und verlangte, die schöne Sklavin solle hinausgeführt und ihm gezeigt werden. Der Ritter verweigerte es. Aber da man hörte, sie sei übermenschlich schön, drohte in Venedig ein Aufruhr, und die Signoria schickte ihre Abgeordneten zu Benedetto Dolan: er solle seine Sklavin hinausführen. Er verneigte sich und gehorchte. Er trug sie in seine Gondel: nicht auf dem hohen Sockel, worauf sie, ganz nackt, wie eine Statue stand; auch nicht in der Silberschale, in der sie, ganz nackt, einer Perle ähnlich ruhte – sondern ausgestreckt auf dem marmornen Sarkophag, ganz nackt, gleich einer Toten. So fuhr sie, der Ritter in seiner Rüstung ihr zu Häupten, den Großen Kanal hinab. Als sie aber an der Piazzetta landeten, wo das ganze Volk wartete, da sah das ganze Volk, daß aus ihrem Herzen ein roter Tropfen trat.«
Properzia weinte. Clelia seufzte auf, von süßer Traurigkeit beglückt – so erklärte es sich Siebelind – und ganz stolz darauf, mit all ihren kleinen, zärtlichen Handgriffen, Wörtchen und Küßchen diesen weiblichen Koloß so sehr in Bewegung versetzt zu haben, daß er zwei Tränen fließen ließ.
· · ·
Inzwischen sagte die Herzogin zu Mortœil:
»Schauen Sie sich einmal um nach Properzia. Sie vermeiden es, Sie wissen wohl: diese schicksalsschwere Pose, dieses versteinerte Schweigen, diese Tränen – alles ist Ihre Schuld. Wenigstens gibt man Ihnen die Schuld.«
»Ich wollte sie am Ende tragen. Das Schlimmste ist …«
»Daß Properzias riesenhafte Leidenschaft in keinem passenden Verhältnis steht zu Ihrer Person.«
Da er zusammenzuckte, setzte sie hinzu:
»Ich meine es ganz ohne Kränkung. Man sieht Sie neben dieser Frau und fragt sich: Wie kommt dieser geschmackvolle junge Mann zum Empfange so wuchtiger Gefühle. Unter ihrer Last nimmt er sich ganz seltsam aus.«
»Seltsam? Wagen Sie doch das Wort! Lächerlich, wollen Sie sagen. Man findet mich lächerlich!«
Sein Schmerz brach aus. Sie erwiderte:
»Ich leugne es nicht. Aber man sagt, Sie könnten es ändern. Man meint, Sie sollten der Armen einige Zärtlichkeit gönnen, zumal man annimmt, es würde Ihnen nicht einmal schwer fallen.«
»Nimmt man das an? Man hat leicht reden. Aber ich habe die Frau satt. Sie wissen nicht, Herzogin, jahrelang habe ich eine Stellung bei ihr eingenommen, die der eines Impresario ähnlich sah. Und dabei …«
Er war entrüstet und rötete sich zart. Plötzlich biß er sich auf die Lippen. »Fast hätte ich ausgeplaudert«, dachte er, »daß ich sie nie besessen habe! Welch Glück, ich beherrsche mich.« Er hob die Schultern.
»Sie ist älter als ich, die gute Properzia. Schön ist sie nie gewesen.«
»Wir haben sie heute abend mehrmals schön gefunden. Das Genie ist in jedem Alter schön, so oft es hervorbricht.«
»Ach, das ist einmal hübsch, was Sie da sagen. In Wahrheit, diese Frau hat Genie! Was sie vorhin gesprochen hat: ›Soviel wie möglich einander sehen und so weiter‹, das war eigentlich sehr geschickt abgefaßt. Übrigens ist es die Prosaübertragung eines Verses von Musset. Aber sehr geschickt abgefaßt.«
Die Herzogin dachte:
»Besteht denn dieser Mensch bloß aus litterarischer Eitelkeit?« Sie fragte:
»Nicht wahr, Sie haben ein Stück geschrieben?«
»Es ist in Sankt Petersburg aufgeführt worden, vor den kaiserlichen Hoheiten.«
»Was behandelt es doch?«
»Das Stück war eine Studie der absoluten Leidenschaft in einer Frauenseele – einer Leidenschaft, sage ich, die gar nicht mit sich reden läßt, und wie’s gar keine gibt. Ich hatte sie rücksichtslos analysiert und mit skeptisch beobachtenden Charakteren umstellt, wie mit ebensovielen Reflektoren. Es war etwas sehr Amüsantes.«
»Ich kann es mir denken. Schicken Sie mir doch das Buch.«
Er verbeugte sich, aufgetaut und blaß besonnt.
»Und was Properzia anbelangt«, bemerkte die Herzogin noch, »so wissen Sie es nun: ihre übertriebenen Gefühle schaden Ihnen. Besänftigen Sie sie. Stimmen Sie sie friedlicher und glücklicher; es steht in Ihrer Macht. Dann wird man an Ihnen gar nichts Auffallendes mehr bemerken.«
Sie rief Clelia zu sich. Mortœil dachte: »Ich pfeife auf Clelia und Olympia, und sie sollen es sehen.« Er trat vor Properzia. Sie erhob sich sofort, totenblaß. Sie gingen nebeneinander bis unter die Tür zum Saal der Venus. Sie war niedrig und hatte eine breite, weite Marmorfüllung, eingelegt mit runden Emaillen. Dort wand die Sibylle einen Kranz von grünen Schlangen. Milchige Stufen geleiteten in eine goldene Landschaft. Orpheus geigte, nackt, unter einem Feigenbaum; Einhorn, Löwe und Reh standen vor ihm, im hohen Gras. Auf tief leuchtendem Blau stürzte Phaeton mit dem Wagen, im Gewühl seiner Rosse. Die Herzogin von Assy, in griechischen Gewändern, saß auf einem goldenen Stuhl, zwischen Rollen und Statuetten.
»Hören Sie, meine Liebe«, sagte er, »es besteht zwischen uns ein ärgerliches Mißverständnis. Im Grunde haben Sie mir die Geschichte hoffentlich nicht übel genommen.«
»Nein, Maurice, ich leide nur, und ich möchte sterben.«
»O, o, was für große Worte! Man stirbt nicht so rasch. Übrigens ist ja auch mir durchaus nicht wohl, ich gestehe es. Sie selbst müssen bemerkt haben, daß ich heute zu Anfang noch ganz blaß war. Ich wagte kaum, Sie zu begrüßen.«
»Sie sind blaß, Maurice, weil Lady Olympia hier ist, und weil Sie noch an Ihre Ausschweifungen denken, mit einer Frau, von der Sie nicht geliebt werden, und die Sie nicht lieben.«
»Properzia, ich versichere Sie, es ist mir unangenehmer, als Sie glauben. Ich fühle sehr wohl, daß ich neulich abend etwas verloren habe. Ich bin geradezu unglücklich.«
Er sah sie die höfliche Versicherung seines Unglücks einatmen, mit erweiterten Nüstern. Ihre Hoffnungen belebten sich.
»Wir hatten uns gerade so ausgezeichnet verständigt«, fuhr Mortœil fort. »Wir waren darüber einig, daß wir den sogenannten künstlichen Garten, wo alles Glas, Blech, Eisen und ungenießbar ist, endlich verlassen wollten. Wir wollten uns dort finden, wo es nach Erde riecht, und einmal im Leben uns ins Gras werfen, wo wirkliche Nesseln uns brennen und warme Erdbeeren sich an unsern Lippen zerdrücken.«
»Du glaubst das, Maurice? Du begehrst das? Und der ersten herzlosen Versucherin, die dir zugewinkt hat, bist du nachgegangen!«
»Sprechen Sie nicht mehr davon, meine Liebe, es ist mir recht peinlich. Zu meiner Entschuldigung kann ich höchstens sagen: Lady Olympia ist der Sturm, der zwei Schiffe auseinandertreibt. Was ist gegen den Sturm zu machen? Übrigens hätte ich mich lächerlich gemacht, wenn ich ihr abgeschlagen hätte, um was sie bat. Sie müssen es einsehen … Nun wollen wir uns also dennoch wieder die Hände reichen.«
»Und den künstlichen Garten verlassen?«
»Zuschütten, meine Liebe, zuschütten. Ich habe ihn satt.«
Sie faßte seine Hand.
»Mein Maurice, ich bin glücklich.«
»Uns einfach lieben. So oft wie möglich einander sehen … Sie haben das sehr gut gesagt. Es ist ganz mein Geschmack. Die brünstigen Abenteurerinnen und die gefühlsöden kleinen Mädchen werden mir wenig mehr zu schaffen machen. Ich bin eben schon vergeben. Ist das nicht klar? Was meint dazu meine kleine Properzia?«
»Es wäre zu schön, Maurice, es kann nicht dauern. Ich glaube nicht, daß es dauern kann. Hast du nicht erst heute abend wieder mit Clelia gelacht? Was hattet ihr zu flüstern?«
»Aber, meine Liebe, wenn du ruhigen Blutes wärest, hättest du ja sehen müssen, daß wir kalt miteinander scherzten. Wir sagten uns, daß wir entschieden nicht füreinander paßten, und nahmen Abschied.«
»Ist damit wirklich alles abgetan? Schwörst du es?«
»Natürlich schwöre ich es. Übrigens, um dir gefällig zu sein – es wäre ja leicht, noch ein endgültiges Wort mit dem Mädchen zu reden … Ah! Ich führe einen Schlag … Ich weiß wohl, wie ich’s mache.«
Sie wurden getrennt von San Bacco und Siebelind, die aufbrachen. Dolan und Clelia gingen ebenfalls. Properzia raunte ihrem Geliebten zu:
»Du hast geschworen, Maurice. Denke daran, bleibe einfach und treu, und tue keinen Schritt mehr in den künstlichen Garten. Du weißt nicht, wie das furchtbar wäre! …«
Sie stand und bebte vor ihrer eigenen Drohung.
Dolan sagte ihr leise ein Wort, in herrischer Haltung. Sie erwiderte:
»Ich gehe schon, noch ist es Tag, und ich will arbeiten. Nicht für Sie, Conte, sondern weil ich glücklich bin.«
»Sie gehen arbeiten?« fragte San Bacco. »Jetzt darf ich Sie bitten, Frau Properzia: modellieren Sie uns für den Sitzungssaal der Kammer den ›Sieg‹!«
· · ·
Mortœil schlenderte durch ein paar Zimmer und summte etwas aus einer Operette.
»Allerdings, ich führe einen Schlag«, sagte er sich mit Stolz. »So nämlich, daß ich Clelia nochmals einen Antrag mache. Wie fein, wie geschickt: ein Zug für eine Komödie! Properzia wird mich bewundern, ich werde sie damit überraschen, nachdem ich abgewiesen bin und Clelia mich dank meiner Zudringlichkeit unwiderruflich nicht mehr kennen will. Ah! Sie kann mit mir zufrieden sein, die große Frau. Ich bringe Opfer für sie, ich begehe sogar eine gesellschaftliche Taktlosigkeit. Inmitten des halb feindseligen Plaudertones, in dem ich mit Clelia verkehre, ist ein neuer Heiratsantrag etwas schlechthin Lächerliches und Geschmackloses. Das kleine, kluge Mädchen wird das sofort merken und mir ein für allemal den Laufpaß geben. Gleichviel! Properzia soll eine Genugtuung haben. Zum Teufel, ich bin ein redlicher Mann. Alles übrige habe ich satt, und man wird es sehen.«
Er meinte Lady Olympia und suchte nach ihr. Aber sie war verschwunden. Sie hatte Jakobus auf die Terrasse hinausgezogen und bis vor den Eingang zum Saal der Venus. Niemand hatte es gesehen als Siebelind; er entfernte sich, von Haß gequält und seufzend vor Begierde. Lady Olympia sagte:
»Der leise Wind der Lagune an einem Maiabend, das ist die rechte Luft für zwei entsagungsvolle Liebende gleich uns. Wollen wir ein wenig weinen? Knien Sie vor mir nieder, teurer Mann!«
Er lachte, verlegen und gereizt.
»Nehmen wir einmal an, unsere Wartezeit sei zu Ende.«
»Schon? Aber das wäre ja unanständig. Ich schmachte erst vierzehn Tage, wissen Sie. Und dann habe ich nichts anzubieten zum Zerbrechen und Zerschmelzen. In einer Brust, die Sie lieben, beanspruchen Sie Diamanten und Eisklötze.«
»Ich hatte das gerade in einem alten Buche gefunden. Schließlich tue ich es auch ohne das.«
»Wirklich? Und begnügen sich bei der Brust, die Sie lieben, mit der Außenseite? Einerlei, wir sollten den sonderbaren Zustand der Enthaltsamkeit nicht so schnell aufgeben. Ich kannte ihn noch nicht, kaum habe ich ihn gekostet – und wer weiß, ob er wiederkommt. Sie sehen mich wehmütig.«
»Aber ich bitte Sie um Glück.«
»Belieben Sie zu bemerken, daß nicht ich die Fordernde bin. Ich gewähre.«
Sie erhob ihre schimmernd weiße Hand bis an ihr rosiges Gesicht und reichte sie ihm, in einem großen Bogen. Er fand ihre Gebärde königlich. Er beugte, im Blute erschüttert, ein Knie und senkte seine Lippen auf ihre blitzenden Fingernägel. Plötzlich überkam ihn das Bedürfnis, zu prahlen und seine Männlichkeit zu beleuchten. Er deutete in den Saal hinein, wo die Bacchanale und reifen Liebesfeste im Abendstrahl aufschäumten.
»Ich denke«, sagte Jakobus, »Sie werden bei mir etwas mehr suchen als die einzige Nacht, die Sie jedem gewähren. Sie wissen, wer ich bin, und daß wir das alles … diese ganzen Wände voll … mit einander durchzuschwelgen haben.«
»Machen Sie wahr, was Sie gemalt haben«, erwiderte sie gleichmütig. »Ich habe von Anfang an darauf gerechnet; Sie werden sich dessen entsinnen. Die schönen Sachen sind für mich Versprechungen …«
Sie lachte mit feuchten Lippen und legte den Kopf in den Nacken. Er küßte sie stürmisch auf den dargebotenen Hals. Sie schwankte ein wenig, riß ihn mit, und umklammert taumelten sie bis gegen die Füße der ungeheuren Frau aus Marmor, die sich erdolchte.
»Meine Gondel wartet«, erklärte sie darauf, und führte ihn an der Hand durch die Reihe der Kabinette, mit langen, elastischen Schritten, sachte und zufrieden. Sie fügte hinzu:
»Als Sie heute so wütend für die Rechte der Seele fochten, da wußte ich genau, wie es mit Ihrem Fleische stand.«
Und am Ausgang:
»Und bedenken Sie, wie wir ungewöhnlich glücklich sind. Denn bei all dem Liebesgeflüster, wovon es zwischen den olivengrünen Wänden heute den ganzen Nachmittag geschwirrt hat, ist wahrscheinlich weiter nichts herausgekommen, als unsere Nacht.«
Im Kanal bemerkte sie, wie die Dolansche Gondel um die Ecke verschwand.
Mortœil war mitgefahren. Der Alte saß, aus Furcht vor der Feuchtigkeit des Abends, unter dem Felze; die beiden jungen Leute blieben draußen. Mortœil versetzte:
»Ihr Papa hat mich zum Einsteigen aufgefordert. Überhaupt ist seine Freundlichkeit gegen mich ganz gleich geblieben.«
»Warum nicht?« meinte Clelia. »Sie wären ihm recht gewesen als Schwiegersohn. Die Schuld liegt an uns.«
Mortœil schluckte hinunter.
»Sollten wir uns nicht eigentlich geirrt haben?«
»Lassen Sie doch endlich die Frage ruhen. Wir waren ja einig darüber, daß wir uns nicht verstehen.«
»Verzeihen Sie. Werde ich Ihnen lästig?«
»Sie setzen mich eher in Erstaunen. Brechen wir ab. Wir sind ja doch nicht imstande, über unsere Heirat ernsthaft zu reden.«
»Ich fühle mich imstande«, erklärte Mortœil.
»Warum glaubt sie mir nicht?« dachte er, ehrlich gekränkt, und vergaß ganz, daß er nur mit Worten spielte.
»Nun gut«, sagte Clelia, und sie lachte übermütig, »malen wir’s uns also aus. Wir lehnen unsere Wappenschilder aneinander. Wir lassen Ihr bretonisches Waldschloß sich im Großen Kanal spiegeln, und der Palazzo Dolan soll sich in dem Sumpf um die Burg Mortœil herum betrachten, wie in einem toten Auge. Ich setze meinen Gatten in die Tiefe unseres Palazzo und ziehe den Schlüssel ab. Draußen würden wir uns nur die Wege durchkreuzen; Sie sind zu bürgerlich veranlagt, wie Sie wissen. Aber ich will, so oft ich über eine einflußreiche Persönlichkeit Herrschaft gewinne, für Sie sorgen. Sie sollen einen Orden bekommen. Haben Sie schon einen?«
»Ja. Den russischen Stephansorden für Bildung. Ich bekam ihn aus Anlaß meines Stückes«, erwiderte er kurz und kalt.
»Sie sollen also auch Ritter der italienischen Krone werden, was mehr wert ist. Wenn mir ein Maler zu Füßen liegt, nötige ich ihn, Sie zu malen …«
Er unterbrach ihr Geplauder.
»Hören Sie, Clelia, Sie verletzen mich ernstlich. Sie scherzen mit Dingen, die mir heilig sind.«
»Nicht böse sein«, bat sie und sah beschämt und kleinlaut aus. »Ich war leichtfertig, ich will es wieder gutmachen. Da …«
Sie streckte ihm die Hand hin, lieblich und treuherzig.
»Ich will Ihre Frau sein.«
»Um des Himmels willen!« hätte er fast ausgerufen. Er schloß den Mund und überlegte.
»Will ich merken lassen, daß ich hineingefallen bin? Will ich das?«
Und inzwischen hatte er schon ihre Hand erfaßt. Sie hielten vor dem Palazzo Dolan. Trotz aller Aufforderungen des Grafen ging Mortœil nicht mit hinauf. Er blieb auf der Landungstreppe stehen und sagte sich, daß das eine schöne Geschichte sei. Er war verstört und vernahm Properzias Drohung: »Du hast geschworen, Maurice. Denke daran, bleibe einfach und treu, und tue keinen Schritt mehr in den künstlichen Garten. Du weißt nicht, wie das furchtbar wäre!«
»Was soll furchtbar sein?« fragte er dann und zuckte die Achseln. »Mit der Frau ist nicht zu reden. Was kann sie tun. Und was will sie. Denkt sie mich für die Zeit meines Lebens in ihr Atelier einzusperren, wie sie’s einmal, in Sankt Petersburg, schon versucht hat. Sie wird sich damit abfinden, daß ich heirate. Dies ist sogar das einzige Mittel, um ihr klar zu machen, daß wir miteinander fertig sind. Sie ist so schwer von Verständnis. Übrigens kann ich ihr vorher ein paar – Freundlichkeiten erweisen, wenn sie jetzt wirklich dazu aufgelegt ist … Vielleicht auch nachher. Im Grunde bin ich zufrieden. Also man begehrt dich, mein Lieber. Du bist dir heute einen Augenblick lang ein wenig aussätzig vorgekommen. Das war ein Irrtum. Man will dich zum Gatten! Und zum Liebhaber! Auch die Olympia wird sich besinnen … Alle Lorbeeren sind noch nicht abgeschnitten, wir werden noch im Gehölz spazieren.«
Der Gondolier wartete auf seine Befehle. Mortœil verharrte noch immer auf den alten Marmorstufen, und sah hinunter zu seinem Spiegelbild im Wasser. Er wandte sogar den Kopf zur Seite, um auch den Anblick seines Profils zu genießen.
»Narziß«, sagte er vor sich hin und zuckte nochmals die Achseln.
· · ·
Zwanzig Stunden später wußten alle, daß Clelia und Mortœil sich aufs neue verlobt hatten. Die Herzogin eilte zu Properzia. Sie fand sie in ihrem hellen, weiten Atelier am Rio di San Felice, wie sie mit Hammer und Meißel in Händen, bebend und entrückt, an der Wölbung eines ungeheuer breiten, halbrunden Reliefs hin und her eilte. Die Herzogin deutete die Bilder.
»Das sind die Liebenden in der Hölle! Das sind, in einem irren Flug, wie Stare im Winter, jene Verdammten, die Liebe vertrieb aus unserm Leben, und die nun umherwirbeln in der purpurnen Nacht, unter dem entsetzlichen Auge des Minos. Da vorn tritt er selbst prall aus dem Block, mit gefletschten Zähnen, und wirft sich den Schweif zweimal um den Leib.«
»Properzia«, bat die Herzogin, »wollen Sie mich nicht einmal begrüßen? Ich möchte Sie küssen dafür, daß Sie arbeiten.«
Aber die Bildhauerin hörte nichts. Brennenden Auges, mit zusammengepreßtem Munde flog ihr schwerer Körper von einer Marmorgestalt zur andern, und ihre zornige Hand hieb, eine Rächerin, auf jede ein, verließ sie und kehrte zu ihr zurück, als dürfe keine der bang Ächzenden in der Runde je erkalten und Ruhe erlangen.
»Ist es nicht«, dachte die Herzogin, »als sei Properzia selbst die höllische Windsbraut, die diese im Leben von ihren Trieben Umhergejagten nun durch die Ewigkeit hetzt? Oder ist sie der Abgrund und der Fels, an dem die Elenden der göttlichen Tugend fluchen?«
Und inzwischen sah sie unter dem Meißel Properzias bald hier, bald dort einen Muskel schwellen oder ein paar Lippen das Licht erreichen und aufseufzen aus dem harten, glatten Stein heraus. Der Sturm der verrenkten, brünstigen und hoffnungslosen Leiber wirbelte immer schneller, schauerlich und ohne Atem. Semiramis strotzte, Dido klagte berauschend, Kleopatra, von Lüsten entfleischt, drückte ihre Fingerspitzen auf die harten Knospen ihrer Brüste. Helena wehte dahin, weiß, kalt, unschuldig. Achill, nur der Liebe unterlegen, bäumte sich, und ihm nach sausten Paris und Tristan und mehrere noch und immer mehrere – und endlich auch sie, die zuviel von Lancelot gelesen hatten, und die beide weinten.
Properzia verweilte bei diesen Beiden, und ihr Hammer zitterte. Er legte die süßen Fleischessünder einander in die Arme. Die Herzogin umfaßte von hinten ihren Kopf.
»Haben Sie wenigstens mit diesen Mitleid? … Properzia, hören Sie auf! Sie ängstigen mich.«
»Lassen Sie mich, ich muß fertig werden!«
»Ich versichere Ihnen, daß Sie gar nichts fertig bekommen werden bei dieser rasenden Arbeitsweise. Sie sind ja feucht und kalt. Auch Ihre Hände sind kalt und schwingen doch schon stundenlang den Hammer. Für wen peinigen Sie sich so? Wer drängt Sie?«
Properzias Lippen trennten sich nicht. Ihr Blick war ganz in den Stein vergraben; er holte alle Qualen der Unterwelt daraus hervor, so tief sie sich darin verbargen.
»Hören Sie, Properzia«, rief die Herzogin. »Sie werden nicht länger auf Francescas weinende Augen losschlagen. Ich lege meinen eigenen Kopf darüber – so, nun treffen Sie mich!«
Properzia erwachte endlich. Die Herzogin entführte sie nach dem Lido. Sie fuhren bei San Niccolò den kleinen Wasserarm hinein und wanderten, von Störern fern, über Dünen und dürres Gras, bis ans Meer. Die letzten Wolken hoben sich von ihm empor, wie ein Vorhang. Es hing, am Ende eines bewegten Regentages, ganz still, ganz besänftigt, ganz unschuldig und weißblau, senkrecht vom Himmel hernieder. Ein spinnenleichter Rosenschleier, wehte der Horizont darüber hin. Ein paar Segel flammten, vom Abendlicht getroffen, gelb auf.
Die Herzogin ging dicht am Ufer hin, auf festem Sand und über den Teppich von Muscheln, blauen, weißen, gelbroten und violetten. Jede kleine Biegung des Ufers nahm sie liebevoll mit. Properzia kam nach, schwer atmend. Plötzlich blieb sie stehen und murmelte:
»Ich ersticke, wie ein ganz junges Mädchen im Frühling.«
»Diese Luft erdrosselt«, meinte die Herzogin. »Sie ist wie eine Schlinge aus Glasfäden, biegsam, weich, glänzend und sehr stark.«
Sie sah sich um. Properzia hatte mit der Spitze ihres Schirmes in den nassen Sand eilige Buchstaben gezeichnet. Eine kleine Welle, spielerisch und munter, leckte sie weg. Properzia sagte kraftlos:
»So ist es. Täglich grabe ich meine Zärtlichkeiten und meine Angst in sein Herz – und täglich wird alles fortgespült.«
»Und er hatte geschworen!« sprach sie weiter. »Diesmal hatte er geschworen! Er wollte niemals mehr den künstlichen Garten betreten, worin wir uns gegenseitig so viel Leid zugefügt haben. Und gleich, am selben Abend, ist er wieder hineingegangen und hat sich seine Braut herausgeholt … Ah! Die wartete auf ihn unter den Rosen aus Stein und den Myrten aus Porzellan. Sie passen für einander! Sie werden sich belügen, verspotten und von Liebe nur wie von einem Spiel wissen – aber sie werden sich genießen. Mich aber – o, ich bin stolz – mich hat er, in all den Jahren, nie besessen!«
»Wie, Properzia, Sie haben sich nie von ihm lieben lassen?«
»O, ich bin stolz! Ich bin ein Bauernkind aus den römischen Bergen, ich bin wild geblieben und habe nie einem Mann gehorcht … außer einem«, setzte sie hinzu, leise und durchschüttelt. »Er war zu stark.«
Sie seufzte auf. Sie fühlte in der gedankenlosen Wollust des Augenblicks ihre große Menschlichkeit untergehen. Ihr Schmerz, von tausend Hammerschlägen tagsüber gehärtet, er löste sich auf in diesem schmelzenden Maiabend, er zerteilte sich über den Himmel mit dem Sonnenrot, rann mit dem Sande die Dünen hinunter, verging in nutzloses Geplauder wie irgend eine schwache Strandwelle. Sie redete, dem Meere zugewandt. Sie sagte, wer sie war: sie verriet es dem Meere.
»Ich sehe noch das weite Feld … Es ging auf Weihnacht. Wir wollten im Kamin den Ceppo verbrennen, droben in unserm braunen Felsennest. Wir brauchten Reisig, den großen Weihnachtsklotz damit anzuzünden. Pierina und ich, wir waren hinabgestiegen in die Campagna. Wie war sie braun und endlos! Ihre dürren Borsten glitzerten vor blauer Sonne, und die Tramontana wollte sie abbrechen, wie Glas. Sie tobte darüber hin und jagte den sausenden, blauen Himmel entlang die mehlweißen Wolken, schwindelnd und wie mit Gelächter.
Da kam er und lachte auch. Er schrie schon von fern, gegen den Wind, daß er uns haben wolle, uns alle beide. Er war mager und trug den Hut im Nacken. Sein Anzug war von allen Wettern gebleicht und seine Haut gegerbt von allen Stürmen. Wir spotteten, und wir drohten mit den Messern. Wir hatten Zweige geschnitten aus den Dornenhecken beim Fluß. Wir waren groß und stark … Er fiel gleich über mich her, die Stärkere, und kämpfte mit mir. Sein Genosse, ein kleiner Schmutziger, hielt Pierina fest, bis er auch zu ihr kommen würde … Ich stach ihn mit dem Messer in den Arm. Er lachte, und schlug es mir aus der Hand. Plötzlich riß Pierina sich los. Das Wasser klatschte auf: sie war hineingerannt. ›Spring nach!‹ schrie der, der an meinem Gesicht keuchte. ›Natürlich bist du zu feige!‹ Er stampfte auf; für eine Sekunde vergaß er mich. Ich rannte zum Fluß.
Es waren nur fünfzehn Schritte. Was sah ich alles während dieser fünfzehn Schritte, und was dachte ich alles! Ich sah: Pierina fährt mit dem Strom von dannen, der kleine schmutzige Mensch wirft ihr einen Strick zu, sie nimmt ihn nicht, sie wird ertrinken. Das wirst du auch, sage ich zu mir, und renne. Er ist hinter mir und lacht. Ich sehe die Jagd der Wolken, und wie ihre Schatten über das Feld laufen. Ich denke: Diese Wolke sieht aus wie ein Sack und die daneben wie ein Lamm; ehe sie zusammengeflossen sind, liege ich im Wasser … Ich sah einen blitzenden Flug wilder Tauben. So ging er: rechts, in die Höhe, und geradeaus. Ich sah, daß der Wald, in meilenweiter Ferne, bald blau war und bald schwarz. O, jeden der Himmelsausschnitte zwischen seinen Bäumen könnte ich noch heute mit den Fingern in die Luft zeichnen! Davor drängt sich eine Schafherde, winzig, verloren im Raum. Ich unterscheide sogar den Hirten. Er ist wohl eine Stunde entfernt, und ich schreie, gegen den Wind, er solle kommen und mir helfen. Plötzlich denke ich: Jetzt helfen mir weder Menschen noch Gott, und lasse mich hinfallen, und er nimmt mich. Er nimmt mich lachend und geht weiter. Pierina ist drüben am Ufer.«
Die Herzogin lauschte und gedachte dabei ihrer eigenen Vergewaltigung durch den von der Anbetung der Masse strahlenden Tribunen. Sie gedachte auch alles dessen, was sie seitdem gefühlt hatte und erträumt und durchgespielt und zum Leben erweckt. Plötzlich sagte sie:
»Und darauf wurden sie eine große Künstlerin.«
»Darauf ging ich immerzu, immer weiter weg von der Heimat, und bis nach Rom. Ich ward die Magd eines Bildhauers, des Celesti. Er wußte nicht, der Arme, daß ich ihm acht Jahre später sein Grabmal meißeln würde. Bald holte er mich aus der Küche in die Werkstatt und ließ mich arbeiten. Ich wurde gelobt und bezahlt. Ich fühlte, ich sei eine. Aber wenn ich bedachte, was in meinem Grunde war, so saß es dort wie ein schwarzes, rauhes Tier. Niemand durfte davon wissen; ich aber war ihm verschrieben. Es verschaffte mir Ehre und Geld. Und wenn sie mir sagten, ich sei groß, so ward mir düster zu Mut, und so oft ich den Meinigen Geld schickte, meinte ich, sie zu beflecken mit Sündenlohn … Ja«, sagte Properzia, und starrte mit einem Blick, schwer vom Schicksal, der Herzogin in die Augen – »ich bin eine große Künstlerin, aber auf einem weiten Felde überwältigte mich einmal ein Landstreicher.«
Sie schwiegen.
»Und Ihre Freundin?« fragte dann die Herzogin. »Sie, die bereit war, ihre Jungfräulichkeit mit dem Leben zu bezahlen. Was ist aus ihr geworden?«
»Pierina? Sie kennen sie gewiß. Es ist Pierina Fianti.«
»Die so berühmt wurde durch den Bankerott des Marchese Pini? Eine Courtisane! … Die unerwartete Zukunft, die wir in uns herumtragen! Sie, Properzia, waren bestimmt, einen kleinen, lächelnden Pariser zu lieben. Sie wissen doch, daß er ein Geck ist, der nicht darüber wegkommen kann, daß seine zerbrechlichen Reize die große Properzia in Aufruhr versetzt haben.«
»Ich weiß es. Was hilft es mir?«
»Er schämt sich Ihrer, und fühlt sich doch geschmeichelt. Verstehen Sie so viel Kleinheit.«
»Ich verstehe. Was hilft es mir?«
»Er weiß nicht mehr ein noch aus. Darum heiratet er. Sie müssen ihn entschuldigen, es ist seine letzte Zuflucht vor Ihnen.«
»Ich weiß alles. Ich bin zu ihm geeilt und nicht empfangen worden. Ich habe ihm eine Karte geschickt mit der Frage, ob er wolle, ich solle mich töten. Er hat mir geschrieben, er bedauere das Mißverständnis. Er rate mir zu heiraten, oder sehr viel zu arbeiten.«
»Der Philosoph! Und bedauern Sie nicht wirklich das Mißverständnis, das dieses kluge Schattendasein mitten unter Ihre gewölbten, herausfordernden Marmorgötter verschlagen hat?«
»Ich … darf nicht. Es gibt weder Wahl noch Irrtum. Zehn Jahre lang habe ich nur diese marmornen Götter gekannt und keinen Mann. Kaum aber war Maurice auf meine Schwelle getreten, so füllte sich mein Atelier nur noch mit seinen Hermen. Ich behielt ihn einfach, ich schleppte ihn durch Europa. Er hat recht, er war nicht viel mehr als mein Impresario. Wenigstens wußte es niemand, wie viel mehr er mir war. Für mich stand er auf jedem Piedestal. Wenn er ging, verödeten alle. Wie oft habe ich ihm das Fortgehen verbieten und ihn einschließen wollen, gleich jenem Dolan, der seine Sklavin einschloß. Einmal tat ich’s: in der Nähe von Sankt Petersburg, in dem ländlichen Hause am Waldessaum, wo ich für den Großfürsten arbeitete. Maurice stand allein vor seiner eigenen Büste. Ich hatte sie vollendet und mit Rosen bekränzt. Ich betrachtete ihn: mir schien es, daß alle Zärtlichkeit, die vor zehn Jahren, auf einem weiten Felde, in mir niedergestampft war, sich plötzlich aufrichtete, warm und genesen, aber voll Angst. Ich ging auf den Fußspitzen hinaus und schloß ab. Ich schlich durch alle Zimmer und immer wieder zu der verschlossenen Tür, hinter der er vor seiner Büste stand. Und ich horchte und wartete, und schwelgte in meinem heimlichen Besitz, und zitterte. Aber am Ende zitterte ich nur noch. Der Schlüssel ward glühend in meiner Tasche. Ich schob ihn ins Schloß und öffnete. Maurice drehte der Büste den Rücken zu; er saß und rauchte. Ich stammelte Entschuldigungen, die Dienerin habe abgeschlossen. Er lächelte, und ich verging vor Furcht, er könne die Wahrheit ahnen.
Heute glaube ich, er ahnte gar nichts. Er ist voll von Feinheiten und verfällt nimmermehr auf etwas so Grobes wie das, was mir einst geschah, auf dem Felde, in Wind und Sonne … Und vielleicht, vielleicht habe ich gar nichts anderes gewollt, in all meiner Zärtlichkeit, in all meiner Sehnsucht nach einfacher, immer gegenwärtiger Liebe, frei von List, Scham, Enttäuschungen – vielleicht habe ich im Grunde gar nichts anderes gewollt, als noch einmal so ergriffen und vergewaltigt werden, wie damals von einem Landstreicher … Ich habe es ihm gesagt …«
»Ihm selbst gesagt?«
»Aber er begreift nichts. Eine Properzia nimmt man doch nicht, meint er. Man bittet sie nicht einmal. Wahrscheinlich hat er recht. Und doch habe ich mit ihm schon ebensoviel gerungen, wie mit dem Landstreicher. Aber wir rangen in der Seele. Ich habe ihn oftmals festgehalten, wenn er schon hoffte, mich verachten zu können. Der Großfürst hat ihm einen Orden gegeben, weil ich es verlangte – um ihn lieben zu dürfen … Er hat sich verlobt; ich war blind, als ich es ihm erlaubte. Ich habe ihn zurückerobert, und in dem Augenblick, als er keine auf der Welt begehrte außer mir, hat Lady Olympia ihm gewinkt, und er ist mit ihr gegangen. Dann ist er nochmals zurückgekehrt, ich habe ihm verziehen – und trotz seiner Schwüre holt er sich zum zweiten Male die Braut.«
»Es wäre Zeit, mit ihm fertig zu werden«, sagte die Herzogin. Die fieberhafte Sprache der blassen Frau beunruhigte sie.
»Ich werde es. Er hat mich in die Irrwege des künstlichen Gartens eingeführt. Jetzt verwickele ich ihn selbst darin. O, mein Gefühl war so einfach wie die Steine, an denen es sich sonst ausgelassen hatte! Ich war dumm, ich konnte nicht reden. Meine Hand zwang den Stein, er redete für mich. Jetzt weiß ich Listen, die weh tun! Ich hatte ihm ein Andenken geschenkt, daß mir das herzlichste war: meine liebe Faustina – und er hat sie achtlos fortgegeben. Jetzt will ich ihm ein anderes Erinnerungszeichen hinterlassen, das soll ihm noch lange im Blute brennen!«
»Was wollen Sie tun?« fragte die Herzogin. Sie sah Properzia schwanken.
»O, ich weiß, was ich tun will. Ich habe etwas ausgesonnen, Sie ahnen nicht, es überbietet die schwierigsten Verführungskünste, mit denen je eine brünstige Abenteurerin einen Mann gepeinigt hat. Lady Olympia gibt sich nur eine einzige Nacht, und hinterläßt ihrem Geliebten das Bedauern, sie verloren zu haben. Aber sie gibt sich doch, nicht wahr, und das Bedauern wird gemildert durch einen Tropfen Genugtuung. Ich weiß aus den Pflanzen des künstlichen Gartens ein viel besseres Gift zu gewinnen … Einer stirbt sicher daran, hoffentlich wenigstens einer. Und die Büste dessen, der übrig bleibt, soll noch einmal bekränzt werden, wie damals. Er soll wieder davor stehen und sich bewundern und seinen Sieg!«
Die Herzogin nötigte sie weiterzugehen.
· · ·
Vom siebenten Juni an hüllte sich die Lagune in schwere Dämpfe. Man schlich beklommen durch eine stehende, feuchte und heiße Luft. Alle Gegenstände fühlten sich schlüpfrig an. Die Riva saß voll matter Eisesser.
Die Herzogin traf mit Mortœil zusammen; er sagte:
»Ich hasche nach ein wenig Kühlung, bevor ich zu Properzia gehe.«
Sie bemerkte seinen Gesellschaftsanzug.
»Properzia hat Sie eingeladen?«
»Jawohl … eingeladen, wenn man das Wort gebrauchen will.«
»Ich glaube Sie zu verstehen, und ich sage Ihnen: hüten Sie sich.«
»Wieso? Vor allem befolge ich Ihren Rat, Herzogin. Sie trauen mir wohl zu, daß ich mich sonst in Schweigen hüllen würde. Aber wenn ich das Stelldichein annehme, zu dem Properzia mich ruft, so geschieht es eben, weil Sie mir geraten haben, die Gefühle der armen Frau zu besänftigen.«
»Durch eine … Liebesnacht.«
»Die gute Properzia, wie wenig mir an ihrer Liebesnacht gelegen ist. Überdies bin ich Bräutigam … Aber wenn ich mit meiner Verlobten die Angelegenheit besprechen könnte – es gibt nun einmal Gegenstände, die man vor jungen Mädchen nicht berührt – jedenfalls wäre Clelia vorurteilsfrei genug, um meine Handlungsweise zu billigen. Sie würde etwas von ihren Rechten opfern, davon bin ich überzeugt, um die arme, große Properzia friedlicher und glücklicher zu sehen. Und es ist ja in meine Macht gegeben, nicht wahr, sie friedlicher und glücklicher zu machen.«
»Wie glücklich sind Sie selbst!« rief die Herzogin. »Sie haben der Properzia Ponti schon eine ganze Reihe von Bildern der verzweifelten Leidenschaft eingegeben. Jetzt erwecken Sie in ihr auch noch die Werke der befriedigten, frohlockenden Liebe. Sie Auserwählter inspirieren die größte Künstlerin unserer Tage!«
»Sie glauben?«
»Und Sie verdienen es«, setzte sie hinzu, und ihr Hohn war so vollkommen beherrscht, daß Mortœil vor Vergnügen errötete.
Einige Tage später sah sie ihn wieder, im Atelier der Bildhauerin. Es war voll von Besuchern, die das fertige Relief bestaunten, mit dem stürmischen Reigen der verdammten Liebenden. Mortœil saß allein, über seine Knie gebeugt, versunken. Er sah übernächtig aus, seine Augen waren ein wenig glasig. Oftmals stand er auf und drängte sich, mit künstlicher Spannkraft, an Properzia heran, die ihn übersah. Sie war nicht, wie sonst, eine stumme Weiserin ihres Werkes; an diesem Tage hatte sie Geist. Die zufälligen Gäste lauschten ihr, es war ihnen, als hörten sie den Marmor selbst sprechen. Sie sahen sich an, erstaunt darüber, wie sehr sie genossen. Mortœils mühsam gespitzte Bemerkungen blieben unbeachtet. Die Herzogin streifte ihn mit einem Blick; sofort wählte seine Angst sie zur Vertrauten.
»Es ist albern. Ich komme mir wahrhaftig ein wenig aussätzig vor«, stammelte er. Er faßte sich.
»Was wollen Sie? Ein unglücklicher Tag. Properzia ist Stimmungen unterworfen.«
Aber als sie das nächste Mal wiederkam, fand sie ihn unter gleichen Verhältnissen. Sie blieb bis zuletzt. Mortœil war davongeschlichen hinter den andern. Die Herzogin äußerte:
»Er macht einen recht heruntergekommenen Eindruck. Was haben Sie nur mit ihm angefangen? Seine Augen sind wie heißes Glas.«
»O«, machte Properzia langsam – und sie ging, fieberblaß, umsichtig und gespannt, durch die weite Werkstatt, als folgten noch immer fünfzig neugierige Blicke ihren Wendungen.
»Er sieht seit neulich, seit unserer seltsamen Nacht, eine Properzia, die die andern nicht sehen. So oft er kann, tuschelt er an meinem Ohr, und ich spüre dabei noch immer über mein entkleidetes Fleisch seine Begierden hintasten wie warmfeuchte Fingerspitzen.«
»War Ihre Nacht so seltsam?«
»Fragen Sie ihn. Er hat sich von seinem Schrecken noch nicht erholt. Ich ließ ihn kommen. Wie er den Vorhang meines Zimmers aufnahm, erblickte er mich ganz nackt, auf einem Liegestuhl, zwischen Fellen und Kissen. Ich war sehr schön. Zum erstenmal in meinem Leben fühlte ich die hohe Kunst, die ich sonst im Marmor vergrabe, in meinen Gliedern. Die Kerzen standen schräg hinter mir: Kopf und Hals lagen zurückgebogen und dämmerig. Auch der untere Teil der Beine verschwand. Aber von den Brüsten bis über die Schenkel fiel das goldgelbe Licht. Es glitzerte um mich her in der halben Finsternis von goldenen Körnchen in schwarzer Gaze. Der Goldbrokat hinter meinen Schultern brannte dunkel. Ich hatte eine Hand unter mein Haar geschoben. Der Arm zerdrückte breit seine Muskeln. Maurice unterschied die samtenen Schatten in den Achselhöhlen. Ich wandte mich über meine gewölbte Hüfte hinweg ihm zu, wie er eintrat: er hatte Furcht.
Ich wartete auf ihn, ohne ihn zu begrüßen, und beobachtete gelassen seine Schritte. Sein Atem streifte meine Brüste; ich konnte nicht verhindern, daß sie warm wurden, da sein Atem brannte. Er belebte mich erst mit seinem Atem, dann mit seiner Stimme und schließlich mit seinen Händen, die zitterten. Er war Pygmaleon. Ja, ich, unter deren Händen er immer nur ein Stück weichen Tons gewesen ist, ich habe ihm die Einbildung vergönnt, als holte er sich eine Geliebte aus dem Marmor meines Leibes! Aber wie er am Ende zugreifen wollte, merkte er wohl, daß ich noch immer Stein war. Er prallte ab. Jedesmal wieder prallte er ab – und dabei verging die Nacht.
Er zeigte sich anfangs nur erstaunt: ich war so viel stärker als er. Er sprach einige Worte, die mein Verhalten mißbilligten. Ich schwieg. Dann unterrichtete er mich davon, daß er mich liebe. Ich betrachtete ihn stumm. Zum Schluß versuchte er, um sich seine Männlichkeit zu bestätigen, einen gewaltsamen Angriff. Aber er flog, ohne sich zu beschädigen, gegen die mit Teppichen behangene Wand. Darauf schleuderte er die Arme umher, blaß vor Zorn, und rannte zum Ausgang.
Aber er sprang sofort aus den Falten des Vorhangs wieder zurück. Die Tür war von außen verschlossen. Ich hatte sie verschließen lassen, ich hatte es zum zweiten Male gewagt, den Mann, den ich liebte, zu rauben und einzusperren; aber diesmal schlich ich nicht draußen mit Zittern umher. Ich saß nackt und unbarmherzig in dem leeren, weich ausgepolsterten Gemach, wo die Schwüle der Regennacht zwischen Teppichen gefangen lag. Er schritt vor mir auf und ab, den Kopf hoch und seiner Sache nun ganz sicher. ›Sie wissen, daß das Freiheitsberaubung ist?‹ fragte er, ›und daß das Gesetz Sie dafür bestraft?‹ – Aber er bekam keine Antwort. Und allmählich vergaß er sein kühles Rechtsbewußtsein und verfiel in Wut. Er drohte, mich zu entehren, mich zum Gerede der Gassen zu machen, mir die anständigen Häuser zu verschließen. Er rüttelte an der Tür und schrie Öffnen! Seine Stimme erstickte in den Stoffen, und er überlegte am Ende, daß es für einen Pariser im Frack ein verzweifelter Schritt sei, Hilfe herbeizurufen in dem Augenblick, wo ihn ein verlockendes Gemach gefangen hielt zusammen mit der nackten Properzia Ponti.
Inzwischen war er erschöpft, er sah sich nach einem Sitz um und fand keinen. Er kniete bei mir hin und bat, sanft und schwach wie ein Kind. Auf einmal besann er sich und lobte meinen gelungenen Scherz. Ich bemerkte, daß seine Zähne aufeinander schlugen. Ich erlaubte seinen Händen, die flogen, keine Berührung mehr mit meinem Fleische. Und endlich wimmerte er und wand sich vor meinen Gliedern, zerstört und in Tränen. Ich wartete ab, bis er sich ein letztes Mal, verzweifelt und kaum noch begehrlich, auf mich gestürzt hatte. Er bereute es sofort und lächelte so liebenswürdig, wie nur er lächelt, und wollte wohl sagen: ›Entschuldigen Sie, ein solches Betragen schickt sich nicht für einen wohlerzogenen Mann wie mich, ich weiß es wohl; aber in was für sonderbare Lagen kann man geraten‹ … Dann ließ er sich langsam auf den Boden nieder, fröstelnd vor überreizter Mattigkeit. Die Kerzen erloschen, es ward Morgen hinter den Teppichen. Ich warf ihm eine Decke zu; es war die einzige, mitleidige Gunst, die ich ihm gewährte in dieser Liebesnacht. Kein Wort habe ich zu ihm gesprochen in dieser Liebesnacht.«
»Sie haben sich gerächt«, sagte die Herzogin. »Sie müssen zufrieden sein.«
»Ganz zufrieden«, bestätigte Properzia. »Ich brauche nichts weiter. Jetzt fragt er mich täglich, ob er seine Verlobung brechen solle. Ich erkläre ihm, es sei unnötig. Er fleht, sein Leben in meinem Dienst abnutzen zu dürfen. – Es sei zu spät, antworte ich. – Er wolle überall hin mir folgen. – Er werde bald einen Schritt zurücktreten, verheiße ich ihm, wenn er sehen werde, Properzia habe sich einen Schritt zu weit vorgewagt.«
»Alles in allem: wie ist er unglücklich!« rief die Herzogin.
»Ja! Wie sind wir unglücklich!« murmelte Properzia.
· · ·
Eiliger als es erwartet war, bestimmten Clelia und Mortœil ihren Hochzeitstag. Am Vorabend in der Dämmerung erschien Properzias hinkender Diener, heulend vor Entsetzen, bei der Herzogin: seine Herrin liege im Sterben.
Die Herzogin fuhr hin. Der Kanal war voll von Gondeln. In ein Lastschiff ward ein ungeheurer Marmor geschafft: das Relief aus der Hölle. Der Graf Dolan befehligte die Arbeiter, in seinen Kleidern eingeschrumpft, faltig und herrisch.
»Ich habe es!« rief er der Ankommenden entgegen. »Ihr letztes Werk ist mein. Properzias zersprengte, herrenlose Kraft, von ihr selbst verloren gegeben – ich, ich allein habe sie noch einmal zurückgebannt. Dies Werk ist dem Nichts entrissen, worin Properzia schon untergetaucht war – und der es herausriß, bin ich!«
»Was befähigte Sie dazu?«
»Etwas ganz Einfaches«, erklärte der Greis, und in den Furchen seines Grinsens glitten Hohn und Liebe durcheinander. »Der Besitz ihrer Seele! … Erstaunen Sie nicht, Herzogin. Properzias Seele nennt sie selbst ihre liebe Faustina. Es ist ein alter Marmorkopf, sie grub ihn einst aus der römischen Erde aus, der auch sie entstiegen ist. Sie gehört dem, der ihre Seele besitzt; und die hatte ich in meinem Palaste eingesperrt. Ich sagte zu Properzia: ›Arbeite! Bis du gearbeitet hast, zeige ich dir deine liebe Faustina nur durchs Schlüsselloch, wie sie am Ende meiner Säle steht. Und nicht einmal deinen Tränen werde ich erlauben, durch das Schlüsselloch zu fließen!‹ … Sie hat gearbeitet. Nun mußte ich ihr nach unserm Vertrage ihre Seele zurückbringen. Sie ist drinnen, betrachten Sie sie, Herzogin! Lange wird’s nicht dauern, und sie entweicht für immer.«
Der Alte wandte sich wieder zu den Lastträgern. Die Herzogin ging hinein in die verlassene Werkstatt. Einsam in der Mitte stand ein Kopf, wächsern abgeschliffen, mit zerbrochener Nase und beschädigtem Schädel. Seine Züge nahmen Abschied im Lichte des Abendhimmels; sie schienen sich strenge zurückzuziehen in den Marmorblock hinein, aus dem sie vor Zeiten erlöst waren. Sie deuchten der Herzogin keusch, groß, mit dem Glücke unbekannt, wie Properzia selbst. Sie dachte:
»Ja, das ist ihre starke und liebereiche Seele! Sie hat sie aus demselben weiten Felde auferstehen lassen, in das einst ein Landstreicher sie hineingestampft hatte. Sie hat sie einem jungen Manne dahingegeben, der sie einmal um sich selbst drehte und sie ›geschickt gemacht‹ fand. Er schenkte sie einem alten Wucherer, und Properzia hat, um sie zurückzukaufen, von den Qualen der zur Hölle verdammten Liebenden verraten, soviel sie davon wußte. Jetzt stirbt sie. Soll ich dorthin gehen, in eines jener Zimmer, wo Neugierige das Ende von Properzias Körper begaffen? Ich will lieber hier Halt machen und glauben, daß ich allein gewürdigt werde, ihrer Seele in das schon verwischte, schon halb entwichene Antlitz zu blicken.«
Die Tür ward geöffnet. Ein Priester, in den Händen etwas mit einem Tuche Zugedecktes, worüber er Grauen und Stolz zu empfinden schien, ging rasch über die hallenden Fliesen. Der Knabe hinter ihm schwenkte den Räucherkessel. Sie verschwanden.
Die Herzogin war in eine tiefe Fensternische getreten; sie erinnerte sich, daß sie im Dämmerlicht einer ebensolchen zu Rom, Properzias erste Klagen empfangen hatte und ihre erste Liebe. Plötzlich bemerkte sie die Büste Mortœils. Seine Stirn, fein, schmächtig und ungläubig, trug eine schmale Lorbeerkrone. Auf dem Sockel lag ein Zettel; die Herzogin entzifferte ihn beim letzten Strahl.
»I’ son colei che ti die’ tanta guerra
E compie’ mia giornata innanzi sera.«
»Ja, das ist der Sieger«, flüsterte sie. »Er mag sich nun vor sein bekränztes Bild stellen und sich bewundern und seinen Sieg. Die Unterlegene ruft ihm ihre Huldigung zu: ›Ich bin es, die so viel mit dir gestritten, und die beschlossen ihren Tag vor Abend.‹
Das ist der Sieger. Ich frage mich: Konnte die große, leidenschaftliche Frau den schwachen Spötter nicht zerdrücken an ihren Steinschultern? Und wenn die Feinheit bestimmt ist, länger zu leben als die Kraft – warum starb dann die arme Blà: sie, ein liebliches Geschöpf des Geistes, das zur unterworfenen Sache ward und zum wehrlosen Opfer eines wohl gebildeten Tieres! Ich frage mich wie damals: Woher droht solch Geschick, und wem droht es nicht?«
Und wie damals schauderte ihr.
Sie wandte sich zum Gehen. Draußen begegnete ihr nochmals Dolan, ein bißchen glückliches Rot auf den Backenknochen.
»Auch das noch wird mein!« rief er. »Auch der Dolch!«
»Der Dolch …«
»… mit dem sie die Tat ausführte … Sie verstehen, Herzogin, bis jetzt hält noch das Gericht die Hand darauf. Aber ich habe ihn mir gesichert. Er ist von Riccio selbst. Am Heft befindet sich ein wundervolles Scheusal aus Elfenbein, eine Venus-Astarte mit zwölf Brüsten! …«
Es dauerte lange, bis ihre Gondel vorfahren konnte. Dann blieb sie sitzen inmitten all der andern, die den Kanal versperrten, und wartete. Es waren Frauen und Männer da aus allen Ländern; in allen Sprachen flüsterte es: »Sie stirbt.« Auf den Brücken und in den Gäßchen, schwarz und feucht vom Scirocco, drängte sich das Volk. Die Weiber hingen über den Geländern, und ihre schwarzen Tücher flatterten über dem schwarzen Wasser. Sie raunten: »Properzia stirbt.«
Aus dem Hause kam der Priester – seine Hände zitterten unter dem Tuche – und entfernte sich rasch über das schmale Ufer. Der Knabe hinter ihm schwenkte den Räucherkessel. Es vergingen noch ein paar Minuten. Und plötzlich begann in der Nähe, auf einer Kirche, ein Glöckchen zu hämmern. Es hämmerte hell und eilfertig; es erstickte in seinem geschäftigen Botenlauf die eigene Angst.
Durch die schwarze Menge auf den Brücken und in den Gäßchen lief scheues Gemurmel. Die Frauen in den Gondeln schluchzten auf. Eine junge Stimme sagte, klar und zitternd:
»Properzia ist tot.«
Die Herzogin winkte zur Abfahrt, die Linke vor den Augen.