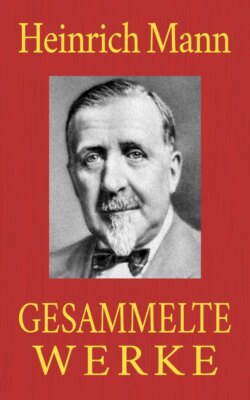Читать книгу Heinrich Mann - Gesammelte Werke - Heinrich Mann - Страница 48
VI
ОглавлениеDen Winter über liebten sie sich, im immerwährenden Krampf einer einzigen Umarmung. Den Stunden, in denen sie einander nicht genossen, wohnten sie bei, mit halbem Bewußtsein und unbeteiligt, als Schatten. Jakobus fragte sich:
»Wie hat sie früher leben können? Bei ihr, und nur bei ihr, ahne ich manchmal, was es von einer Frau sagen will, sie sei zur Liebe geboren – zur Liebe und zu nichts anderem.«
Sie selbst war tief erstaunt.
»Ich verstehe nicht, daß ich ihn mir nicht schon in Rom genommen habe – in dem kleinen schmutzigen Atelier im Vicolo San Niccolò da Tolentino, beim ersten Anblick ihn mir gleich genommen habe, um ihn nie wieder aus den Armen zu lassen. Ich weiß nicht mehr, was ich seitdem getan habe!«
Sie vermißte keinen ihrer alten Freunde. San Bacco wurde in Rom festgehalten, Siebelind in Deutschland. Gina war leidend und gab selten Nachricht. Nino schrieb in Kürze und in mangelhaften Wendungen, er arbeite, härte sich ab, und er denke an sie so wenig wie möglich.
Clelia, verbannt aus der Werkstatt ihres Malers, lebte nur noch in den Gesprächen und Briefen, durch die sie die Welt aufklärte über die neue Laune der Herzogin von Assy. Sie verleumdete nicht, sie setzte nichts hinzu; und im Innersten war sie überzeugt, daß sie beschönige. Was ihre Feindin durchmachte, war nicht nur eine Laune. Clelia, alternd und gelangweilt, spitzte ihren Scharfsinn, neben der stumpfen Schweigsamkeit ihres Gatten. Er war von Paris zurückgekehrt, wo er zwei Monate in den Ecken der Salons umhergestanden hatte. Seine Bekannten begrüßten ihn wie einen neu ausgeschifften Provinzler; und sofort fühlte er all die Schwerfälligkeit auf seinem Geiste lasten, die sie ihm zutrauten. Seine abgefeimte Jugend mit all ihrer Überlegenheit war vergessen. Niemand erinnerte sich seiner einst so berühmten Unverfrorenheit auf der Hochzeit seiner Geliebten, des Kusses, dicht unter der Nase ihres Gatten, und des bonjour, bébé, comment ça va. Geschlagen verschanzte Mortœil sich in seinem Palast am Großen Kanal und streckte fortan mit leichenhaftem Stolz die Beine an den Kamin.
Seine Frau saß dabei, in dem weiten, steinernen Saal; gegen die Schwelle draußen klappte eintönig das Wasser; sie dachte:
»Was mich quält, ist nicht die Lust die sie einander verschaffen, nein, der Ruhm – o, das Machtgefühl des Ruhmes, zu dem sie sich verhelfen. Die Herzogin befehligt jetzt, an seiner Seite, das Aufgebot von Künstlern, Zeitungsleuten, Neidern, Käufern, Schmeichlern, Dummköpfen, Mitessern, die er sich mir zu Liebe nicht halten wollte, und die seinen Namen über Europa hinblasen. Dafür wird er ihr das Werk schenken, ihr allein, worauf die Blätter schon jetzt die Welt begierig machen: die Venus.
Ach! Ich werde keinem verraten, daß diese Venus niemals da sein wird; aber ich weiß es. Er ist ein Geschichtenerzähler. Das höchste was er schafft, ist nicht ein Werk: es ist die Vorstellung die er uns Frauen beibringt, seine Muse zu sein.
Vorläufig hält sie sich für seine Venus. Vielleicht auch hat sie’s schon vergessen. Das Sausen ihres aufgepeitschten Blutes muß jetzt alles übertönen. Sie hat sich, in der erkünstelten Kälte ihrer Einzigkeit, die männliche Liebe so lange versagt! Nun verlangt sie auf einmal eine ganze Sättigung. Die Unmöglichkeit satt zu werden, wird beide in Traurigkeit stürzen, ihn und sie. Und die Wut, dennoch Sattheit zu erreichen, wird in den Wunsch verlaufen zu sterben, oder einander zu töten.
Das ist es nicht, was mich rächt! Ein Tod mitten im Sturm der Sinne, das wäre ein weniger plattes Geschick als meines. Nur ruhig, er ist ihr nicht bestimmt. Ihr Blut, erst eben aufgeweckt, wird sich inmitten alles Zusammenbruchs empören gegen die Vernichtung. Es schreit nach immer heißerem Taumel. Sie wird hingehen wo die Betäubung am sichersten ist, zu Komödianten, Zigeunern, volkstümlichen Stieren. Heute ist sie Königin der vergoldeten Bohême, die sein Atelier sieht. Morgen wird sie es in der fadenscheinigen und überschäumenden sein. Schon sagt man, sie sei mit ihm hinter der Szene des Malibran-Theaters gewesen, und habe lange mit Slicci gesprochen, dem lasterhaften Spaßmacher, zu dem wir unsere Zuflucht nehmen, glaube ich, wenn wir alles Übrige erschöpft haben.
Wenn das wahr wäre! Ich wage es nicht für möglich zu halten. Dann aber wäre alles entschieden. Ihre künftige Laufbahn, ich könnte sie von meinem Stuhl aus in die Luft zeichnen. Die wilde Liebesjagd durch den Süden und Westen des Kontinents; üppige Zurückgezogenheiten in niedrigen Villen hinter Palmenhainen, und lärmende Vergnügungszüge durch Bäder und Spielhäuser, geschminkt, fieberhaft ermattet, unter muskulösen Herren mit zu großen Brillantnadeln; die Ausschließung aus der Welt; das Mitleid der Dichter; vielleicht die Verarmung! Vielleicht eine Heirat – geben wir ihr diesen letzten Spielergewinn; die Ausbeutung eines ehrlichen Namens: alles in der unbesiegbaren Unschuld ihrer außergesetzlichen Einzigkeit; Skandal; käufliches Hinübersteigen von einem Bett in das andere; was noch? Trunk? Oder eine gefälschte Unterschrift …?«
»Was ist dir denn, meine Liebe?« fragte schleppend ihr Gatte. Clelia stöhnte; die Wollnst ihres Hasses brachte sie einer Ohnmacht nahe.
· · ·
Es ward Frühling. In der Sonne fühlte Jakobus sich trübe und verbraucht. Er erwartete vergeblich von der ersten Wärme das Kribbeln im Rücken. »Und die Venus?« Sie überfiel ihn mit Gewissensbissen.
»Hast du sie auch vergessen?« fragte er die Herzogin.
»Wen?«
»Die Venus?«
Sie zuckte die Achseln.
»Mache sie doch!«
»Ich werde sie machen. O, gib gar nicht acht auf mich. Ich weiß deinen Körper auswendig. Du brauchst sie mir nicht vorzuführen, die Göttin.«
Aber sie führte ihm, ohne daran zu denken, Danaë vor, oder Venus, oder Leda. Sie stand in Nischen, ein Bein gebogen, eine Hüfte gewölbt, und horchte in eine Muschel hinein. Der Fluß ihrer Glieder ergoß sich über blasse Linnen, harfend weiß. Entzückt und mit versagender Hand schaute ihr Geliebter ihrem Spiele zu. Es war leichtfüßig und überzeugt. Die großen Wollüstigen der Fabeln drangen alle ein in ihr Fleisch; sie erlebte jede. Sie sagte:
»Ich träume von irgend einem üppigen Lande; es rauscht vor Fruchtbarkeit, es singt vor Wärme, es zittert vor Duft. Dort muß ein Leben sein, nackt und unerschöpflich.«
»Gehen wir hin. Suchen wir’s«, meinte er, ohne viel Selbstvertrauen.
»O, ich würde mich nicht mit dir begnügen. Du mußt dich darauf gefaßt machen, daß ich bis zu Ende Venus bin: ich nehme gnädig an meine Brust jeden, der mir ergeben ist! Zwei Menschen die einander bewachen, erobern nie die ganze Macht des Fleisches. Zur großen Fleischlichkeit fehlen uns Bacchanale, Freund. Früher wirst du mich nicht malen … Aber ich sehe, du bist mehr ein Verliebter, als einer mit mächtigen Sinnen und ein Schöpfer.«
Er errötete und ward blaß bei ihren Worten; er fühlte sie wie Peitschenschläge. Die wütende Sucht griff ihm an die Kehle, sie endlich so ermattet zu sehen, daß ihr zum Begehren kein Atem mehr bliebe.
»Ich kann sie den Taumel von Bacchanalen nicht lehren«, gestand er sich, knirschend und pinselnd. »Ich kann ihr auch die Venus nicht darbringen.«
Er empörte sich.
»Es ist doch Wahnsinn, etwas machen zu wollen, was mehr ist als ein weiblicher Akt.«
»Du mußt mehr machen … Kannst du’s heute nicht, so vergiß alles. Vergiß Farben und Kohle, erinnere dich nur meines Fleisches!«
Aber er stolzierte einher, eitel und trotzig.
»Ich muß schon bitten. Ich hab’ hier allmählich eine Sammlung von zwanzig Aktstudien, höchst schneidig zusammengehauen, eine wie die andere. Du scheinst das für wenig zu halten?«
»Für sehr wenig.«
»Wenn ich diese Blätter lithographieren und zusammenheften lasse …«
»Du wirst nichts lithographieren lassen.«
»Wieso, nichts? Alle Welt wird staunen, wie viel ich kann. Ist das da nicht sehr stark in der Erscheinung?«
»Aber es ist nicht die Venus.«
Er klappte zusammen und setzte sich. Er erschien ihr auf einmal ganz grau.
»Du hast ja recht«, sagte er. »Ich bin müde: was soll ich noch schaffen. Ich bin zu alt, ich liebe dich nicht wie ein Junger, der dich ansieht, und sieht doch nichts als seinen Traum. Seine Augen behängen dich wie mit bunten Fetzen; du selber verschwindest. Ich aber sehe und liebe dich, wie du bist – mit Selbstverleugnung, bis zum Vergessen, und ganz anders als meine andern Geliebten. Die waren mir Mittel zur Kunst. Dir aber – mich ekelt es davor, dir die vollkommenen Linien deines Leibes wegzuschwindeln und sie, in der Verzerrung irgend eines Ideals, auf eine Leinwand zu stehlen. Du bist mir kein Kunstwerk, o nein: ich hasse die künstliche Venus, die ich aus dir machen soll. Du bist mir – ich gestehe alles! – mir, dem Alternden, bist du der letzte Sinn, den das Leben annimmt, das letzte Verweilen, die letzte Frist, bevor es rasch den Berg hinabgeht. Bei dir will ich mich dessen entschlagen, was noch kommt; will dich einfach genießen, versunken und zwecklos.«
Sie hörte zu, erstarrt. Er sagte noch:
»Als ich hoffnungslos nach dir verlangte, konnte ich aus meinen Begierden Bilder machen; es war ein Irrtum, daß wir uns lieben mußten … Gedulde dich zehn Jahre: vielleicht, wenn ich kalt und gelassen mich deiner erinnere … Jetzt aber, in diesem Jahr, sind alle Bilder übertüncht. Von Venus weiß ich nichts, ich sehe nur dich – nur dich. Welch Glück! Die Dinge ansehen, ohne sie malen zu müssen.«
Da sie schwieg, fragte er:
»Verstehst du das? … O, wenn du wüßtest, was das für eine Angst ist, kein Ding ansehen zu können ohne die Frage: muß ich das malen?«
Sie hörte ihn gar nicht mehr, sie dachte an Nino.
»Ah! Der hat sie gesehen, die Venus – auf dem grünen Platze, im wehenden Grase. Sein Knabenblick hat in meine Glieder die Säfte der ganzen Erde hineingezaubert. Wenn ich von jeder ihrer Wollüste erbeben könnte! Er würde es mich vielleicht lehren? Er ist so jung … Mit ihm, mit ihm möchte ich jenes schwüle und schwellende Land erreichen.«
Sie verglich ihn mit Jakobus. Ihr Geliebter saß rittlings auf seinem Stuhl, an die Lehne geklammert mit beiden Händen, und die Wange darauf gebettet, voll Sehnsucht und ohne Mut.
»Ich bin in einer ähnlichen Verfassung«, erklärte er, »wie damals in Rom, in dem Augenblick, bevor du in mein Leben eintratest. Ich hatte alle meine Studien verkauft und konnte nichts mehr malen … Du hast sie zurückgekauft. Aber was ich jetzt verloren habe, das bringst du mir nicht wieder.«
»Was ist es?«
»Meine Unschuld … Jawohl, gnädige Frau, Sie meinen wohl, ich habe vor Ihnen schon einmal geliebt? Aber Sie wissen doch, die Seele im Park war meine einzige Liebe. Ich war, als ich zu Ihnen kam, noch ganz unschuldig, ein Kind – das Sie umbringen.«
»Mit Bedauern«, sagte sie geringschätzig, und sah weg.
Seine zehrenden Blicke irrten an ihr hin und her. Sie saß aufrecht auf den tiefroten Polstern. Unter einer ihrer Achseln schillerte zusammengeballt ein seidenes Kissen; der Arm wand sich herum, in nacktem Bogen, formenfest und bläulich geädert. Das Gewand hing nur an einer Spange von der Schulter; es enthüllte feierlich die Büste. Die roten Spitzen der Brüste neigten sich atmend, und atmend antwortete ihnen die gleißende Senkung über dem Bauche. Die Beine streckten sich gekreuzt unter dem zitternden Gewebe. Auf gespanntem Halse schnitt das lichte Profil, voll leidenschaftlicher Hoheit, in das gewölbte Blau des offenen Fensters. In Jakobus’ Kopfe fielen Worte, immer dieselben und immer stärker:
»Die fiebernde Statue einer Kaiserin!«
Er schnellte empor, im Nu verändert, verjüngt, anmaßend und schmeichlerisch in einem Atemzuge.
»Es versteht sich, daß das alles Unsinn und Schwäche war. Was wäre das für ein großes Werk, das uns nicht für Augenblicke recht klein machte, uns ängstigte mit den Verstiegenheiten seiner wilden Höhe, daß wir uns hinuntersehnen zu den einwandfreien Nachahmungen der Wirklichkeit. Du bist das verzweifelte Werk, du Einzige, Unerhoffte! Es heißt an dich glauben – und an mich! Ich kann sehr viel, mehr als alle! … Und ich kann dich anbeten!«
Er lag vor ihr, mit den Lippen auf ihren Knien.
· · ·
Aber aus dem Schlafzimmer verschwand sein Malzeug. Sie sprachen nie mehr von der Venus. Sie plante nur noch, drohend, stumm und unerbittlich, eine massige Menschenfresserin, über ihren Umarmungen und machte sie düsterer und erbitterter.
Eines Tages blieb er fort und ließ sie wissen, er arbeite. Eine Woche später hieß es, sie solle zu ihm kommen: »Ich zeige sie dir!« … Als sie eintrat, lag er, zerbrochen und grau, auf der Ottomane.
»Gestern stand sie dort, vollendet«, sagte er, und deutete auf die Staffelei, die leer war.
Es ward ihr sehr schwül. Aus ihrer Angst hervor reichte sie ihm die Hände, wie aus einem Sumpf, der unter ihr wich.
»Du sollst dich nicht mehr quälen! Sie wird eines Tages von selbst da sein.«
»Woher weißt du’s?«
»Unsere Liebe kann nicht umsonst sein. Wir sind zu groß: glaube das nur … Die heißen Tage stehen bevor. Komm mit aufs Meer, in meiner Yacht. Willst du, morgen?«
Aber draußen in der violetten und kristallenen Weite enttäuschte er sie noch hoffnungsloser. Sie ward durchkreist von der Sehnsucht des Meeres und des Himmels. Ihre Sinne schossen auf zu den strotzenden Göttern, die aus Licht und Wasser die mächtigen Arme nach ihr reckten. Zurückgekehrt zu dem einzigen Gefährten ihrer endlosen Einsamkeit, fand sie ihn runzelig, verbraucht, unglücklich, Sie zog ihn in die Kajüte und in das Halbdunkel.
»Ich gebe dich nicht frei, trotz allem. Du bist der Mann, der mich lieben muß. Du bist in meiner Schuld!«
Er sagte, verbissen:
»Die Leidenschaft für dich hat mich schon meine Kunst hassen gelehrt: ist das nicht genug? Und ich fühle bloß noch eine Wut, dich zu vergewaltigen – aber keine Liebe mehr. Liebe und Kunst, alles beim Teufel!«
Sie hielt ihm den Mund zu. Sie warfen sich auf einander, blaß, mit geschlossenen Augen, vergehend, und mit der Begierde, einander wehe zu tun.
Als sie wieder ans Land stiegen, waren sie sich auf einmal fremd. Sie betrachteten sich mißtrauisch, sie hatten sich nichts zu sagen. Jeder fühlte das Bedürfnis, sich zurückzuziehen, den andern los zu sein, und verkrochen in den Schatten, nur noch eines zu erwarten. Sie sagten sich nicht einmal selber, was. Aber sie sahen es einander an. Sie standen dort, wo Clelia sie schon erblickt hatte. Eine jugendliche Sibylle mit alten Zügen, hatte jene an ihrem Kamin, aus den Krümmungen des brennenden Holzes, der enttäuschten Liebe ihren letzten Wunsch vorhergesagt: zu sterben.
· · ·
Die Sucht nach Sattheit trieb sie immer wieder zu einander. Die Herzogin suchte nach einem Mittel sich selbst zu überwinden und mit ihm zu brechen. Sie erinnerte sich seiner Frau; seit jener ersten Nacht, da sie hinter dem Gartengitter, auf der Lagune gesessen und geschluchzt hatte, war Bettina verschwunden.
»Wo ist sie?«
»Frage den Doktor Giannini.«
Von dem Arzte erlangte sie mit Mühe das Geständnis, Frau Halm sei in der Irrenanstalt. Sie geriet außer sich, sie verlangte, daß er sofort mit ihr fahre, um die Unglückliche zu holen.
»Wohin mit ihr, Hoheit?«
»Mir gleich. Nach Castelfranco. O, sie wird niemand Schaden zufügen. Ich lasse sie pflegen.«
Kaum war Bettina in die Gondel gehoben, so begann sie zu plappern, zuckenden Gesichts.
»Heil! Heil! Nun ist das Werk erschienen! Es ist fertig, nicht wahr? … Nicht? Sie antworten nicht? … Ach, ich weiß es ohnedies, daß alles vergeblich war. Wenn das Werk da wäre, man würde es ja merken. Die Welt sähe anders aus. Auf allen Gesichtern stände zu lesen: es ist da! …«
Sie deutete auf den Arzt.
»Wie schaut der dort grämlich drein! Und ich selbst bin noch häßlicher geworden, nicht wahr? Fahren Sie mich nicht zu ihm, nicht zu ihm! Mein Anblick würde dem Werke schaden; es schläft ja in ihm, ungeboren.«
Sie löste ihr Haar und verhüllte sich mit den dünnen Strähnen das Antlitz.
Die Herzogin starrte durch die Irre hindurch. Sie sah, wie auf einer andern Meerfahrt vor langer Zeit, hinter dem Segel der großen Fischerbarke einen von Schmerz geschüttelten Mann kauern. Und im Rücken fühlte sie’s, wie sein Kind tot im Kielwasser ihres Bootes schwamm. Sie erschauerte und fuhr auf.
Bettina streckte den Arm aus.
»Der schöne rote Fleck dahinten im Wasser – purpurleuchtend, o, purpurn! … Nun kommen wir näher, er ist hochrot, nein, braunrot nur … Ach, ganz braun ist er geworden – pfui – und da …«
Sie warf den Oberkörper hinaus aus der Gondel, daß der Arzt aufsprang. Dann hob sie den Arm, grün überzogen, aus dem Wasser.
»Schlamm!« sagte sie, albern lachend. »So ist es, so ist es immer, wenn wir der Schönheit auf den Grund gehen.«
Aber die Herzogin sah, die Lippen leise geöffnet, und mit großen festen Blicken, auf dem golden überdunsteten Blaugrün der Lagune, ferne und gewiß, etwas Weißes sich wiegen, mit rosigen Hüften: ein seltsames Kind, tanzend am Rande eines blanken Smaragds. Es war Venedig selbst. Und es war ein Wunder, das dem Näherkommenden stand hielt. Es war eines, das denen nie verloren ging, die es einmal beglückt hatte.
· · ·
Sie fuhr mit Bettina aufs Land, und sie vernahm fortan, zwischen den Rosen, Steineichen, Brunnen keine andere Stimme mehr, als die der Armen, die sie anklagte.
»Es ist Ihre Schuld. Sie haben ihm das Werk nicht gegeben. Und ich hatte Sie so flehentlich gebeten – dort in der Loggia, im Finstern …«
Die schleppende Stimme drang zu ihr, als der Kehrreim ihrer eigenen Gedanken, auch noch des Nachts, wenn sie heiß, mit Herzklopfen und in wesenloser Angst, zu den Sternen hinauffieberte. Die dunkle Luft strich über ihre entblößten Glieder. Der Amor auf dem Kamin regte sich nicht, sie hörte ihn nicht mehr plaudern. Sie hörte nur Bettina.
»Ich bin wieder bei Morphin und Sulfonal angelangt, wie einst in Castel Gandolfo, als mein Freiheitstraum zu Ende ging. Jetzt erlischt die Sehnsucht, die in den Augen der Pallas brannte. Ich sehe sie nicht mehr. Ich treibe, mit geschlossenen Lidern, offenen Armen und die Brüste im Winde, in einen purpurnen Strudel hinein … O, ich heiße alles gut, was geschehen soll. Aber mich ermattet das Warten. Ehemals wartete ich auf einen Journalisten, der einen Artikel zu schreiben hatte, jetzt auf einen Maler, der mir ein Bild verspricht.«
Er schrieb:
»Verlaß dich darauf, ich finde sie. Sie entrinnt mir nicht. Eher sterbe ich über dem Werk! Auch noch wenn ich schlafe, arbeitet mein Geist, wie ein armer Bauer, der sogar im Dunkeln sich auf seinem Acker müht.«
Sie ließ, zurückgezogen in das fernste Dickicht des Parks, den Sommer verstreichen. Sie begrüßte den Herbst; er kam schon im September, und sie fühlte, in eine niedrige Ahornkrone geschmiegt, das tief goldene und noch unversehrte Laub in stiller Luft um sich her zusammenschlagen, wie einen Mantel von Lust, von schwerer, alles vergessender.
»Nach ihm«, so verhieß sie sich, »werde ich viele Männer genießen, von denen ich nicht verlangen werde, daß sie aus mir eine Göttin machen. Sie sollen keine Sehnsucht haben, und ich auch nicht. Wir werden glücklich sein.«
Dann meldete Jakobus:
»Ich bin fertig, komme!«
Er öffnete ihr das Atelier, sehr unterwürfig, mit sorgenvoller Stirn. Und sofort begegnete sie, mitten im Zimmer, den geröteten, blinzelnden Augen des Herrn von Siebelind. Sein Bildnis stand dort, an der Stelle der Venus.
»Ist es das?« fragte sie.
»Ja«, sagte er, leise, mit geschlossenen Zähnen.
Sie prüfte des Gemalten dürftige Gestalt und die blasse, trüb flackernde Grimasse seines geschminkten Gesichts. Und sie gedachte der reichen, allernährenden Göttin, die Nino erblickt hatte. Sie strotzte von den Säften der Erde – und dieser hier verachtete sie, weil er keine Kraft hatte, sie zu beneiden. Die blonden Schatten der Reife blühten in den Vertiefungen ihres Fleisches – und auf diesem hier klagten die violetten des verarmten Blutes. Sein Kopf blinzelte auf finsterem Grunde, quälerisch grübelnd, tief, eitel und voll Scham. Ihrer war in das Himmelsblau getaucht und hatte nur geglänzt und Gnade verheißen. Sie teilte ihren Atem allem mit was lebte, die Arme um die Welt geworfen, in der Überfülle des eigenen Glücks. Er aber mußte sparen, er durfte niemand lieben.
»Es ist vorzüglich«, versetzte endlich die Herzogin. »Sie haben nie etwas Besseres gemacht.«
»Nicht wahr?« rief er, angstvoll. »Es ist ein Meisterwerk!«
»Ein Meisterwerk«, wiederholte sie. »Aber was geht es mich an.«
Und sie wandte sich zum Gehen. Er blieb dicht hinter ihr.
»Wohin wollen Sie? Ist es denn nun aus? … Ich lehne mich ja nicht auf. Sie haben recht, wir sind fertig. Aber …«
Womit konnte er sie aufhalten?
»Einen Augenblick! Gehen Sie, wohin Sie wollen. Aber kehren Sie nicht auf Ihr Landgut zurück! Sie wissen noch nicht – die Brotrevolten dehnen sich aus jene Gegenden aus. Die Ausständigen verwüsten die Weinberge, hören Sie, warum sollten sie nicht in die Ihrigen einbrechen. Sie haben, ganz in Ihrer Nähe, einen Bäcker getötet, der den Brotpreis erhöht hatte. Das Schlachten von Vieh verbieten sie. Wovon soll man leben? Es sind Anarchisten … Herzogin, bleiben Sie, es wird Ihnen ein Unglück zustoßen!«
»Mir nicht«, erwiderte sie. »Mein Schicksal verspricht mir noch zu vieles. Ich glaube es ihm.«
»O, o«, machte er, mit mattem Hohn. »Glauben! … Ich habe auch geglaubt.«
»Nein. Sie haben nur begehrt … Mein Leben aber ist ein Kunstwerk, das schon vor meiner Geburt vollendet war: das ist mein Glaube. Ich habe es nur durchzuspielen, bis zu Ende. Kein Zufall wird mich unterbrechen.«
»Also dann, leben Sie wohl.«
· · ·
Sie floh zurück aufs Land, sie schloß sich ein, und sie rang die Hände.
»Nun bin ich frei, was wird nun geschehen? Nun darf ich über Land fahren, alle Straßen stehen offen. Aber ich habe Furcht, ich gestehe es. Es wird mir ergehen wie einer verirrten Nymphe. Jeder Baum, meine ich, wird nach mir greifen. Jeder Landstreicher wird mich an sich reißen. Meine Launen werden mich zerstreuen unter alle, die mich begehren. In wie viele Abenteuer wird mein Blut mich hetzen!«
»Noch nicht! Noch einen Augenblick Atem schöpfen! Ich habe zehn Jahre lang in Sicherheit gelebt. O, ich bin nicht feige. Ich gehe allem entgegen. Meine Einsamkeit wird niemals tiefer werden … Gibt es denn einen meinesgleichen? So wünschte ich mir vorher noch eine gute Stunde mit ihm. Mit San Bacco!« rief sie, erlöst.
Sie richtete an ihn eine Depesche.
»Wenn sie ihn antrifft, ist er morgen Nacht hier.«
Und sie zählte die Stunden. Sie harrte seiner, wie eines Geliebten, der sich ihr seit langen Jahren versprochen hatte. Wenn sie einmal einen Ritter und einen braven Mann nötig haben werde – so hatte sie ihm damals geschrieben. Er wollte damals für sie in ein Land einbrechen. Später hatte er für sie im Zweikampf gefochten. Jedesmal hatte er gedacht, es sei der Augenblick, wo sie ihn rief. Nein! Der Augenblick war erst jetzt da, und sie rief ihn, um ihn zu lieben!
Sie hatte ihn vergessen, den alten Mann, der vor einem Jahre von ihr geschieden war; sie sah vor sich den gewalttätigen Begeisterten, der einst die dalmatinischen Ziegenhirten zum Aufruhr gereizt hatte. Er leistete den Gendarmen eine Gegenwehr auf Tod und Leben. Dann ging er in ihrem Boudoir vor ihr auf und ab und sprach. Das Wort »Freiheit« war aus biegsamem Stahl. Er war schlank und breitschultrig, sein schlohweißer Schopf wirbelte, sein rotes Bärtchen tanzte, seine türkisblauen Augen blitzten.
Und sie wartete. Der Tag verging; sie schickte den Wagen dem Kommenden entgegen. Im ersten Mondstrahl betrat sie den Garten. Die Nächte waren noch einmal warm geworden. Sie wanderte rastlos umher vor den beschnittenen Steineichen. Manche ihrer Wände sah sie weiß überrieselt, und voll großer blasser Tropfen, die Rosen waren; vor andern hielt mit ausgebreitetem Schleier die Finsternis Wache. Schimmernd und leicht stand der Springquell im weiten, silbern überperlten Himmel. Aus den großen Schalen auf der Balustrade floß mit dem Schlinggewächs ein Bach von silbernem Licht ohne Laut die Terrasse hinab. Er verbreitete sich drunten über die schlafenden Kronen der Oliven, er durchrann den Irrgarten des Weins, und ergoß sich ins Tal und in die Ferne. Steinerne Inseln, Kränze gleißender Gärten schwammen in ihm, und er brach sich an starren Mauern von Zypressen.
Die Straße am Abhang ging unter im Dunkel und tauchte mit blendenden Mauern wieder heraus, zwischen den Dörfern. Um ihren Schlaf herum hingen silbergraue Gewebe. Unter jedem Baum lag ein runder Schatten, wie sein Spiegelbild, in der hellen Wiese. Auf den Zwiebeltürmen glitzerte der Knauf.
Plötzlich löste sich aus einem der Glockenstühle ein Ton. Sie hörte ihn noch, sie sah die Glocke schwingen, einen endlosen Augenblick. »Es wird kein zweiter kommen«, versprach sie sich. Aber da eilte er schon herbei, und es folgten ihm viele, überhastet, wimmernd, Unheil ansagend. Rote Lichter brachen aus den eben noch verschwiegenen Häusern. An ihnen entlang bewegten sich größere, flackernde. In dem Rauch den sie verbreiteten, war ein Hin-und-her-Laufen, etwas Wirres, Beängstigendes. Es erstickten auch Stimmen darin, und es klirrte darin wie von Waffen.
Sie wartete, am Geländer steif aufgerichtet, mit herabhängenden Armen, den Kopf im Nacken. Die Berge, die mit schwarzen, wolligen Schwellungen und Senkungen dort hinten so furchtbar lasteten auf dem beklommenen Lande – sie hoffte, sie würden zu wandern beginnen, sich vorwärts schieben, alles zermalmen, das Tal, die Dörfer, den Hügel selbst auf dem sie stand, damit das Entsetzliche nicht geschehen, damit sie es nicht erfahren könne. Aber sie wußte es schon.
Die Fackeln bogen in den Weg, der zu ihr führte. Sie gingen unter in Laubmassen, deren Ränder sie röteten, und sie fanden immer wieder die offene Straße und stiegen höher, unerbittlich: sie und die Menschen und das was sie trugen. Die Herzogin erwartete sie. Sie blieb reglos, bis die Bahre mit seinem Körper vor ihr stand. Sie hörte die dumpfen Berichte an und winkte nur: »Geht!«
Dann ließ sie sich ohne Hast, in ihrem weißen Kleide das glitzerte, in ihrem schwarzen Haar das funkelte, nieder bei ihrem toten Freunde, mit der Brust auf seiner, die noch blutete. Sie küßte ihn, und sie sprach mit ihm.
»Da bist du. Die Menge hat dich aufgehalten, sie war wohl eifersüchtig, weil du auch mich liebtest … Bist du zufrieden? Du wünschtest dir ja, das Volk möchte dich zur Rechenschaft ziehen, weil ihm die Versprechungen der hochherzigen Zeiten nicht gehalten sind. Du aber, Freund, hast alles gehalten, immer auf derselben, von Weltklugheit verwaisten Höhe. Und auch ich halte alles. Die Dinge wechseln, meine Empfindung dauert, ebenso stolz wie deine. Was in meinen Armen lag, waren Träume, es wurden Bilder, und es wird zu heißen Körpern … Weißt du nun, daß alles, alles gleichgültig ist, was wir tun und was mit uns geschieht – und daß nur eines zählt: Seelen, die einander fühlen!«
Sie fühlte ihn antworten, sie erwärmte seine Lippen, und es verrann, zusammen mit dem Mondlicht, das Haus, Brunnen und Bäumen enttropfte, die zärtlichste Stunde ihres Lebens.
Sie richtete sich auf.
»Prosper, wir verreisen.«
Der Jäger hütete sich zu gestehen, daß drunten der Aufruhr am Wege lagere; er kannte seine Herrin. Er sagte:
»Hoheit, der Wagen ist zertrümmert.«
»Laß also ein Wägelchen anschirren. Sorge für meinen Koffer.«
»Und der Herr Marchese?«
»Der Verwalter soll ihn aufbahren, im Saal. Wir telegraphieren nach Rom. Man wird ihn dort verlangen, man mag ihn sich holen.«
Prosper verneigte sich und ging; sie sah ihm erstaunt nach. Er zitterte ein wenig, am Ende dieser Nacht, der alte Diener, der seit der Tiefe ihrer Jugend und bis hierher immer in ihren Fußtapfen gegangen war, schweigend, von ihr unbeachtet – und vielleicht kein Fremder?
»Er ist alt, und …« sagte sie zu San Bacco, »du bist alt: ich hatte es vergessen. Habe ich nicht selber unvermerkt die Vierzig erreicht? Ich aber, ich fühle in mir die Kraft von hundert Menschenleben!«
Sie betrat das Haus und kleidete sich an. Ihre Leute fuhren voraus, die Straße hinab. Dann kehrte sie, langsam und allein, zurück zu dem Toten. Er streckte sich, ganz versteint, im Mondschein. Der Mondschein kreiste blau im Kiese, er rann von den Schindeln des Daches, er sickerte aus Vasen und Blumenkelchen, er glättete die Hüften der Halbgötter in den Hecken – aber um den Kopf des Toten formte er einen Reif.
Sie löste die Hände von einander, sie wandte sich ab, sie ging an die Balustrade, Schritt für Schritt, und die Treppe hinab, Stufe für Stufe. Auf ihren Schultern und auf ihrem Haupt lag Silber – und sie stieg, jung und jeder Ferne entgegenatmend, wie in Fähren zu unerwarteten Ufern, hinein in die von Mondlicht triefenden Büsche.