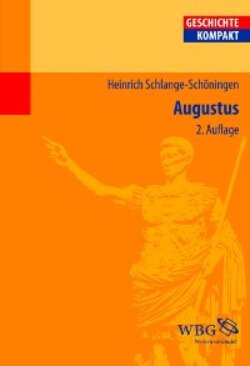Читать книгу Augustus - Heinrich Schlange-Schöningen - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Die Autorität des Augustus
ОглавлениеAls „Sohn“ des vergöttlichten Gaius Julius Caesar, als Sieger im Krieg gegen Antonius und Kleopatra, später als Garant von Frieden und Wohlstand nahm Augustus eine Stellung ein, die ihn weit aus dem Kreis seiner Mitmenschen heraushob. Viele Zeitgenossen erklärten sich seine Erfolge und seine Macht mit göttlichen Kräften, die in ihm wirkten. Augustus selbst hat die Aura, die ihn umgab, genossen, und er hat in ihr auch einen seine Herrschaft stabilisierenden Faktor gesehen. In seiner Lebensbeschreibung des Augustus spricht Sueton von der „ungewöhnlichen Schönheit“ des Herrschers und von seinen „hellen und strahlenden Augen“, und er berichtet weiter, Augustus habe Wert darauf gelegt, dass man „in seinen Augen den Ausdruck einer göttlicher Kraft zu erkennen meinte“; er habe sich gefreut, „wenn jemand, den er scharf anblickte, wie vor den Strahlen der Sonne den Blick niederschlug“ (Augustus 79).
„Prinzeps“
Bereits hier, bei einem scheinbar nebensächlichen Detail im Auftreten des Augustus, stößt man auf die innere Spannung, ja Widersprüchlichkeit seiner Herrschaft. Nach der Rückgabe der außerordentlichen Gewalten an den Senat im Januar 27 v. Chr. waren Octavian neue Kompetenzen übertragen worden, die seine Macht sicherten. Er selbst aber wollte seine Stellung von nun an als die eines „Prinzeps“, das heißt eines „ersten Mannes“, verstanden wissen, was sich gut mit der republikanischen Tradition verbinden ließ. Schon lange waren die führenden Männer in Rom als principes bezeichnet worden. So wie diesen Männern durch ihre Verdienste eine besondere Autorität zugekommen war, wollte auch Augustus seine mächtige Stellung, bei der es sich tatsächlich um eine Alleinherrschaft handelte, in seiner auctoritas begründet sehen. Seit 27 v. Chr., so schreibt Augustus in seinem „Tatenbericht“, den inschriftlich überlieferten Res gestae, habe er „alle anderen an Autorität (auctoritas) überragt, aber nicht mehr Macht (potestas) besessen als diejenigen, die auch ich zu Kollegen im Amt gehabt habe“ (Kap. 34). Auctoritas ist ein Begriff, der sich staatsrechtlich nicht fassen lässt, und er ist gerade deshalb ein wichtiger Schlüssel für das Verständnis der komplizierten Herrschaftsverhältnisse im augusteischen Prinzipat.
auctoritas
Politische Autorität zielt auf die Akzeptanz von Seiten derjenigen, die sich der Macht unterordnen sollen, und Augustus hatte als Sieger von Actium, dem man die Beendigung der Bürgerkriege zu verdanken hatte, viel an Autorität gewinnen können. Von ihm erwartete man die Stabilisierung der inneren Verhältnisse und die Sorge um das Wohlergehen von Mitbürgern und Untertanen, und jeder Erfolg auf diesem Wege konnte die Akzeptanz seiner Herrschaft vergrößern. Indem sich jedoch die Autorität des Prinzeps mit einer religiösen Aura verband, wie sie bereits in der Namenswahl „Augustus“ zum Ausdruck kam, musste das politische Konzept der „wiederhergestellten Republik“ fragwürdig werden. Als „erster Mann“ durfte Augustus über den Standesgenossen stehen, aber doch nicht zum lebenden Gott werden. Deshalb wollte Augustus von den römischen Bürgern auch nicht als Gott angesprochen und verehrt werden. Es reichte ihm aus, dass er in vielen Tempeln Roms in die Nähe von Göttern wie Apollon oder Mars gerückt wurde, und der göttlichen Macht, die in ihm zu wirken schien, seinem genius, Opfer dargebracht wurden. Aber schon dieser Grad von Gottesnähe des Prinzeps und die damit verbundene und von Augustus, wie bei Sueton zu sehen ist, auch gewünschte Aura musste kritischen Beobachtern in Rom die Janusköpfigkeit der „wiederhergestellten Republik“ vor Augen führen.
Kaiserkult
Noch deutlicher wurde die Diskrepanz zwischen dem politischen, auf die Öffentlichkeit in Rom ausgerichteten Programm der res publica restituta und der religiösen Überhöhung des Augustus, wenn man von Rom aus in die Provinzen blickte. Vor allem im griechischsprachigen Osten waren die Menschen seit Jahrhunderten daran gewöhnt, dem Herrscher wie einem Gott Ehren zu erweisen, und so wurde Augustus, nachdem er selbst die Erlaubnis dazu gegeben hatte, von den Provinzialen gemeinsam mit der Göttin Roma kultisch verehrt. Darüber hinaus widmeten Einzelpersonen, Städte und Landtage dem Kaiser Altäre und Festspiele.
Wie weit die Verehrung des Augustus gehen konnte, soll ein Beispiel aus der Provinz Asia deutlich machen. Die in einem „Landtag“ (Koinon) zusammengeschlossenen Vertreter der Städte hatten Überlegungen angestellt, wie der Herrscher am besten verherrlicht werden könnte, und dann den Vorschlag des römischen Prokonsuls angenommen, Augustus’ Geburtstag, den 23. September, zum Jahresbeginn des Provinzialkalenders zu machen. Die Beschlüsse, die der Landtag von Asia im Jahr 9 v. Chr. fasste, wurden öffentlich bekannt gemacht. Aus den fragmentarisch erhaltenen Inschriften geht hervor, dass der Prokonsul seinen Vorschlag mit der Überlegung begründet hatte, „der Geburtstag des allergöttlichsten Caesar“ werde „zu Recht als der Anfang aller Dinge betrachtet, […] da er alles, was in Stücke zerfiel und sich in eine unglückselige Gestalt verwandelte, wiederhergestellt hat; denn er hat dem gesamten Kosmos, der gut und gerne seinen Untergang gefunden hätte, wenn Caesar nicht zum allgemeinen Glück für alle geboren worden wäre, ein neues Aussehen verliehen.“ In dem nachfolgenden Beschluss der Mitglieder des Landtags war dann von der Vorsehung die Rede, „die auf göttliche Weise unser Leben geordnet und unter Einsatz von Eifer und Ehrliebe dem Leben den Schmuck des vollendeten Gutes geschenkt hat, indem sie Caesar hervorbrachte, den sie zur Wohltat für die Menschheit mit höchster Vorzüglichkeit ausstattete, gerade wie wenn sie uns und unseren Nachfahren gnädig einen Retter schenkte, der den Krieg beendete und dem Frieden seine Zier verlieh“ (Übs. K. Bringmann).