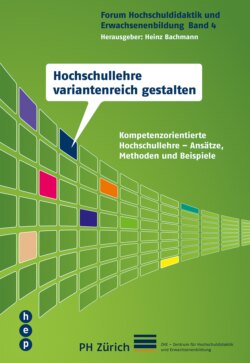Читать книгу Hochschullehre variantenreich gestalten - Heinz Bachmann - Страница 11
2.1Kooperatives Lernen, Kollaboratives Lernen oder Gruppenarbeit?
ОглавлениеIn manchen Fällen wird in der Literatur Kooperatives Lernen als eine spezifische Form des Kollaborativen Lernens betrachtet (Huber 2006). Dann wiederum werden die beiden Lernformen als zwei unterschiedliche Ansätze und Traditionen bezeichnet, die zwar grundlegende Übereinstimmungen aufweisen, sich jedoch in verschiedene Richtungen entwickelt haben. So soll sich das Kollaborative Lernen eher auf Hochschulebene etabliert haben, während sich die Grundlagenliteratur des Kooperativen Lernens auf den Primär- und Sekundarschulbereich bezieht. Unbestritten ist, dass Methoden des Kooperativen Lernens auch für den Gebrauch an der Hochschule adaptiert und übernommen wurden. Und diese Methoden sind zum Teil sehr gut erprobt und beforscht (Gruppenpuzzle, Abbildung 3 oder STAD, Abbildung 4).
In der Literatur ist man sich einig, dass sich das Kooperative Lernen vom Kollaborativen Lernen in seiner stärkeren Strukturierung unterscheidet und als strukturierte systematisierte Lernform bezeichnet werden kann. Die Lehrenden sind einflussreicher involviert, machen mehr Vorgaben, beobachten die Gruppenarbeit und steuern und evaluieren die Beteiligung der Einzelnen stärker. Häufig nehmen sie die Einteilung der Gruppen vor oder steuern diese mit, indem beispielsweise auf Kriterien der Zusammensetzung aufmerksam gemacht wird. Auch dass die Studierenden dazu angehalten werden, über das Funktionieren der Zusammenarbeit in der Gruppe zu reflektieren und Entwicklungs- und Verbesserungsmöglichkeiten zu überlegen, gehört dazu. Ein grundlegender Unterschied ist zudem, dass beim Kooperativen Lernen Leistungen auch individuell beurteilt werden und nicht nur kollektiv, indem ausschließlich das Endprodukt bewertet wird. Zwischen den Gruppenmitgliedern besteht zwar eine positive gegenseitige Abhängigkeit, das heißt, die Zusammenarbeit in der Gruppe ist für den Erfolg der Einzelnen notwendig. Die Lernenden sind jedoch individuell verantwortlich für ihr Lernen und ihr Engagement in der Gruppe.
Da sich die Zusammenarbeit in Gruppen in einer Art Sandwich-Prinzip mit anderen Lernformen kombinieren lässt, schließt der Ansatz des Kooperativen Lernens weder die frontal ausgerichtete Lehre noch Sequenzen selbstverantworteten Lernens aus. Beim Kollaborativen Lernen hingegen bleiben Gruppen über längere Zeit zusammen, bearbeiten ein gemeinsames Projekt oder eine gemeinsame Fragestellung wie beispielsweise im forschungsorientierten Lernen und Lehren. In anderen Fällen treffen sich die Mitglieder solcher Langzeit-Studierendenteams regelmäßig außerhalb des Unterrichts, um gemeinsam zu lernen, zu lesen, zu wiederholen, Aufgaben zu erledigen, Texte gegenzulesen etc. Diese Form der Zusammenarbeit findet meist in selbst organisierter Form statt, ohne aktive Unterstützung und Steuerung von Lehrenden. Für die Lehre an Hochschulen sind beide Formen relevant und von Interesse – sie haben zum Ziel, dass Lernende nicht nur zusammenarbeiten, sondern dass sie im besten Fall gemeinsam mehr und anderes lernen als allein. Durch Kooperatives Lernen kann das Leistungsniveau aller Beteiligten und somit deren Selbstvertrauen gesteigert werden. Ebenso lernen die Studierenden produktives Zusammenarbeiten und werden in einer Wissensgemeinschaft sozialisiert.
Dem aktuellen Kenntnisstand entsprechend, gelingt Kooperatives Lernen vor allem dann, wenn nicht nur das Lernergebnis beachtet wird, sondern ebenso der Lernprozess und das Lernhandeln. Auch deshalb kann Kooperatives Lernen nicht mit der herkömmlichen Gruppenarbeit gleichgesetzt werden (Konrad & Traub 2001, S. 7). In der hier skizzierten Form kann Kooperatives Lernen, abhängig von der Ziel- und Kompetenzerreichung, mehr oder weniger strukturiert und von unterschiedlicher Dauer sein. Wesentlich ist die Fähigkeit des Dozenten oder der Dozentin, in etwa einzuschätzen, was die Studenten und Studentinnen bereits können und wissen, was daher vorausgesetzt werden darf, und in welchen Bereichen (Denk- und Lernstrategien oder soziale Kompetenzen) die Lernenden Unterstützung, Anleitung und Struktur benötigen.
Das gemeinsame Lernen in heterogenen Gruppen eignet sich dazu, Vorwissen zu aktivieren, Wissen zu erarbeiten und zu festigen, Probleme kreativ zu lösen oder die dialogische Kompetenz zu fördern. Besonders geeignet sind komplexe, herausfordernde Aufträge, die konzeptuelles Denken erfordern, wie etwa die Funktionsweise eines Gegenstandes zu erkennen, den Stoffwechsel bei Pflanzen zu begreifen, einen Leserbrief zu verfassen oder eine historische Begebenheit szenisch darzustellen. Dies alles sind Aufgaben, die unterschiedlichste Fähigkeiten erfordern. Beim Bearbeiten einer komplexen Aufgabe oder eines Problems bringen alle Lernenden sich und ihre Kompetenzen möglichst eigenverantwortlich und gleichberechtigt ein, wobei der Dozent oder die Dozentin die Führung an die Gruppe und die einzelnen Studierenden abgibt. Der hier vorgestellte Zugang ist von unterschiedlichen Bedingungen (Kapitel 3, S. 23 ff.) abhängig, damit er lernwirksam wird. Erste Anhaltspunkte gibt die folgende Beschreibung zentraler Elemente: