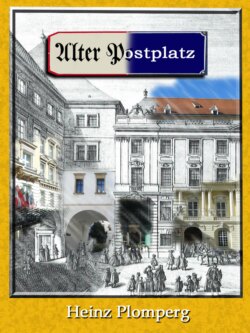Читать книгу Alter Postplatz - Heinz Plomperg - Страница 4
1873, Weltausstellung
ОглавлениеWie und wann eine anglo-irische, katholische Adelsfamilie zu einem griechischen Wahlspruch gekommen war, verschweigt die Fama.
Arlingtons behaupteten gerne, die ältesten Barone Englands zu sein. Sie behaupteten dies ungefragt und unbewiesen und egal, in welche Weltgegend sie die Geschichte verschlagen hatte. Alte Arlington-Tanten mahnten oft mit drohendem Unterton ihre Großnichten und –neffen, es habe bereits eine Geschichte der Arlingtons gegeben, ehe es eine Geschichte Englands gegeben habe.
Um dann mit aristokratischer Nonchalance hinzuzufügen, leider, leider, sei diese Geschichte aber verloren gegangen.
So manches Kind der Arlingtons aber träumte von römischen Vorfahren mit griechischen Wahlsprüchen im alten England, die den wahren Glauben an der Seite König Artus gegen die heidnischen Angeln und Sachsen verteidigt hatten. Daher brachten es die Arlingtons in jeder Generation auch zu mindestens einem Privathistoriker. Seltsamerweise hatte sich jedoch noch niemand von denen dazu aufraffen können, die englischen Ursprünge zu erforschen, oder gar die Legende zu verifizieren, selbst der amerikanische Nationalfriedhof „Mount Arlington“ resultiere aus der eigenen Familiengeschichte, aufgrund eines amerikanischen, wenn auch leider, leider protestantisch gewordenen Familienzweiges.
Abgesehen von den böhmischen Besitzungen, einem Palais in Prag und einer Brauerei in Mähren, besaßen die Arlingtons noch Güter in der Steiermark inklusive noch einer Brauerei, eine Mineralwasserquelle in Westungarn, sowie ein Jagdhaus, Schloss Nasswald, in den Marchfeldauen und eine eben neu erbaute Sommervilla in Heufuß am St. Zeno See.
Die Arlingtons stellten den Habsburgern Offiziere, Diplomaten und Beamte, der Kirche Äbte und Bischöfe in allen Kronländern der Monarchie – und mit ihren Töchtern - Ehefrauen sonder Zahl für alle anderen Familien ihrer Couleur, katholisch, habsburgtreu, weltoffen, vielsprachig.
Sie waren aber anders als die meisten Adeligen, auch immer unternehmungslustig und Neuem aufgeschlossen. Jener Arlington unter Maria Theresia war es gewesen, der den Bau genormter Kolonistenhäuser, inklusive Kirchen, Pfarrhöfen, Schulen, Brauereien und sonstiger Wirtschaftsbetriebe für den Banat, gemeinsam mit dem Präsidenten der ungarischen Hofkammer, Graf Festetics und für Siebenbürgen, zusammen mit dem Leiter der Siebenbürgischen Hofkanzlei, Freiherrn von Bruckenthal ausgearbeitet und der Herrscherin vorgeschlagen hatte.
Der Familienlegende nach verdankte jener Paul, gewesener Freiherr und erster Graf von Arlington de Brösau auf Jungwaldt den neuen Titel damals weitaus eher jedoch der Tatsache, dass er eine abgelegte Geliebte Franz Stephans, geheiratet hatte, freilich nicht irgendeine, sondern eine Engelhorn de Burney-Bavary, aus ältestem oberösterreichischem und burgundischem Adel.
Das erste Kind dieser Ehe kam jedenfalls verdächtig früh und dabei verdächtig gesund auf die Welt, aber da es eine Tochter war, kümmerte es niemanden, ob sie vielleicht ein wenig lothringisches Blut in den Adern hatte und möglicherweise gar kein angelsächsisches. Und da sie später Äbtissin des Savoyischen Damenstiftes wurde und ergo kinderlos starb, kümmert es auch nicht die Geschichte.
Paul, mittlerweile eben Graf Arlington, jedenfalls verlagerte den Familienschwerpunkt vorläufig von Böhmen nach Wien, wie es schon früher in Familien wie der seinen vorgekommen war und in weiterer Folge immer geläufiger wurde. Der böhmische Adel, mit seinen flandrischen, iberischen und angelsächsischen Namen, lebte zu einem nicht geringen Teil in Wien, respektive der Wiener Adel lebte von böhmischen Besitzungen, die man irgendwann geerbt oder erheiratet hatte, teilweise nur selten betrat, mitunter nicht einmal kannte.
Graf Paul Arlington richtete im ohnehin nie besonders geliebten böhmischen Schloss Jungwaldt des weiteren eine Glasfabrik ein, eine Kristallmanufaktur.
Wiewohl in weiterer Folge traditionell jede Erzherzogin, die sich vermählte, zu ihrer Aussteuer eine Garnitur Arlington-Gläser geschenkt erhielt und diese daher nach Neapel gelangten, nach Parma und Modena, mit Marie Antoinette sogar nach Versailles, mit Marie Louise in die Tuilerien und später mit Leopoldine gar nach Brasilien, trotz all dem beschränkte sich der ursprüngliche Erfolg der Fabrik auf die Habsburger-Haushaltungen innerhalb der Kronländer und diverse Adelshaushalte.
Zur Zeit des Wiener Kongresses war man sich noch zu gut gewesen, oder auch nur zu weltfern, vielleicht ein Stadtgeschäft zu eröffnen um damit die anwesende internationale Prominenz als Klientel zu gewinnen.
Jetzt, anlässlich der Weltausstellung von 1873 hatte man ein wenig Geschichtsfälschung betrieben, schrieb allenthalben „100 Jahre Arlington Kristall“, wiewohl die Fabrik erst 1775 wirklich begründet worden war.
Man eröffnete elegante Geschäfte in Wien, Prag und Salzburg, sowie sommerliche Dependancen in Karlsbad und Bad Ischl und zahlte bereitwillig die horrenden Mieten für eine der Ausstellungsflächen in einem der neu erbauten Pavillons im Prater.
Denn jetzt, im Zeitalter der raschen Eisenbahnverbindungen und der immer leistungsfähigeren Dampfschiffe, war man entschlossen, die Welt zu erobern.
Auch war die politische Glanzzeit der Arlingtons aus dem achtzehnten Jahrhundert, als man sich ganz deutlich allerhöchster Gunst und entsprechender Beziehungen erfreut hatte, schon wieder vorbei. Die Arlingtons hatten für die Habsburger im Dreißigjährigen Krieg und gegen die Türken gekämpft und Maria Theresia einen ihrer rührigsten Minister beschert. Während der napoleonischen Kriege hatte sich kein glanzvoller Militär mehr gefunden und mit Metternich hatte sich der damalige Arlington so gar nicht verstanden, dass die Familie sich immer mehr vom Hof und ins Private zurückgezogen hatte.
Die Häuser aber waren groß und teuer und die Güter brachten auch nicht unbedingt den gewünschten Ertrag. Als Bierbrauer oder Mineralwasserfabrikant großes Stils wollte man auch nicht so sehr agieren und dass man am Parkring und in der Mariahilfer Straße zwei hochelegante Zinspalais erbaut hatte, das eine riesiger wie das andere, äußerst luxuriös und nur an die beste, da zahlungskräftigste Klientel vermietet, hängte man zum einen nicht an die große Glocke, zum anderen mussten sich die neuen Bauten auch erst noch amortisieren.
Mit Arlington – Kristall hingegen konnte und wollte man jetzt reüssieren!
Ja, Arlingtons hatten sich die letzten Jahrzehnte mehr und mehr vom Hof entfernt, sicher waren die jüngeren Söhne immer noch Offiziere und Diplomaten, das eine weniger, das andere immer mehr, - und Kirchenfürsten noch viel weniger -, sicher heirateten die Töchter wieder ihresgleichen, aber niemand drang mehr so richtig in Hofnähe vor, wo sich Kleinadelige und die verarmten Nebenzweige der alten Familien breit machten, abgesehen davon, dass die Kaiserin Elisabeth sich ja ohnehin nur mehr mit Ungarn umgab und überdies oft und gerne verreiste.
Im übrigen war der böhmische Adel – und dazu zählten Arlingtons trotz des britischen Namens – samt und sonders beleidigt über den sogenannten„Ausgleich“ von Anno 1867 mit Ungarn, der das eigenartige Konstrukt der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie in die Welt gebracht hatte.
Wenn jemand noch düpierter war als die treuen Böhmen, dann höchstens die noch treueren Kroaten, die man in Bausch und Bogen der ungarischen Reichshälfte überlassen hatte.
Es war eben erst zwei Jahre her, dass Kaiser Franz Josef seine Zusage zur Autonomie der böhmischen Länder zurückgezogen hatte, als man ihm die neue böhmische Landesverordnung vorgelegt hatte, welche Böhmen eine ähnliche Sonderstellung wie Ungarn gegeben hätte. Der Initiator, Ministerpräsident Graf Hohenwart, hatte darauf seine Demission eingereicht. Wie die Arlingtons hatten sich jedenfalls viele Familien ihres Ranges vom Hof und aus der Politik indigniert zurückgezogen, um hinter den grünen Jalousien ihrer Landhäuser und den Spitzengardinen ihrer Stadtresidenzen über den Lauf der Zeit zu räsonieren.
Der jetzige Chef des Hauses hatte jedenfalls den Seitentrakt des Stadtpalais in der Herzoghofgasse komplett in Wohnungen umbauen lassen, wozu ein ohnehin vorhandener repräsentativer Seiteneingang samt leidlich eleganter Treppenanlage äußerst zweckdienlich gewesen war.
Ein verglaster Gang verband über den hinteren Hof hinweg in Höhe des ersten Stocks die beiden Seitentrakte, so dass die Fenster der Hofseiten vom Anwesen der Familie Delanoix nicht allzu sehr in den Hof blickten.
Darunter rankte sich allerhand an Efeu, wildem Wein und dergleichen in gewollter Zwanglosigkeit empor. In der Hofmitte stand eine tatsächlich hundertjährige Kastanie, schon etwas morsch, weshalb jede Gräfin des Hauses mittlerweile früher oder später befürchtete, diese werde eines Tages einfach so ins Esszimmer krachen.
Im kürzeren Seitentrakt zur Falknergasse hatte man das Stadtbüro der Glasfabrik untergebracht, die allen Gütern in sämtlichen Krönländern übergeordnete Domänenverwaltung, das Familienarchiv, Personalzimmer, sowie eine Anzahl von Gästewohnungen. Die Familie selbst bewohnte mit dem engeren Personal den zum Alten Postplatz ausgerichteten Haupttrakt.
Da das Palais schon im Ursprung in erster Linie für private Angelegenheiten Franz Stephans eingerichtet worden war, hatte man nicht mit absurd großen Ballsälen zu kämpfen, die man heute kaum noch nützen würde. Man bewohnte freilich neben komfortabel und nach modernstem Geschmack eingerichteten Privaträumen, sehr wohl eine Anzahl an repräsentativen Räumlichkeiten rund um einen großen Salon, eine Enfilade an Zimmern im reinsten Schönbrunner Rokoko, mit weißgoldenen Wandvertäfelungen und roten Brokatstoffen ausgestattet, sowie ein Eckappartement zur Falknergasse im schönsten Biedermeierstil, das für Gastlichkeiten im kleineren Kreis genützt wurde.
Der Ecksalon zur Herzoghofgasse jedoch war schon von Franz Stephan von Lothringen als Arbeitszimmer genützt worden und war wohl einer der wenigen Räume, der von jedem Grafen Arlington neu und nach dem Geschmack der Zeit möbliert worden war, während bereits die daran anschließende Bibliothek seit dem Grafen Paul nicht mehr verändert worden war und den Schlusspunkt der Rokoko-Räume bildete.
Unter Graf Ludwig und Gräfin Eugenie Arlington hatte sich daher in jenem Eckzimmer der überladene Stil der Zeit breit gemacht, beeinflusst vom umschwärmten Lieblingsmaler der Wiener Gesellschaft, Hans Makart, von dem die Zeitgenossen nicht wissen konnten, dass sein Name ihn als Modeerscheinung in der Möblierung eher überdauern würde als seine Gemälde.
Ganz Wien sprach vom „Makart-Stil“ und meinte damit üppigen Luxus vom Feinsten, schwere Bordüren, welche die Fenster verdunkelten und den Blick beeinträchtigen, orientalische Teppiche, großformatige Bilder mit Historienszenerien, Allegorien oder überwältigenden Stilleben, riesige Topfpflanzen, feuervergoldete Bronzestatuten, die Lampen oder Blumenschalen oder auch gar nichts hielten. Den Großen Salon schmückte dazu noch ein lebensgroßes Porträt der Gräfin Eugenie von der Hand des Meisters.
In Graf Ludwigs Arbeitszimmer hatten sich darüber hinaus neben einem massiven Mahagonischreibtisch noch englische, lederbezogene Clubsessel breit gemacht, sowie ein völlig sinnloses Klavier, das nur als Unterlage diente für einen enormen Bronzeleuchter und eine Anzahl von in Silber gerahmten Familienphotos. Sinnlos, weil es zum Charakter eines Arbeitszimmers nicht so recht passen wollte und andrerseits, weil die Arlingtons notorisch unmusikalisch waren.
Gräfin Eugenie aber hatte es bei Fürstin Pauline Metternich ähnlich gesehen, für originell befunden und bedeckte überhaupt laufend sämtliche adäquaten Möbelstücke mit gerahmten Photographien von Verwandten, Freunden, Kindern in allen Lebensaltern, Hunden und Pferden.
Jetzt saß sie mit ihrem Mann beim Nachmittagskaffee und ofenwarmen Guglhupf, zur Jause, zu der jeden Moment ihre Tochter Amelie stoßen sollte, wenn sie aus der vis-a-vis gelegenen Schule kam.
Graf Ludwig rätselte über eine Visitenkarte, die gestern beim Prokurist Brauner im Weltausstellungspavillon abgegeben worden war.
„Comte Sergej Arlington, St. Petersbourg”, war darauf zu lesen, auf der einen Seite natürlich kyrillisch, auf der anderen Seite in lateinischen Buchstaben und der Adelstitel eben französisch.
„Ich weiß nicht, ob es ein Bruder oder ein Cousin vom Paul war, der damals nach Russland gegangen ist.“, hatte Ludwig eben zu seiner Frau gemeint.
Man hatte aus Ehrerbietung gegenüber dem ersten Grafen der Familie niemals wieder einen Sohn des Hauses Paul genannt. Wenn man also von einem Paul sprach, meinte man immer den einen, den ersten eben.
„Ich glaube, er war mit Potemkin auf der Krim oder so ähnlich. Ob das wirklich sein Nachfahre sein kann?“
„Nun, ihr Arlingtons wart doch früher so reiselustig.“, antwortete seine Frau, „Arlingtons in England, Arlingtons in Böhmen, in Frankreich, sogar in Amerika! Hör ich doch dauernd von Amelie, unserer Familienhistorikerin. Ich weiß von den Arlingtons mehr als von meiner Familie.“
Gräfin Eugenie entstammte einer alteingesessenen steirischen Landadelsfamilie, Franck von Osterrode, die nach eigener Überlieferung „seit vierhundert Jahren nicht mehr das Haus gewechselt hat“. Die Familie war ihrerseits dadurch auch nie über den Freiherrentitel hinausgelangt, hatte es nie zu einem Stadtpalais in Graz oder sonstigen ausgedehnten Besitzungen gebracht, auch nicht zu einem Schloss im Tal, war immer auf der alten Burg hoch droben am Berg verblieben.
Dennoch galt die Ehe als absolut standesgemäß und Eugenie hatte sich rasch in die Wiener Verhältnisse eingefügt. Sie hatte bloß nie einen besonderen eigenen Geschmack entwickelt. Sah sie etwas in den Häusern bei Metternich, Kinsky, Harrach, Wilczek und Konsorten, was von jenen Damen des Hauses als en vogue betrachtet wurde, nahm sie es ebenso unbefangen wie unbenommen für ihren Haushalt auf. Dies galt auch für die Auswahl ihrer Schneiderin, ihrer Modistin, des Photographen, der Restaurants, Ausstellungen und Opernaufführungen, die „man“ besuchte, wie für die Zusammenstellung ihrer Buffets. Sie wirkte zurückhaltend aristokratisch wie die meisten Wiener Damen ihres Schlages.
Lediglich einem Hang zu Schmuck gab sie gerne etwas leichtfertig nach, ging bei Köchert und anderen Juwelieren ein und aus. Sie hatte außer einem Complet an Diamanten aus der Zeit des Grafen Paul und seiner Gräfin Ludovika nicht viel mehr an Familienschmuck vorgefunden als eine Perlengarnitur ihrer früh verstorbenen Schwiegermutter und sie selbst hatte als Aussteuer auch nicht viel mitbekommen.
Sie jedoch legte sich eine regelrechte Schmucksammlung zu und war bekannt dafür, zu jedem Hofball etwas großartig Neues zu präsentieren. Es war der einzige echte Luxus, den sie sich gönnte und dem ihr Gatte auch gerne nachkam.
In Fragen der Garderobe hingegen war sie ausgesprochen sparsam, ließ ihre Toiletten andauernd umarbeiten, neu färben oder sonst wie auffrischen. Und so gerne sie Gesellschaften gab, war sie auch in Fragen der Bewirtung eine gute Rechnerin.
Sie bezog das meiste an Weinen oder Fleisch im großen Umfang von den Gütern ihres Mannes oder ihres Vaters, kaufte eher österreichischen Sekt bei Schlumberger, bevor sie französischen Champagner kredenzte und stellte lieber einen Pâtissier fest an, als dass sie Süßigkeiten bei Demel oder Gerstner orderte.
Auch in der Auswahl ihrer Gäste folgte sie nicht so ohne Weiteres den engen Grundsätzen der Damen der „Ersten Gesellschaft“.
Sie hatte von den steirischen Jagdgesellschaften ihrer Eltern eine bodenständige Unvoreingenommenheit übernommen, sammelte eifrig und bei jeder Gelegenheit Visitenkarten ein, um ihre Gästeliste zu bereichern.
Sie, ihr Mann, die Tochter Amelie und die Söhne Stephan und Niklas hatten ihre Geburtstage herrlich über das Jahr verteilt, dazu kamen noch die Namenstage, der Hochzeitstag, ein Hausball im Fasching, mindestens eine wirklich große Jagd, ein Sommerfest in der Villa am St. Zeno See und dergleichen mehr.
Eugenie liebte Gesellschaften jeder Art, vor allem aber solche mit gemischtem Publikum und sie verstand sich wie kaum eine anderen der tonangebenden Wiener Gastgeberinnen darauf, ihre Gesellschaften interessant zu arrangieren.
So verkehrten bei ihren Abenden auch jüdische Industrielle wie Baron Todesco, oder die griechischstämmigen Banquiers Dumba und Lakis, aber auch bürgerliche Unternehmer, Universitätsprofessoren, Offiziere und hohe Ministerialbeamte.
Eugenie war offen in Dingen des Glaubens – wiewohl katholisch, aber nicht besonders fromm, sie war offen in Angelegenheiten des Standes, - wiewohl selbst durch und durch altadeliger Abstammung, - sie war offen in Fragen der Herkunft, - wiewohl sie außer Französisch keine Fremdsprache beherrschte und dies daher auch bei ihren Gästen voraus setzen musste.
Sie war nicht offen in Fragen der Kunst. Sie war nicht nur unmusikalisch wie ihr Mann, sondern völlig amusisch und an Künstlern als Menschen absolut desinteressiert. So blieben ihre Häuser etablierten Burgschauspielern und gefeierten Hofopernsängerinnen, Komponisten oder Schriftstellern ebenso verschlossen, wie die meisten Wohnungen ihrer Standesgenossen. Wenn sie eine der Aufführungen in der vor wenigen Jahren neuerbauten Hofoper oder im altehrwürdigen Burgtheater besuchte, die „man“ eben allgemein besuchte, döste sie meist vor sich hin, im Kopf die übernächste Gästeliste oder das Buffet der nächsten Einladung.
Angesichts der Tatsache, dass sie am selben Tag unter Umständen mit einer jüdischen Baronin zu Mittag speisen konnte, um abends den griechischen Gemeindevorsteher neben Kardinal von Rauscher und dem päpstlichen Nuntius zu Gast zu haben, erschien ihr Umgang dennoch beinahe gewagt und vielen ihrer hochadeligen Freundinnen geradezu fragwürdig.
Dass ihre Söhne, der vierzehnjähriger Stephan und der zwölfjährige Niklas das Gymnasium im Schottenstift besuchten, ging ja noch durch, wiewohl Grafensöhne allgemein eher ins Theresianum oder zu den Jesuiten nach Kalksburg geschickt wurden, die mittlerweile sechzehnjährige Amelie aber in dieses neumodische Mädchenlyzeum zu geben, das wurde bei so manchem Damenkränzchen bei Kaffee und Kuchen beredet.
Aber hinterfragt wurde auch ihr Mann, der Graf Ludwig, vor allem jetzt, wo er während der Weltausstellung mit seiner Glasmanufaktur so protzte.
Er hatte tatsächlich jedem einzelnen in Wien akkreditierten ausländischem Botschafter eine Auswahl an Arlington-Kristall präsentiert. Er hatte auch von der Hofkanzlei die Bewilligung erhalten, jedem ausländischen Staatsgast, sei es der Schah von Persien oder der russische Zar, ein entsprechendes Präsent zukommen zu lassen, lediglich die alte Arlingtonsche Tradition, jeder Erzherzogin ein Hochzeitsgeschenk zu machen, beschränkte sich mittlerweile auf einen bestimmten Pokal, der nur für die Damen aus dem Hause Habsburg-Lothringen anlässlich deren Vermählung produziert wurde, das jeweils eigene Wappen mit dem Wappen des Bräutigams in der Gravur verknüpfend.
Jeder Erzherzogin ein komplettes Gläserservice zu schenken, hätte sich mittlerweile als entschieden zu kostspielig erwiesen. Die Anzahl der in Frage kommenden Damen des Hauses hatte sich nämlich geradezu inflationär entwickelt, lebten doch mittlerweile all jene aus Italien vertriebenen Nebenlinien wie Toskana, d´Este-Modena und Pontecorvo in der Stadt, gab es doch Seitenlinien in Ungarn und in Polen.
„Mir genügt es, wenn ich in jedem Habsburger-Haushalt mit einem einzigen Pokal bin,“ hatte Graf Ludwig bei Gelegenheit zu seinem Prokuristen Brauner einmal gesagt, „damit haben wir den Fuß für künftige Bestellungen schon in der Tür.“
Ludwig war ein kühler Pragmatiker und ein nüchterner Rechner, wenn es sein musste. Er wusste genau, wieviel ein Landarbeiter auf seinen Gütern verdiente, oder wieviel die Kleidung jedes Hausmädchens pro Jahr kostete und wie hoch der Witwen- und Waisenfond seiner Fabrikarbeiter war, konnte er täglich aus seinem Kopf abrufen, auf ein paar Hundert Gulden auf oder ab wenigstens.
Seine Eltern waren bereits verstorben, er hatte nur eine Zwillingsschwester, die sich nach Salzburg verheiratet hatte, keinerlei sonstige Verwandte, die er versorgen musste. Er hatte auch nur drei Kinder, was sich wohl kaum noch ändern würde und wusste diese eines Tages gut versorgt. Sein persönlicher Lebenswandel war eher bescheiden, aber dennoch lebte er auch nie in einem aristokratischen Traumland. Glaubte er wenigstens. Er überließ seine Frau gerne ihrer hektischen Umtriebigkeit, begleitete sie mit einer gleichgültigen Nonchalance auch überall hin und empfing jeden mit heitererem Desinteresse, den sie einlud. Er selbst hatte nur wenige Freunde und pflegte überhaupt keine Bekanntschaften mehr. Dass diese seine Freunde alle adelig waren, bemerkte er nicht, hinterfragte er nicht. Er kannte ja sonst niemand.
Natürlich hatte er mit Ferdinand einen alten, väterlichen Diener, der ihn seit seiner Kindheit begleitet hatte und es sich auch in seiner wohlverdienten Pension nicht nehmen ließ, mit seinem einstigen Zögling so manche Partie Schach zu spielen.
„Wos gibt´s Neues?“ fragte Ferdinand immer beim ersten Zug und dann erzählte Graf Ludwig, wie er niemandem sonst erzählte. Ferdinand sagte dabei wenig, aber wenn, dann hatte es Sinn.
Als Ludwig von den neu eröffneten Stadtgeschäften in Wien, Salzburg und Prag erzählt hatte, war Ferdinand der erste gewesen, der meinte, er solle denn doch auch ins Ausland gehen.
„Nach München g´hörst mit deinem Glas, nach München, nach Dresden, nach Russland, St. Peterburg vor allem. Wohin auch immer. Keine Auslandsfilialen, sondern Vertretungen, die was dir deine Ware abkaufen und selber schau´n müssen, wie´s weiterkommen. Und werd´ mir ja ka´ Hoflieferant. Net amal bei uns. Tu dir nie z´viel mit´n Hof an! Nur Zores hat ma´ mit der Kamarilla!“
So sprach der gräfliche Kammerdiener Ferdinand bisweilen.
Ludwig war dankbar, dass Ferdinand seine Pension hier im Stadtpalais hatte verbringen wollen. Mit Franz, seinem neuen jungen Diener und seines Zeichens ein Großneffe Ferdinands, entwickelte sich allmählich eine ähnlich herzliche Gemeinschaft, vor allem während der Jagden. Dennoch hätte Ludwig naturgemäß keinen von beiden seinen Freund genannt.
Die Arlingtons bezogen seit Generationen ihre persönlichen Diener von den steirischen Gütern, die Köchinnen kamen aus Böhmen, aus Görz oder Bozen, die Dienstmädchen, die Hausburschen bezog man über einschlägige Agenturen aus dem Wiener Raum und dem niederösterreichischen Umland.
Eugenie hatte sich zu Beginn ihrer Ehe eine frankoschweizerische Zofe zugelegt, um ihr provinzielles Schulfranzösisch zu verbessern, jene Louise war bald zur „Mademoiselle Louise“ avanciert, zur Gesellschafterin und Vertrauten geworden, während die eigentlichen Zofen einem gewissen Wechsel unterworfen waren.
Die Kinder hatte man gemeinsam von einer französischen Gouvernante und einer irischen Nurse aufziehen lassen, so dass sie beide Sprachen von Anfang an fließend beherrschten. Es war Eugenies Idee gewesen, dass „Leute namens Arlington“ auch Englisch neben dem allgemein üblichen Französisch beherrschen sollten.
Mittlerweile leistete man sich freilich einen jungen Studenten der Rechtswissenschaften, einen Herrn Vorhofer, als eine Art nachmittäglichen Hauslehrer, der Nachhilfe gab, bei den Hausübungen half und die Kinder gegebenenfalls begleitete. Er entstammte kleinsten Verhältnissen, erfreute sich jedoch der Förderung einer Baronin Fasching von Fuchsenfeld, die seiner Mutter verbunden war und ihn den Arlingtons empfohlen hatte. Er wohnte im Haus, was für beide Seiten praktisch war. Da die Kinder tagsüber in den jeweiligen Schulen waren, konnte er seine Vorlesungen besuchen und sich dennoch um seine Anvertrauten kümmern.
Mademoiselle Louise und Herr Vorhofer waren die einzigen Angestellten, die ihre Mahlzeiten am Familientisch einnahmen und auch bei Gastlichkeiten zugelassen waren, Herr Vorhofer in einem umgearbeiteten Frack Ludwigs, da er kleiner und schlanker als Graf Ludwig war, während Mademoiselle abgelegte Abendkleider der Gräfin Eugenie austrug, die sie stets nach ihrem eigenen Geschmack zu verändern verstand.
Geleitet wurde der gesamte Arlingtonsche Haushalt zusammen von den Wotrubas, Vater, Mutter und jetzt bald zwanzigjährigem Sohn Hannes.
Vater Wotruba war ein kleiner und äußerst glückloser Gewerbetreibender gewesen, so glücklos, dass seine Frau sich als Köchin verdingt hatte.
Binnen kurzer Zeit hatte sie derart schöpferische organisatorische Qualitäten entwickelt, dass man ihr nicht nur gestattet hatte, ihren damals noch kleinen Sohn zu sich kommen zu lassen, sondern auch bald danach ihr Mann in den Haushalt aufgenommen worden war. Der junge Wotruba stand zwischen den Ständen der Gesellschaft. Einerseits hatte Graf Ludwig ihm eine Handelsschule und einen Französischlehrer bezahlt, andrerseits war man seitens der Familie ganz von allein davon ausgegangen, er würde quasi den Posten seiner Eltern eines Tages übernehmen. Zur Zeit sah es auch ganz danach aus. Frau Wotruba war mehr oder weniger für das niedere Personal und für die Leitung der Küche zuständig, - und insgesamt die höchste Respektsperson des Hauses – manchmal sogar für dessen gräfliche Bewohner -, Herr Wotruba kümmerte sich vor allem um die Droschken und Pferde und Wotruba junior – in der gräflichen Umgangssprache allgemein schlicht „Junior“ genannt – hatte sich als der perfekte Organisator von Ludwigs geliebten Reisen und Eugenies geliebten Abendgesellschaften entpuppt.
Ansonsten hatte Graf Ludwig täglichen Umgang mit dem verdienten Prokuristen Brauner, seinem Verbindungsmann zur böhmischen Fabrik, Herrn über das Büro und die Stadtgeschäfte und Herrn von Valenta, seinen obersten Domänenverwalter, die beide zwar im Palais arbeiteten, aber oft genug auf Reisen waren und mit ihren Angehörigen außerhalb des Haushalts lebten.
Gräfin Eugenie hatte keine Vorurteile gegenüber Bürgerlichen, solange sie gesellschaftsfähig waren, Graf Ludwig, dem die Bekannten seiner Frau herzlich gleichgültig waren, egal ob adelig oder bürgerlich, hatte keine Vorurteile gegenüber Bürgerlichen, denn er persönlich kannte keine.
Jetzt sinnierte Ludwig immer noch über der Visitenkarte seines angeblichen russischen Großgroßcousins, oder was auch immer jener Comte Sergej Arlington genau zu ihm wäre. Er rätselte auch über den Verbleib von Amelie, bis Eugenie plötzlich einfiel, Herr Vorhofer habe sie heute abgeholt, sie brauche irgendwas in der Papierhandlung, man würde in der Stadt jausnen.
Eugenie bedauerte, dies vergessen zu haben, sie war nicht nur im Kopf mit irgendeiner Gästeliste überfordert gewesen, sie hatte sie vor sich liegen und kritzelte eifrig daran herum.
„Und die Buben?“, fragte Ludwig, der die Jause mit seiner Frau plötzlich fade fand.
„Irgendeine Schulversammlung, der Junior holt sie ab.“, Eugenie vertiefte sich wieder in ihre Gästeliste, als Ludwig wissen wollte, worum es au fond denn eigentlich ginge.
„Ich grüble über die Tischordnung für Samstag.“, antwortete seine Frau, „Dieser Deutsche, Von Martensen, hat abgesagt, muss wegen der kranken Schwiegermutter nach Berlin, so sagt er jedenfalls. In Wirklichkeit aber ist seine Frau so langweilig, dass sie nicht ausgehen will, wie ich mittlerweile herausgefunden habe. Ich werd´ die zwei auch nicht mehr einladen. Jetzt aber rätsle ich, wen ich zwischen deinen Cousin Philipp und meiner Cousine Helene setze. Wenn ich nicht irgendein hochanständiges Ehepaar dazwischen platzier´, wittern die beiden sofort, dass ich sie verkuppeln will. Ich hab´ aber kein Ehepaar mehr übrig, ich brauch´ alle schon woanders.“
Ludwig, der einerseits die Tischordnungswut seiner Frau bewunderte, der sich andrerseits nur mehr dunkel erinnern konnte, dass jenes Dîner aus Anlass Herrn Brauners fünfzigsten Geburtstags gegeben wurde, die Gästeliste aber natürlich überhaupt nicht im Kopf hatte, erkundigte sich beiläufig nach in der Nähe platzierten Gästen. Er wurde von seiner Frau sanft daran erinnert, dass zu Ehren Herrn Brauners in erster Linie Geschäftsfreunde des Hauses eingeladen waren, sowie alle möglichen Menschen, mit denen Brauner während der Weltausstellung in Kontakt gekommen war. Dazu die übliche Anzahl an Familienmitgliedern, vor allem jedoch sein böhmischer Cousin und ihre steirische Cousine, die sie zu verkuppeln gedachte. Als Ludwig dann von einem belgischen Industriellenehepaar hörte und einem schwedischen Banquier, einem Witwer zwar, aber „jenseits der Fünfzig, somit nicht gefährlich für Cousine Helene“, so die Worte seiner Frau, schloss er daraus, dass wenigsten an jener Ecke der Tafel französisch gesprochen werden würde, ja müsste und meinte leichthin:
„Was, wenn wir die Russen einladen?“
Er hatte nämlich die Erfahrung gemacht, dass man seine Frau am ehesten in ihrer wohlgeordneten Unruhe beeinflussen konnte, wenn man die eigenen Absichten ganz en passant einstreute.
„Was denn für Russen?“
Eugenie war so fassungslos, dass Ludwig innerlich triumphierte.
„Na, eben diesen russischen Arlington. Laut Brauner wohnt er samt Gattin im Hotel „Metropol“. Und wenn er nicht wirklich mein Cousin ist, so ist er doch mein Namensvetter. Das wär doch originell, oder?“
Jetzt erst wollte Eugenie wissen, was es denn mit jener geheimnisvollen Visitenkarte auf sich habe. Herr Brauner, so Ludwig, sei im Weltausstellungspavillon von einem sehr soignierten Russen in Begleitung einer ebenfalls äußerst distinguierten Dame angesprochen worden, der auf das Schild „Arlington-Kristall, feinste böhmische Glasware“ gedeutet habe und meinte, sein Name sei eben auch Arlington und er wisse, dass seine Familie aus Österreich, respektive aus Böhmen stamme. Es wäre doch vielleicht interessant, herauszufinden, ob man verwandt sei. Er sei sicher noch zwei Wochen in der Stadt und würde sich freuen, mit den hiesigen Arlingtons in Kontakt treten zu können. Laut Brauner, so Ludwig weiter, sprach er übrigens ein ausgezeichnetes Französisch, „nicht das, was Russen oft und gerne für Französisch halten“, so Brauner wörtlich.
Eugenie war plötzlich Feuer und Flamme. Ein russischer Arlington war die Attraktion, die ihr für diesen Abend noch gefehlt hatte. Sie hatte selbst so halb und halb den Anlass oder Vorwand für jene Einladung vergessen und die Gästeliste unterm Strich für dürftig befunden, was sie natürlich nie zugegeben hätte.
Mit einem russischen Arlington aber, würde der Abend ungemein bereichert werden, ganz gleich, ob verwandt oder nur namensverwandt, es war originell genug. Natürlich musste man Amelie in die Nähe der Russen platzieren, jetzt wisse sie freilich nicht, was sie mit dem Schweden tun solle.
„Gleichwie, ich such´ mir gleich eine Einladung heraus, schreib´ ein paar Zeilen dazu und schick den Junior hin, bevor er die Buben abholt, „Métropole“ und Schottengymnasium liegen zwar am jeweils anderen Ende der Stadt, aber was soll´s!“
Da mit „Die Stadt“ in Wien stets nur die Innenstadt gemeint ist und nicht die ganze Stadt als solche, befand Ludwig die Situation bei weitem nicht so dramatisch wie seine Frau es ausdrückte, aber sie neigte ohnehin immer ein wenig zur Übertreibung.
Während des Abendessens am selben Tag spitzte sich die Lage freilich noch zu, denn ein Page des Hotel „Métropole“ brachte die Nachricht, dass Comte Sergej Arlington, samt Gattin und Sohn gerne die Einladung annehmen würden.
„Und Sohn?“, Eugenie kreischte beinahe. „Drei? Wie soll sich das denn jetzt ausgehen? Jetzt hab ich grad noch den Schweden so gut untergebracht! Oh, mein Gott, das ist ja eine Katastrophe!“ Sie zog sich mit Louise noch vor dem Dessert und sehr formlos, geradezu überstürzt, zurück.
Ludwig, Amelie und die Buben lächelten freilich. Sie wussten, wenn Eugenie etwas für katastrophal befand, war sie in Wirklichkeit erst richtig herausgefordert.
Im Endeffekt saß fünf Tage später die sechzehnjährige Komtess Amelie bei jenem Dîner sehr nahe beim siebenundzwanzigjährigen Comte Sergej Sergejewitsch und konnte ihn gar nicht leiden. Natürlich sah er gut aus, er sah sogar verboten und unanständig gut aus, aber genau das und eine gewisse selbstgefällige, vielleicht auch nur zu selbstbewusste Art des jungen Russen, ließen ihn in ihren Augen und sonstigen Sinnen geradezu abstoßend erscheinen, wenn auch abstoßend gutaussehend, immer noch! Abgesehen davon, war er ja auch entschieden zu alt für sie!
Eugenie hatte das gesamte Programm für diesen Abend über den Haufen geworfen und neu gestaltet. Sie hatte die russische Gräfin Arlington, Maryna mit Vornamen, im Café vom Hotel „Métropole“ zunächst allein getroffen.
Innerhalb kürzester Zeit hatte Eugenie heraus bekommen, dass die russischen Arlingtons katholisch geblieben waren, dass Gräfin Maryna einer polnischen Familie entstammte, Kleinadel zwar, aber mütterlicherseits mit Lubomirskis und Zamoiskis verwandt, mit Radziwills wenigstens verschwägert.
Man bewohnte eine Villa in Zarskoe Selo und eine Stadtwohnung in St. Petersburg, nahe des Taurischen Palais, sowie einen Sommersitz auf der Krim. Man lebte, so schien es, hauptsächlich von Petersburger Mietshäusern, besaß aber auch Güter in Polen, Bessarabien, auf der Krim und in der Ukraine. Auch die russischen Arlingtons betrieben eine Fabrik auf einer ihrer Besitzungen, nämlich eine Wodka-Brennerei.
Ansonsten widmete sich Gräfin Maryna offenbar hauptsächlich ihrer Rosenzucht, teils in hochmodernen, neumodischen Glashäusern nahe St. Petersburg, teils auf der Krim. Die Arlingtonschen Rosen waren bekannt in ganz Russland und en passant, auch ein interessantes Zubrot, wie die Gräfin Maryna leichthin bemerkte.
Eugenie überlegte, ob die Russen wohl Arlington-Glas in St. Petersburg vertreten würden wollen, wenn sie sogar aus einer Rosenzucht Einnahmen schöpften.
Zugleich überlegte sie, ob man neben Wein und Obst in der Steiermark nicht auch Blumen züchten könne. Sie musste demnächst mit Ludwig darüber sprechen.
Sergej Sergejewitsch war Marynas einziger Sohn, sie hatte Zwillinge gehabt, aber das Mädchen sei verstorben, eine Bemerkung, bei der Eugenie das Herz überging, denn ihr war das selbe bei der Geburt Amelies passiert, nur mit einem kleinen Zwillingsbuben. Die Damen hielten es für ausgemacht, dass ihre Männer miteinander verwandt seien, denn die häufigen Zwillingsgeburten bei den Arlingtons waren dort wie da legendär, noch dazu waren es meist ein Mädchen und ein Bub, leider ging es eben nicht immer gut.
Bevor Gräfin Maryna noch mehr über ihren Sohn erzählen konnte, war dieser zu den Damen gestoßen, hatte seinen Vater entschuldigt und Eugenie bald mit seinem ganzen jugendlichen Charme, seinem blendendem Aussehen und strahlendem Lächeln ganz und gar eingenommen.
Wieder zu Hause angelangt, hatte sie nach Louise verlangt und sich mit ihr bei Tee und belegten Broten eingeschlossen, anstatt am gemeinsamen Abendessen teilzunehmen. Die Tischordnung wurde völlig neu konzipiert und geradezu sensationell gestaltet.
Selbstverständlich blieben der Prokurist Brauner samt Gattin und Tochter die Ehrengäste und nach wie vor waren die Gäste großteils bürgerlicher Provenienz, Geschäftsleute, Industrielle und Banquiers. Mit den russischen Arlingtons als zweite Ehrengäste und eigentlicher Attraktion des Abends jedoch, stand Eugenie vor einer echten Herausforderung. Sie platzierte schließlich ihren Mann an der Spitze der Tafel, mit Frau Brauner an seiner Seite, während sie das andere Ende der Tafel einnahm, mit Herrn Brauner zu ihrer Rechten. In die Mitte der Tafel setzte sie den Grafen Sergej, mit ihrer Cousine Helene als Tischdame, sowie vis-a-vis die Gräfin Maryna mit Ludwigs Cousin Philipp als Tischherrn. Amelie saß zwischen Philipp und dem jungen Sergej Sergejewitsch, und Fräulein Brauner neben Graf Sergej und begleitet von ihrem Verlobten, einem im Kriegsministerium tätigen kleinadeligen Linienschiffsleutnant.
So hatte Eugenie ihre junge Cousine zugleich bei dem von ihr auserkorenen Cousin Philipp, wie auch dem Grafen Sergej Sergejewitsch untergebracht, so dass sie die Wahl hatte, wen von beiden sie interessanter finden mochte.
Dass jener eventuell ihre eigene Tochter interessant finden und zum Objekt seiner Verehrung ausersehen sollte, war ihr nicht in den Sinn gekommen.
Ihr erschien Amelie noch zu jung, verglichen mit der vierundzwanzigjährigen Helene, die bald über bleiben würde, so sie nichts unternahm, trotz ihres leidlich guten Aussehens und unübersehbar großen Vermögens.
Außerdem hätte Eugenie ja gar keine andere Möglichkeit gehabt als den jungen Russen von ihrer Tochter zu Tisch begleiten zu lassen. Es hätte Eugenie jedoch insgesamt keineswegs gestört, ihre Tochter vielleicht nach St. Petersburg zu verheiraten. Sie und Ludwig hatten Schwestern, Cousinen und Nichten in Salzburg und Graz, in Prag und Olmütz, in Dresden und München, in Triest und in Pola.
Hätte sie etwas bemerkt, Eugenie wäre freilich an und für sich nicht gegen eine Entwicklung gewesen, die ihre Tochter vielleicht nach Russland führen könnte.
Sie sollte an diesem Abend freilich noch so manches übersehen.
Alles in allem waren fünfzig Personen zu Tisch, mehr hätte das große Esszimmer auch nicht verkraftet, in einem daran anschließendem kleineren Esszimmer, das ansonsten en famille genutzt wurde, tafelte Herr Vorhofer mit den Buben und Mademoiselle Louise, sowie die Gesellschafterin der früh verwaisten Helene, die jüngere Tochter der Brauners und der dreizehnjährige Sohn des Herrn von Valenta.
Während Frau Wotruba samt der Köchin im Hintergrund agierte und höchstens im Anrichtezimmer auftauchte, Herr Wotruba bei solchen Gelegenheiten sowieso unsichtbar blieb, glitt Wotruba junior sicher durch die Gesellschaftsräume, trotz seiner Jugend alles und jeden im Blick. Heute war seine Konzentration besonders gefordert, denn gut die Hälfte der Gäste, wenn nicht mehr, war das erste Mal und zugleich wohl auch meist das letzte Mal da, also musste man um so besser in Erinnerung bleiben, durfte einem nicht der kleinste Schnitzer unterlaufen.
Jetzt, gegen Ende der Weltausstellung, war die Stimmung wieder gut. In einer gewissen Euphorie waren Dutzende neuer Hotels entstanden und die Großbaustelle der Ringstraße, die „Palast-Umkränzung“ der alten Stadt, war als großstädtische Entwicklung von den Besuchern goutiert worden.
Auf über 200 Hektar Ausstellungsfläche im Prater, dem alten kaiserlichen Jagdrevier, hatte das geneigte Publikum auf 1.700 Kilometern Wegstrecke ungefähr das Fünffache an Fläche und Wegstrecke zu bewältigen, wie 1867 in Paris geboten worden war. Vier große Haupthallen, die sich um die „Rotunde“ gruppierten, - dem momentan höchsten Kuppelbau der Welt - , waren der Industrie, dem Maschinenbau, der Landwirtschaft und der Kunst gewidmet. Daneben gab es Hunderte Einzelpavillons, bewohnte Bauernhäuser, exotische Bauten, Kaffeehäuser und Restaurants zu besichtigen. Den höchsten Anklang fanden der tunesische Basar, der japanische Garten und die ägyptische Baugruppe. Ja, es machte sich in Wien eine ganz neue Mode breit, die Parkettböden mit orientalischen Teppichen zu bedecken, die dem Wiener allgemein als „persisch“ galten.
Der Börsenkrach war wie ein Blitz in die glanzvolle Stimmung gefahren, die Choleraepidemie im Frühsommer hatte den Besucherstrom gehemmt. Man konnte getrost von einem Defizit der ganzen Veranstaltung ausgehen. Dennoch hatte Wien sich das erste Mal als Metropole von Rang erwiesen. Während der sechs Monate der Ausstellung hatten 33 regierende Fürsten, 13 Thronfolger und 20 Prinzen dem Wiener Hof einen Besuch abgestattet. Die Stadt war mittlerweile wirklich über den barocken Festungsgürtel hinausgewachsen, der solange jede städtebauliche Entwicklung behindert hatte. Man war ins Zentrum Europas gerückt.
Heute Abend jedenfalls war die Stimmung gut, man übersah das eine Menetekel namens Börsenkrach genauso gerne, wie das andere , genannt Cholera, wollte die flammenden Schriftzeichen an der Wand nicht erkennen, sondern vergessen.
Auch war dieses Dîner, einen Monat vor dem Ende der Weltausstellung eine der letzten Möglichkeit für Graf Ludwig, seine internationalen Kontakte zu vertiefen. Abgesehen von den russischen Arlingtons, dem belgischen Industriellenehepaar und jenem schwedischen Banquier, waren also auch noch Damen und Herren aus Deutschland, England, Italien, Frankreich und der Schweiz zu beeindrucken. Angesichts des erst zwei Jahre vergangenen Krieges zwischen Deutschland und Frankreich, musste man noch dazu etwaige Animositäten zwischen reichsdeutschen und französischen Gästen ins Kalkül ziehen.
Man servierte jedenfalls Austern mit Zitrone, Suppe a´la Reine, farcierte Trüffeln, Kuchen a´la Chambord, Filet a´la Jardinière, Hummer mit Sauce Tartare und Aspik, gebratenen Aal mit Zitrone, Lammbries mit Champignonpüree, Fasan und Poularden mit Kompott und Salat, Kapaunsoufflée, Gansleber, eingelegten Spargel mit Buttersauce, weißes Zitronenkoch, Samtcreme, Kastanienpudding und Früchtegefrorenes. Zum Mokka folgte statt der sonst üblichen Bäckerei eine Torte, Herrn Brauners Lieblingstorte á la Chantilly, aus der Konditorei Gerstner und daher als einziges geliefert und nicht im Haus zubereitet.
Nach dem Essen verteilte man sich von den hofseitig gelegenen Speiseräumen in die Rokoko-Enfilade zum Platz hin, inklusive der Bibliothek, wo die Herren gelegentlich eher unter sich und bei ihren Zigarren verblieben und dem Biedermeierappartement, wohin es aus unerklärlichen Gründen stets die jungen Leute zog.
Die Damen mittleren Alters, sowie die ausländischen Gäste hielten sich diesen Abend hauptsächlich im Großen Salon auf.
Eugenie war nicht entgangen, dass die Russen schon allein vom Haus beeindruckt waren, erst recht von der internationalen, wenn auch eher bourgeoisen Gästeliste und dem superben Dîner. Ebenso nahm sie wahr, dass Cousin Philipp sich wunschgemäß angeregt mit Cousine Helene unterhielt, die sich beide zuletzt als halbe Kinder gesehen hatten.
Eben als sie sich nach Amelie umsehen wollte und zugleich den jungen Grafen Sergej suchte, kam Herr Vorhofer mit den Buben, um sich für die Einladung zu bedanken, - was er immer bei solchen Gelegenheiten tat, wiewohl es nicht erwartet wurde -, und um sich mit den Buben zugleich zu verabschieden.
Dann verabschiedete sich auch noch der verwitwete und sehr zurückgezogen lebende Herr von Valenta samt Sohn und der jüngeren Brauner-Tochter, die er nach Hause bringen würde, die Gesellschafterin von Helene, eine altjüngferliche Ungarin, zog sich in ihr Gästezimmer zurück und Louise meinte, sie würde zur Wotruba und zur Köchin gehen, um sich jetzt schon in Eugenies Namen für das gelungene Essen zu bedanken.
Eugenie bewilligte eine Flasche Sekt für das Küchenpersonal, wohl wissend oder wenigstens ahnend, dass daraus auch deren zwei oder auch drei werden würden. Jedenfalls hatte sie bald ihr ursprüngliches Vorhaben vergessen, noch dazu, wo sie von Frau Brauner in ein Gespräch verwickelt wurde.
Für den Moment einigermaßen enerviert, entging ihr daher, wie Amelie mit hochrotem Kopf aus dem Biedermeiersalon eilte und sogleich ein hastiges Gespräch mit Mimi Brauner und deren Verlobten, dem Linienschiffsleutnant begann.
Kurz darauf folgte aus der selben Richtung Graf Sergej Sergejewitsch, der sich betont zwanglos zu seinen Eltern begab, die eben feststellten, dass eine Petersburger Bekannte mit einem Cousin des schwedischen Banquiers verheiratet war.
Noch mehr entging Eugenie, dass Wotruba Junior ebenfalls aus der Biedermeierecke des Palais kam und ein ernstes, beinahe besorgtes Gesicht machte.
Hannes Wotruba, allgemein Junior genannt, überlegte, wieso die Komtess Amelie so mit wehenden Fahnen zu den anderen geeilt, ja geradezu geflohen war.
Sie war im Ägyptischen Kabinett gewesen, dem letzten Raum des Biedermeierappartements, schon in der Falknergasse gelegen, einem Zimmer, eigentlich aus der Zeit des Empire, das zwar während größerer Gesellschaften beleuchtet wurde, aber dessen Türen man geschlossen gehalten hatte, aus Angst, die Gäste könnten sich zu sehr verlieren. Es wurde bloß gerne der ausgefallenen Möblierung wegen gezeigt. Man hatte zwar während der Zeit von Kaiser Franz I. den ungeliebten, Napoleon bekriegt, dennoch hatte sich die Kaiserin Maria Ludovika damals, - der französischen Mode folgend -, ein Ägyptisches Kabinett eingerichtet und das der Arlingtons stellte eine verkleinerte Ausgabe jenes Raumes dar, der in der Hofburg längst wieder einem anderen Stil hatte weichen müssen und schon längst im Depot abgestellt worden war.
Jetzt, wo die ersten Gäste sogar schon aufbrachen, war es Hannes´ Aufgabe, unauffällig und unaufdringlich die in den Biedermeierzimmern verbliebenen Gäste, wieder in die Rokoko-Räume zu dirigieren. Die Dienerschaft räumte Gläser ab, ohne welche nachzureichen, schloss Vorhänge und löschte da und dort die ersten Lichter. Es funktionierte auf diese Art immer, dass die Gäste das Feld räumten und zu den anderen stießen, so dass sich der Große Salon wieder füllte, ehe sich die Gesellschaftsräume gänzlich leeren würden. Hannes wollte eben das Licht im Ägyptischen Kabinett löschen, als Komtess Amelie diesem enteilte, ohne die Tür hinter sich zu schließen. Als Hannes eintrat, fand er den jungen Russen vor, der ihn etwas verlegen anblickte.
„Es tut mit leid“, begann er im schönsten Französisch, „aber ich habe meinen Cognac verschüttet.“, und deutete auf den Tisch, auf dem zwei Schwenker standen, Arlington-Kristall natürlich, „Ich bin manchmal zu ungeschickt.“
Hannes betrachtet kritisch die Cognaclacke, die sich auf dem mit reichen Intarsien besetzten Kirschholztisch breit machte und meinte dann in seinem besten, seinem allerbesten Schulfranzösisch, das freilich ein starkes Wiener Timbre hatte, Monsieur le Comte möge doch bitte unbesorgt sein. Danach suchte er eines der Dienstmädchen.
Der Russe schien nicht recht zu wissen, was er tun sollte und Hannes half ihm, indem er darauf hinwies, im Großen Salon werde jetzt die Familienspezialität gereicht, der berühmte Portweinpunsch.
Er war sich nicht sicher, ob ihn der Russe verstanden hatte, weil er sich mit einem Male nicht mehr sicher war, was „Punsch“ auf französisch hieß, aber auch für den Fall, dass jener nur „Portwein“ oder „Großer Salon“ verstanden hatte, er empfahl sich jedenfalls dankend.
Etwas später dann fand Hannes die Komtess Amelie und den jungen Russen so weit entfernt voneinander im Großen Salon, wie es nur irgendwie möglich war, ja sie entwich sogar nach einiger Zeit mit Fräulein Brauner und Baroness Helene in einen kleinen Nebensalon, wo sich mit anderen Altersgenossinnen ein Damenkränzchen entwickelte.
Hannes, der wusste, dass die Gräfin Eugenie selbst überall ihre Augen hatte, aber eben beim besten Willen nicht überall zugleich sein konnte, entschied für sich, den jungen Russen nicht mehr aus den Augen zu lassen. Irgendetwas musste zwischen den beiden im Ägyptischen Kabinett vorgefallen sein, soviel war klar, mehr jedoch nicht. Er winkte Franz zu sich. Jener war als persönlicher Diener des Grafen Ludwig jeglichen gewöhnlichen Serviertätigkeiten abhold, bei größeren Gastlichkeiten jedoch immer unterstützend anwesend, nahm Wünsche entgegen, die er dann von den gewöhnlichen Dienern und Dienstmädchen ausführen ließ, wies dezent den Weg zu den gewissen Örtlichkeiten, rief Wotruba Senior oder den Portier, wenn dieser oder jener Wagen gewünscht wurde, oder man einen Fiaker brauchte, war Ludwigs Verbindung zur Küche, wie es Mademoiselle für Eugenie war.
„Behalt´ mir den jungen Russen im Auge.“, meinte Hannes schlicht und Franz bedurfte keiner weiteren Erklärung, fragte auch nicht nach, vermutete seinerseits lediglich, jener Gast habe wohl schon zuviel getrunken und Hannes sei in Sorge wegen des Portweinpunsches, der bei manchen Personen sehr anregend wirken konnte, bei anderen jedoch auch verheerende Wirkung zeigen mochte.
„Der Belgierin sollt´ noch wer an´ Kaffee bringen ... ,“ meinte er statt einer eigentlichen Antwort, „ ... und der Brauner würd´ sich, glaub´ ich, mittlerweile über ein kühles Bier mehr freu´n, als über an´ Punsch.“
Auf diese Art und Weise tauschten die beiden jungen Männern während der Gesellschaften ihrer Herrschaft allgemein ihre Informationen über die Gäste aus.
Der berühmte Portweinpunsch im Hause Arlington bestand aus etwa zwei Dritteln Port und einem Drittel Wasser, einer Mischung, die bis kurz vor dem Siedepunkt erhitzt wurde und dann - mit Zuckersirup, Zitronensaft, Muskat und Zimt angereichert – serviert wurde, einer der Höhepunkte der Arlingtonschen Gastlichkeit, wenigstens zwischen Oktober und März, denn zwischen April und September war es allgemein eine Bowle mit Früchten der Saison.
Der Punsch jedenfalls und vor allem dessen Wirkung, lenkte die gesammelte Aufmerksamkeit der Gäste von Gesprächen ab, die vielleicht eben am Erlahmen waren und führte nahtlos vom Höhepunkt der jeweiligen Gastlichkeit zu deren nahendem Ende. Er machte schlicht und ergreifend rasch betrunken und so sehr die Diener auch bei den Damen und bereits angeheiterten Gästen mit heißem Wasser aus silbernen Kannen verdünnen mochten, allgemein begann man sich nach dem Punsch langsam aber sicher zurückzuziehen, ein Effekt, der erwünscht war, weil es den Gastgebern dadurch leichter wurde, auch die redseligsten Zeitgenossen zu einer angemessenen Uhrzeit wieder loszuwerden, weshalb die genaue Rezeptur auch von Gräfin zu Gräfin, von Köchin zu Köchin flüsternd weitergegeben wurde und die Generationen solcherart überdauerte.
Hannes entspannte sich auch wieder, als er merkte, dass jenes Damenkränzchen um die Komtess Amelie sich ebenso wenig aufzulösen gedachte, wie ein Herrengespräch zwischen dem jungen Russen, dem Grafen Philipp, Fräulein Brauners Verlobten und anderen jungen Herren. Die ausländischen Herrschaften zogen sich peu á peu zurück und man begann immer mehr, en famille zu werden, sofern man die Familie Brauner dazu zählte, was man allgemein tat.
Graf Sergej Senior und Graf Ludwig bildeten ein Triumvirat mit Herrn Brauner, während Gräfin Eugenie sich im Gespräch mit Gräfin Maryna verlor. Frau Brauner, aus einfacheren Verhältnissen stammend und des Französischen nicht mächtig, - eine Tatsache, die Hannes eine gewisse Überlegenheit vermittelte -, beriet sich angesichts der bevorstehenden Hochzeit ihrer Tochter mit einer mit den Arlingtons weitläufig verschwägerten Generalwitwe, die eben die dritte von vier Töchtern verheiratet hatte - und war auch glänzender Laune.
Ja, dachte Hannes, die Gräfin versteht es, eine Gästeliste zusammenzustellen und die Mutter versteht es, alle zufrieden zu stellen. Hannes fühlte sich in seiner Rolle als sozusagen subalterner Gastgeber wohl. Manchmal dachte er daran, sich den Arlingtons zu entziehen und in die Gastronomie zu wechseln, etwas eigenes zu schaffen, vielleicht nicht unbedingt etwas in der Größenordnung des benachbarten Hotels „Zur Eisernen Krone“, aber vielleicht wenigstens ein Restaurant, eines aber, das auch Buffets lieferte, denn den Glanz eines Adelspalais wollte er wieder auch nicht missen. Jetzt aber wischte er alle persönlichen Gedanken beiseite und kümmerte sich um die weitere Verteilung des Punsches.
Amelie war entsetzt, schockiert und auf irritierende Weise angenehm berührt.
Küssen hatte er sie wollen, dieser unverschämte, anmaßende Russe und so gut sah er aus! Sie war verwirrt und düpiert gewesen, ob jener unverfrorenen Attacke des Grafen Sergej Sergejewitsch im Ägyptischen Kabinett und wiewohl sie eben erst vor zwei Monaten sechzehn geworden war und jener Abend erst ihre zweite oder dritte richtige Abendgesellschaft darstellte, hatte sie sich keine Blöße gegeben, hatte weder sich selbst desavouiert, noch den russischen Großgroßcousin oder was immer er genau war, kompromittiert.
Auch vom kleinen Nebensalon, wo sie mit der albernen Mimi Brauner und der noch mehr albernen Cousine Helene ein absolut albernes Gespräch begonnen hatte, konnte sie ihn beobachten, ihn den Russen, der im Großen Salon seine eigene Verlegenheit überbrückte, indem er wahrscheinlich ein ebenso albernes Gespräch mit Mimis Verlobten und Cousin Philipp führte.
Sie kam sich den beiden wesentlich älteren Mädchen mit einem Male unglaublich überlegen vor. Sie hatte mit ihren sechzehn Jahren einen siebenundzwanzigjährigen Mann interessiert, noch dazu einen Russen, der die halbe Welt gesehen hatte!
Gut, Mimi konnte als Tochter eines Prokuristen froh sein, einen Offizier als Bräutigam zu haben, der wenigstens ein klitzekleines „von“ im Namen hatte und von seinen Eltern eines Tages eine Handvoll Zinshäuser in Wien und ein paar Gemüsefelder im Marchfeld erben würde, aber Helene, die neben den Esterhazys und Batthyanys die größte Grundbesitzerin in Deutsch-Westungarn war und einen der größten Wälder in der Südsteiermark besaß, schien überhaupt niemanden für sich interessieren zu können.
Dabei besaß Helene, Freiin Belasi von Wrenkhfeldt, als Waise und Volljährige das alles wirklich, wurde es auch alles noch so sehr von Verwaltern betrieben und von Advokaten verwaltet. Amelie kam es dabei zunächst nicht in den Sinn, dass Helene vielleicht ihre Unabhängigkeit genießen könne und sich daher die Freiheit und die Zeit nahm, auf den richtigen Gefährten zu warten. Amelie war als Schwester zweier Brüder ihre Zukunft recht klar, Stephan würde das meiste erben, während Niklas irgendeines der Güter als persönliche Absicherung erhalten würde, des weiteren aber sein persönliches Fortkommen innerhalb der Armee, der Geistlichkeit oder des Corps Diplomatique suchen und wohl auch finden würde.
Sie selbst würde eines der böhmischen oder steirischen Güter, oder wenigstens dessen Einkünfte, als Mitgift erhalten, Schmuck ihrer Großmutter und einer Großtante, sowie ein Wiener Bankkonto, dass ihr jene unverheiratet verstorbene Tante bereits hinterlassen hatte, deren erklärter Liebling sie stets gewesen war. Wahrscheinlich würde alles eher auf eines der steirischen Güter ihres Vaters hinaus laufen, aber dazu würde sie von ihrer Mutter über das väterliche Einkommen hinaus sicher noch Einkünfte aus deren eigenem steirischen Gütern erhalten, die von deren Großmutter direkt auf sie gekommen war.
Pekuniär betrachtet, musste sich Amelie keine Sorgen machen, das wusste sie auch, sie konnte einen Steirer heiraten und am Land leben, oder einen Wiener und in der Stadt von den steirischen Einkünften, ja sie konnte sogar einen zweiten oder dritten mittellosen Sohn aus geeigneter Familie ehelichen, sie war ganz und gar das, was man eine gute Partie nannte. Wollte sie das aber auch?
Eröffneten ihr die Avancen jenes russischen Großgroßcousins nicht ganz andere Möglichkeiten? Hatte sie zu heftig reagiert? Nein, hatte sie nicht, entschied sie im Geiste. Sie kam sich sehr erwachsen vor und war entschlossen, diesen unverschämten Beau von russischem Großgroßcousin auch für den Rest dessen Aufenthalts in Wien formvollendet auf Distance zu halten.
Eugenie frühstückte allgemein allein und im Türkischen Zimmer, einem kleinen Durchgangszimmer das ihr Schlafzimmer bequem und unauffällig mit dem ihres Mannes verband, während auf der anderen Seite ihres Schlafzimmers ihr Bad und ihr Boudoir lagen. Wer auf sich hielt, in jenen Tagen in Wien, richtete sich mindestens ein Zimmer türkisch ein. Bei Eugenie hatte sich diese Mode jedoch auf einen sehr privaten Raum beschränkt, denn zur Repräsentation fand sie diesen Stil nicht eben geeignet. Sie brauchte morgens immer etwas länger, um ansprechbar zu werden, im Gegensatz zu Ludwig, der oft und gerne schon in aller Früh spazieren ging, am Land auch schon ausgeritten oder gar zur Jagd gewesen war, ehe Eugenie noch dem Morgenmantel, dem gleichfalls türkischen, entstiegen war.
Am Sonntag freilich frühstückte die Familie samt Herrn Vorhofer und Mademoiselle, um dann gemeinsam, die Wotrubas und das meiste sonstige Personal im Schlepptau, den Platz zur Kirche zu überqueren.
Anschließend, nachdem man Gottes Ehre Genüge getan hatte, ging man zum Mittagessen in eine der Gastwirtschaften in der Umgebung, in der Herzoghofgasse, der Falknergasse oder der Blutgasse, nur mehr begleitet von den Wotrubas und Louise. An und für sich hatte das Personal am Sonntag nämlich frei, aber natürlich war dafür gesorgt, dass jemand das Frühstück bereitete und servierte, dass nachmittäglichem Besuch das Tor geöffnet wurde und dass es ein kaltes Nachtmahl gab. Die Küche jedenfalls blieb aus alter Tradition geschlossen und man empfing bestenfalls wen zur Jause und blieb ansonsten Sonntags tunlichst unter sich.
Diesen Sonntag jedoch war entschieden worden, die russischen Arlingtons zum gemeinsamen Gottesdienstbesuch einzuladen und man hatte den Junior bereits mit dem Wagen ins Hotel „Métropole“ geschickt. Auch würde man diesmal ins neue und so moderne Hotel „Zur Eisernen Krone“ zum Mittagessen einkehren, während man sich sonst eben mit simplem Schnitzel, Schweinsbraten oder Backhendl in einem Gasthaus begnügte.
Eugenie hatte sich vorerst nur einen Kaffee bringen lassen und wollte eben ihrer Zofe klingeln. Sie musste heute sehr sorgfältig überlegen, was sie anziehen sollte, einerseits wollte sie ja etwas darstellen, andrerseits die Gräfin Maryna auch nicht in den Schatten stellen, die ihrer gestrigen Toilette nach zu schließen, nicht eben die außergewöhnlichsten Abendkleider und nicht unbedingt den größten Schmuck für die Reise nach Wien eingepackt hatte.
Eugenie hielt die Berichte über die übertriebene Garderobe der Russinnen seit gestern Abend schlicht für übertrieben. Es klopfte an der Tür, aber weder Mitzi, die Zofe, noch Louise traten ein, wie Eugenie vielleicht erwartet hatte, sondern Ludwig, was sie ein wenig überraschte. Natürlich war er schon völlig korrekt gekleidet, duftete nach Lavendel und seiner Morgenzigarre. Auch er trank Sonntags vor dem eigentlichen Frühstück einen Kaffee für sich alleine, allerdings begleitet von einer Zigarre. Nachdem er seine Frau mit einem Handkuss und einem Kuss auf die Wange begrüßt hatte und sie einige Sätze über das gelungene Dîner gewechselt hatten, äußerte er seinen unverhohlenen Stolz über das Benehmen Amelies, die in puncto Abendgesellschaften ja noch nicht sehr versiert war. Eugenie wurde hellhörig, denn es war Ludwigs Eigenheit, Kritik oder Bedenken mit einem Lob einzuleiten.
„Wenn sie aber den Russen nicht mag, soll sie uns das ruhig sagen.“, meinte er auch bald unvermittelt.
„Den jungen Sergej? Du meinst, da is was im Busch?“
„Seinerseits sicher, ihrerseits weiß ich net so recht. Er schaut gut aus, er is´ standesgemäß und als einziger Sohn auch der Erbe. Aber irgendwas g´fallt mir net an ihm. Außerdem find´ ich die Amelie noch zu jung für was Ernstes. Sie soll erst noch die Schul´ fertig machen und die nächste Saison auf die Bälle gehen und vielleicht geh´n wir auch nächstes Jahr mehr auf Reisen. Ich mein´, sie sollt´ sich ruhig noch zwei Jahre Zeit lassen. Was meinst du?“, Ludwig hielt kurz inne und meinte noch, außerdem sei ihm Sergej zu alt für Amelie, sechs oder sieben Jahre Altersunterschied wären besser, elf fände er zuviel, außerdem solle sie sich nicht blenden lassen.
Eugenie war angesichts Ludwigs sonstiger Gleichgültigkeit gegenüber den Befindlichkeiten seiner Mitmenschen überrascht. Er schien sonst immer alles als unabänderlich hinzunehmen. Ihm war es jedenfalls nicht der Rede wert, wenn eine ihnen bekannte Baronin mit dem Hauslehrer ihrer Kinder durchbrannte, ein gräflicher Freund von der eigenen Schwiegermutter beim Verlassen eines stadtbekannten Etablissements beobachtet wurde, oder die junge Tochter entfernter Verwandter plötzlich eine mehrmonatige Reise nach Irland antrat, was innerhalb der Wiener Gesellschaft gleichbedeutend damit war, dass ein unerwünschtes und vermutlich unstandesgemäßes Kind in einem irischen Kloster deponiert wurde, unter reichen Gaben der mütterlichen Familie das Schweigen armer, aber frommer irischer Patres oder Nonnen erkauft worden war.
Kehrten jene Mädchen von ihrem so eigenartigem Aufenthalt zurück, wurden sie auch rasch an kleine oder neue Adlige verheiratet, selbst da noch an zweite oder dritte Söhne, vermutlich aber begleitet von reicher Mitgift.
All jene Vorgänge interessierten Ludwig nicht, während sie, Eugenie, ja stets ihre Gästelisten neu überarbeiten musste.
„Und wenn sie seine Avancen erwidern tät´?“, fragte sie ihren Mann, „Wär´ Russland, wär´ St. Petersburg, per se ein Problem für dich?“
„Keineswegs. Nein, absolut nicht. Ich hab´ nur meine Bedenken, weil ich ihn zu alt find´. Zu alt, zu weltklug, zu gutaussehend. Verzeih´ mir meine Offenheit, aber ich halt´ den jungen Sergej genau für den Mann von Welt, der in die Etablissements geht, oder sich eine Balletteuse als dauernde Geliebte zulegt.“
Eugenie wurde bei diesen Worten ihres Mannes ein wenig rot, schließlich geschah dergleichen nur in den Familien der anderen und niemals in der eigenen.
Tatsächlich hatte sie sich manchmal auch über Ludwigs Treue gewundert, denn sie hatte den ehelichen Freuden nie besonders viel abgewinnen können, wäre also nicht verwundert gewesen, hätte ihr Mann ein etwaiges Manko seinerseits andernorts ausgeglichen. Andrerseits hatten sie diesbezüglich sowohl Ludwigs sonst so allgemeines Desinteresse und sein Stil im allgemeinen stets beruhigt. In eines jener Etablissements zu gehen, war entschieden unter seiner Würde und sich eine Geliebte zuzulegen, war ihm schlicht zu anstrengend. Er schätzte seine Ruhe und seine fast eigenbrötlerischen Gewohnheiten zu sehr.
Jetzt meinte sie jedenfalls, sie würde mit Amelie sprechen und schickte ihn weg, da sie es für angebracht hielt, dies noch vor dem Gottesdienst zu tun. Sie klingelte nach Mitzi und schickte nach Louise, zog im Endeffekt ihr neuestes Kleid an, was in Momenten zeitlicher Verlegenheit stets die beste Lösung war, ließ sich ihr Haar gleich um den Hut herum arrangieren, was man ja nach dem Mittagessen wieder ändern konnte und bat Amelie ins Türkische Zimmer.
Diese warf einen überraschten Blick auf den bereits aufgesetzten Hut, der auch in den Augen einer Sechzehnjährigen ein eindeutiges Indiz für eine hastige Morgentoilette war, abgesehen davon, dass ihre Mutter sie in Absence von Mitzi und Louise in ihr Morgenzimmer gebeten hatte.
Amelie war entschieden alarmiert und von Anfang an entschlossen, jedwede Vorgänge im Ägyptischen Kabinett strikt abzuleugnen.
Für einen kurzen Moment befürchtete sie, Sergej Sergejewitsch habe vielleicht etwas übereilt gleich um ihre Hand angehalten, hielt das zugleich für übertrieben, denn so in Verlegenheit hatte er sie ja wieder auch nicht gebracht und war im nächsten Moment enttäuscht, da sie aus den ersten Sätzen ihrer Mutter nichts derartiges entnehmen konnte, ja offenbar war es so, dass niemandem etwas aufgefallen war.
Eugenie gratulierte Amelie – auch im Namen des Papa – für ihr Benehmen während des gestrigen Dîners, um dann quasi en passant zu bemerken, sie, Amelie, käme jetzt in ein Alter, wo die jungen Herren sich dank ihres Namens und ihres Aussehens für sie zu interessieren begännen, sie, Eugenie, sei eine moderne Frau und Amelie möge sie doch über etwaige Aspiranten oder gar Avancen einzelner Herren ruhig ins Vertrauen ziehen.
„Der Papa und ich haben nicht vor, dich an den Erstbesten zu verheiraten, bloß weil er in Frage kommt. Dass heißt, wenn du uns wen vorstellen willst, der in deinen Augen vielleicht nicht unbedingt in Frage kommt, dann tu´ es trotzdem. Vor allem aber, wenn dir einer der jungen Herrn vielleicht zu nahe tritt, oder du ein gewisses Avancement nicht erwidern kannst, dann erzähl´ uns erst recht davon.“, so begann Eugenie, denn sie beschloss, ihre Tochter wenigstens in diesem Punkt von heute an wie eine Erwachsene zu behandeln.
„Kind, du schaust gut aus und vor allem wirst du in ein oder zwei Jahren gut aussehen, du hast einen guten alten Namen und du wirst nicht mittellos ins Leben gehen, das weißt du. Verhalt´ dich deiner Herkunft entsprechend, aber verlass´ dich net drauf. Es liegt auch an dir, was du draus machst. Schau dir nur die Helene an, alles Geld der Welt, blendendes Aussehen, aber entre nous gesagt, stinkfad und kein Mann in Sicht.“, Eugenie seufzte.
„Was, aber, Maman“ begann Amelie, mit neugewonnener, achso erwachsener Kühnheit, „was aber, wenn die Helene gar keinen Mann will? Wie Sie ganz richtig sagen, Maman, hat sie alles Geld der Welt, sie muss sich nicht versorgen. Vielleicht will sie warten?“
„Wie lang´ denn noch?“, Eugenie stöhnte jetzt beinahe, „Bis alle in Frage kommenden Männer ihres Alters sich anderweitig engagiert haben? Kind, ich will nicht, dass du was überstürzt, aber gestern hab´ ich die Helene ganz absichtlich zwischen Philipp und Sergej Sergejewitsch platziert, aber hat sie einen von den beiden für sich interessieren können? Nein, net wirklich.“
Eugenie unterdrückte im Geiste dabei das Malmot einer welterfahrenen Tante, Philipp würden seine konkreten Regimentskameraden vielleicht näher am Herzen liegen, als alle eventuellen Komtessen und Baronessen, denn sie wollte nicht abschweifen. Der Name des jungen Russen war nun einmal gefallen, also meinte die Gräfin leichthin: „Was halts´t du denn von ihm?“
„Von Philipp?“, Amelie bereitete es plötzlich eine diebische Lust, sich dümmer zu stellen.
„Nein, von Sergej Sergejewitsch, ma petite. Ich würde dich eher nach St. Petersburg verheiraten, als mit dem Philipp!“, womit sie irgendwie zwar ihre Cousine desavouierte.
Daraufhin meinte Amelie nur gleichgültig, sie fände den Russen zwar „de façon amusante“, aber nicht weiter aufsehenerregend.
Man begab sich gemeinsam zum Familienfrühstück. Die Buben schlossen aus Eugenies Hut am Frühstückstisch gar nichts, Herr Vorhofer nahm an, sie habe verschlafen. Stephan machte ohnehin eben eine ausgesprochen aufsässige Phase durch, die sich bei ihm hauptsächlich in einem gewissen Antiklerikalismus bemerkbar machte. An keinem der Patres im Schottengymnasium ließ er ein gutes Haar und den sonntäglichen Gottesdienst hätte er am liebsten verweigert, band sich die Krawatte schlampig um und lümmelte unlustig am Frühstückstisch. Er war neuerdings ständig irgendwie beleidigt und kam damit erstmals seinem jüngeren Bruder Niklas nahe, der schon beleidigt zur Welt gekommen war und entschlossen schien, sie in der selben Stimmung zu verlassen.
Niklas war völlig desinteressiert an der Welt, die er sich nur mittels Heldensagen und den Berichten von Entdeckern und Abenteurern in sein Zimmer holte. Im Übrigen schien er schwer von Begriff, hörte vielleicht auch bloß schlecht, oder nur das, was er hören wollte, niemand wusste es so genau. Eugenie seufzte manchmal bei dem Gedanken, vielleicht eine Prinzessin, einen Rabauken und ein Tschopperl großzuziehen, wie man in Wien liebevoll etwas zurück gebliebene Kinder nannte.
Abgesehen von jenem Gottesdienst und anschließendem Mittagessen im so schönen und neuen Hotel „Zur Eisernen Krone“, begegnete man den russischen Arlingtons in der nächsten Zeit häufig. Die Russen hatten entschieden, ihren Wien-Aufenthalt zu verlängern und gewissen Gesprächen zwischen den Grafen Ludwig und Sergej, sowie Herrn Brauner konnte man entnehmen, dass man am besten Wege war, sich über eine St. Petersburger Vertretung von Arlington-Glas handelseinig zu werden.
Amelie blieb dabei bei allen Gelegenheiten gegenüber Sergej Sergejewitsch formvollendet damenhaft freundlich und zurückhaltend.
Dann aber ergab es sich eines Nachmittags, dass der junge Russe allein ins Palais kam und Amelie die einzige aus der Familie zu Hause war. Nach einer etwas spröden Konversation über gewisse Missverständnisse und Fehlinformationen jenes Tages, - denn Sergej Sergejewitsch hatte seine Eltern im Palais vermutet und Amelie ihre Eltern irgendwo in Gesellschaft der seinen -, ging man in medias res.
Es geschah irgendwie, irgendwann, auf jeden Fall im Biedermeiersalon, auf dem Kanapee, eben erst von Backhausen neu mit blauer Moiréseide bezogen.
Amelie hatte danach nicht einmal die Ausrede parat, er wäre über sie hergefallen, denn sie war genauso über ihn hergefallen.
Beide waren überrascht und noch überraschter von der Wiederholung des Geschehenen und der nächsten Wiederholung.
Irgendwann später machte sich Personal in den Nebenräumen bemerkbar und sie bedeckten sich rasch, beseitigten schleunigst alle Spuren des Vorgefallenen, so gut es in der Eile ging. Dass man in Häusern wie diesem aber auch nie für sich sein konnte!
Nachdem man sich einigermaßen gesammelt hatte, versicherte ihr Sergej Sergejewitsch in seinem schönen Französisch, - viel reiner als das ihre, wie Amelie bemerken musste -, „alle jetzt notwendigen Schritte“ einzuleiten.
„Einen Schmarrn werden Sie tun!“, entfuhr es Amelie auf gut Wienerisch und dann musste sie das auch noch ins gewählte Französisch transponieren. Jedenfalls versicherte sie ihm zum Abschied, er müsse, nein, er dürfe nichts überstürzen, er müsse, nein er dürfe nichts übereilen, es sei zwar etwas geschehen, doch in ihren Augen verpflichte ihn das zu nichts, er möge, bitte sehr, denn doch abwarten.
Graf Sergej Sergejewitsch ging also, wenn auch etwas verblüfft, mit einem kurzen und etwas besorgtem Gruß und entschwand verwirrt in Richtung Hotel „Métropole“.
Amelie, nachdem sie schon etwas ungehöriges, ja ungeheuerliches getan, setzte dem Geschehenen noch etwas drauf , schenkte sich einen Cognac ein und dachte nach.
Sie empfand sich mit den Ereignissen zu Recht allein. Mit wem konnte sie sich jetzt noch austauschen? Nicht mit ihrer Mutter, nicht mit Louise, nicht mit ihren unbedarften Schulfreundinnen. Sie war eine Frau geworden uns sie machte sich – vorerst wenigstens - nicht das geringste daraus.
Nach dem einen Cognac entschied sie, - plötzlich ganz wagemutig -, ihr Leben anders zu gestalten, als ihr vorherbestimmt zu sein schien. Sicherheitshalber bediente sie sich dazu eines weiteren Cognacs. So Gott nicht will, so dachte sie, dass ich nach diesem einem Mal, na gut nach diesem ersten Mal inklusive Wiederholungen, gleich in die Hoffnung komm´, - was ich nicht wünsche - , werd´ ich gar nicht heiraten, weder jenen Sergej Sergejewitsch, noch sonst wen.
Und nach dem dritten Cognac, beschloss sie, nie Kinder zu kriegen. Sie würde sich zwar bald den Kopf kalt waschen müssen, um ihren Eltern zum Abendessen gegenüber treten zu können, aber ansonsten stand ihr Entschluss fest. Sie hatte einen Weg zur Unabhängigkeit entdeckt und den würde sie sich nicht mehr so bald nehmen lassen.
Wenn sie an Sergej Sergejewitsch dachte, so musste sie lachen. Heiraten will er mich, bloß weil er mir dir Unschuld geraubt hat! Was sich die Männer nicht alles so einbilden auf dieses erste Mal!
Amelie war irgendwie immer anders gewesen, als ihre Altersgenossinnen. Während jene Liebesromane verschlangen, las sie Biographien. Sie hatte sich von klein auf für Geschichte interessiert, hatte schon früh begonnen, all jene Prinzen und Prinzessinnen, Helden, Ritter und Königinnen der Märchen und Sagen mit real existent gewesenen Personen der Geschichte zu verknüpfen. Immer mehr hatten sie dabei die Frauen interessiert, wie Maria Theresia, die Gönnerin ihrer Familie, die glanzvollen und unheimlichen Regentinnen Frankreichs, die unglücklichen und skandalumwitterten Zarinnen Russlands, Englands Königinnen, römische und byzantinische Kaiserinnern, wie Galla Placidia, Justinians Theodora oder die Historikerin Anna Komnena, Mätressen wie Diane de Poitiers, die Pompadour oder die Königsmarck, selbstbewusste, eigenständige Frauen, die nicht unbedingt dem landläufigen Bild ihrer Zeit entsprachen.
Ihr allgemeines historisches Interesse war bekannt, ihr ureigenes Faible an großen und originellen Frauenfiguren hatte Amelie jedoch stets für sich behalten können.
Sie hatte im Geiste schon früh beschl0ssen, ein anderes Leben zu führen, als ihr vorbestimmt zu sein schien. Sie hatte dies bloß noch nicht in konkrete Worte, ja nicht einmal Gedanken, fassen können.
Jetzt war aber etwas zwischen ihr und ihrem russischen Großgroßcousin geschehen, was sich zum einem sowieso nicht mehr rückgängig machen ließ, zum anderen für sie selbst keinen so arg großen Einschnitt bedeutete, jedenfalls noch nicht.
Zugleich war ihr aber schlagartig klar geworden, dass sie von heute an, den Kreis ihrer Eheaspiranten würde einschränken müssen.
Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, so dachte sie. Zunächst kann ich den Russen einfach heiraten. Er hat mir seine diesbezügliche Verantwortlichkeit schließlich schon in Aussicht gestellt. Will ich das? Nein! Ich mag den Mann doch eigentlich nicht.
Na, schön, für das erste Mal, dieses achso überschätzte erste Mal, abgesehen von jenen Wiederholungen, mochte er seine Bedeutung gehabt haben, aber irgendwie lehnte Amelie jede darüber hinausgehende Verantwortlichkeit des Sergej Sergejewitsch ab.
Punkt Zwei, so dachte Amelie weiter – und ertappte sich dabei beim nächsten Cognac -, wenn ich wirklich ein Kind bekommen sollte, nach diesem ersten, wenn auch leider nicht einzigem Mal, muss ich auch nicht unbedingt den Russen heiraten.
Ich werd´ eines Tages pekuniär nicht so schlecht gestellt, ja sogar einigermaßen unabhängig sein und ein Kind von mir kann auch in der Steiermark groß werden. Amelie dachte dabei an so rätselhafte Verwandte wie jenen Großonkel Moritz väterlicherseits und an die ebenso mysteriöse Großcousine Margot mütterlicherseits, alles Leute, die irgendwie innerhalb der Familienpapiere und auf diversen Besitzungen ebenso wohlgelitten, wie unerklärt umher vagabundierten.
Natürlich wäre ihr „Fehltritt“ in diesem Fall nicht vor dem Papa zu verheimlichen.
Jedenfalls gedachte Amelie nicht, ihr eventuelles Kind vielleicht in Irland oder auf Malta zu belassen, wie es damals geradezu Mode geworden war.
Punkt Drei war, „Fehltritt ohne konkrete Folgen“, - brauch´ ich jetzt wirklich noch einen Cognac? Nein, Amelie, halt´ dich zurück! Wenn ich also kein Kind von Sergej Sergejewitsch bekomme, was bleibt dann? Ich muss die Mama irgendwann und irgendwie einweihen, müsste dies aber nicht heute oder morgen und könnte „es“ vor dem Papa noch lange Zeit verheimlichen. Nur, die Mama müsste ihre Intentionen einfach auf die zweiten oder dritten Söhne erweitern, oder auch auf Familien, an die man noch gar nicht gedacht hatte. Papa würde das nicht einmal bemerken. Auf seine heitere, gelassene und desinteressierte Art und Weise, würde er vermutlich jeden drittklassigen Linienschiffsleutnant a´la Mimi Brauners Verlobten als Amelies Gefährten und künftigen Ehemann zur Kenntnis nehmen. Er hielt sich ja für so was von offen und modern!
Punkt Vier, was, wenn ich gar nicht heiraten will? Nie? Der Papa würd´ es kaum bemerken, eher übersehen, die Mama schon eher und früher hinterfragen, sie war entschieden wachsamer.
Punkt Fünf war freilich, dass Amelie nur sehr verschwommene Ideen vom Kinderkriegen hatte und dazu keine Idee, an wen sie sich vielleicht wenden sollte.
Sie konnte für den Moment einfach nur abwarten und das Beste hoffen.
Amelie wurde schlecht und sie fragte sich, wie sie ihren Eltern beim Abendessen gegenüber sitzen sollte können, respektive all jenen Russen überhaupt noch einmal begegnen sollte. Gott im Himmel, war das Leben aber auch anstrengend! Ob es wohl etwas nützte, demnächst eine Kerze in St. Nicola anzuzünden?
Sie entschied, dass es an der Zeit sei, Sergej Sergejewitsch zu schreiben.
Und sie entschied zugleich, sich nicht an Cognac gewöhnen zu wollen.
Da sie nicht genau wusste, was sie dem Russen schreiben sollte, beschloss sie, zunächst in der Bibliothek Nachschau zu halten, wie denn das so war mit dem Kinderkriegen, vor allem woran man bemerkte, ob es soweit war, denn wie es geschah, war ihr heute klar geworden, wenn auch ohne mütterliche Vorbereitung. Zunächst aber zog sie sich um.
In der Bibliothek angelangt, stellte sie dann aber fest, dass sich ihr Vater in seinem Arbeitszimmer befand. Er musste wohl in der Zwischenzeit nach Hause gekommen sein.
Amelie hörte die ruhige Stimme der Frau Wotruba: „Nein, Herr Graf, ich weiß sicher, dass es niemand vom Haus is´. Aber wollen Herr Graf nicht erst die Rosi anhören? Vielleicht kann ja der Herr Doktor noch was machen, dagegen, mein ich.“
„Die Rosi soll reinkommen.“
Amelie, mutig durch all den Cognac, schlich auf Zehenspitzen zu der einen Spaltbreit offenen Türe und dankte Gott dafür, dass ihre Mutter auch jener Mode verfallen war, die hundertjährigen und knarrenden Parkettböden mit dicken Orientteppichen zu bedecken. Von der Tür aus konnte Amelie ein junges, blasses und verweintes Hausmädchen sehen, das nach Aufforderung des Grafen Platz vor seinem Schreibtisch nahm. Amelie konnte von links ihren Vater hören, von rechts die Wotruba, sehen konnte sie nur jene verweinte Rosi, von der sie nicht glaubte, ihr jemals schon begegnet zu sein. Musste wohl ein Küchenmädchen sein, das niemals einen anderen Weg nahm, als den aus dem Souterrain über die Dienerstiege in ihre Dachkammer. Ihrem Vater schien sie auch nicht wirklich geläufig.
„Sie ist also die Rosi.“, meinte er nämlich zur Begrüßung.
Rosi nickte nur und wollte gleich wieder losweinen.
„Nur die Ruhe, nur die Ruhe,“ beruhigte sie der Graf, der Gefühlsausbrüche sowieso nicht gerne leiden konnte, schon gar nicht bei Domestiken, „nur, weil sie in der Hoffnung ist, geht ja nicht die Welt gleich unter. Wir Arlingtons haben immer ein gut katholisches Haus geführt, aber wir sind ja nicht katholischer als der Papst.“
Rosi blickte den Grafen verständnislos an, der begann also seufzend von vorne.
„Sie ist also in der Hoffnung?“
„Ja, Herr Graf.“
„Ist es wer vom Haus?“
„Nein, Herr Graf.“, Rosi schien sich etwas zu fangen.
„Und wie weit ist es schon?“, fragte der Graf und da Rosi die Frage offenbar wieder nicht verstand, schaltete sich wieder die Wotruba ein, mit gestelztem, dem schwerwiegenden Anlass gemäßen Hochdeutsch: „Das monatliche Unwohlsein ist vermutlich bereits zum zweiten Male ausgefallen, Herr Graf.“, und dann, in ganz anderem Ton, „Genauer weiß sie´s net, die Menscher schau´n halt net drauf, was soll man machen, Herr Graf?“
„Kann sie ihn heiraten?“, fragte der Graf und da die Hälfte der Fragen von der Wotruba beantwortet wurde, da Rosi gleich wieder in unkontrolliertes Schluchzen ausbrach, klang es nicht so, als würde der Graf sie in der dritten Person ansprechen, es klang tatsächlich so, als würden Graf Ludwig und die Wotruba sich über eine dritte, nicht im Raum befindliche Person, unterhalten.
„Nein, kann sie net,“ sagte die Wotruba jetzt lakonisch, „ weil er schon verheiratet is´. Ein Hallodri is er, ein Strizzi, Kellner in an´ Wirtshaus im Prater.“
Es war eindeutig, die Wotruba war einigermaßen verzweifelt. Sie war streng zu allen Dienstboten, aber zu den weiblichen, vor allem den jungen, immer eine Spur gütiger und weicher als zu den Kutschern und Hausburschen. Alle ihre „Menscher“ waren ihr auch wie Töchter, die sie nie gehabt hatte, die Burschen höchstens wie ungeliebte Stiefneffen.
„Würd´ sie´s wegmachen lassen? Das könnt´ man schon arrangieren. Keine Angst, ich zahl´s.“, fragte der Graf jetzt.
„Aber, des wär jo a Sünd.“, plötzlich verstand Rosi sehr genau, dass sie angesprochen wurde.
Amelie meinte, ihren Vater, förmlich lächeln zu spüren, während die Wotruba irgendetwas von wegen, als ob des bisher ka Sünd g´wesen wär, monierte.
„Gut,“ sagte Graf Ludwig, „ich wollt´ sie keineswegs schockieren. Gut, dann gibt´s aber nur eine Möglichkeit – die Steiermark.
Rosi, ich will sie nicht ´rausschmeißen, aber ich will sie auch nicht mehr hier im Haus haben. Ich will hier keine Gschrappen haben, von denen irgendwann keiner mehr weiß, wo sie hing´hören. In der Steiermark kann sie ihr Kind kriegen und eine Stellung behalten. Aber das eine sag´ ich ihr: selbst am Land is´s beim nächsten Gspusi vorbei. Such´ sie sich am Land an anständigen Burschen, der sie auch heiratet. Wegen dem Kind mach´ sie sich keine Sorgen, die Burschen am Land sind net so, es wird sie auch einer samt dem Gschrappen nehmen. Aber ein zweites Kind ohne Ehemann dulde ich nicht! Hat sie das verstanden?“
Unter zig gestammelten „Herr Graf“ bestätigte Rosi alles und bedankte sich unerträglich viele, viele Male, bis die Wotruba ihr endlich Herr wurde und sie bei der Tür hinaus schob.
„Auch ich möcht´ mich bedanken, Herr Graf.“, begann sie, „Herr Graf wissen, wie ich aufpass´, was die Menscher tun, aber an den freien Abenden ... Es is a Unglück mit den freien Abenden. Nur, weil sie hierher nie wen mitbringen können, heißt des ja no lang net ...“, sie unterbrach sich, weil sie merkte, dass dem Grafen ihre Ausführungen zu lange dauerten.
„Schon gut, Wotruba, schon gut. Sie führt mir den Haushalt exzellent und das merkt man auch daran, dass wir so was wie das hier nur alle heiligen Zeiten haben. Wie lang eigentlich schon nicht mehr?“
Jahre, meinte die Wotruba, Jahre und ein schwangeres „Mensch“ noch viel länger nicht, das letzte Mal habe einer der Hausburschen einer Wirtstochter ein Kind gemacht. Wenn sich Herr Graf erinnerten, so habe Herr von Valenta damals den Vater des Mädls leicht dazu überreden können, einer Ehe zuzustimmen und jener Hausbursch sei jetzt Oberkellner im schwiegerväterlichen Betrieb.
Amelie blickte ein wenig ins Leere, während dieses Gesprächs, sah nur den mittlerweile verlassenen Sessel vor dem Schreibtisch und fühlte sich wie die intrigante Duchesse de Chevreuse, am Hofe Marie de Medicis, die von einem Fehltritt König Louis XIII Wind bekommen hatte.
„Wotruba, sie ist mit mir für alle Mitglieder dieses Haushalts verantwortlich. Ich wünsche keine Skandale. Kein Mitglied des Hauses Arlington landet wegen eines unehelichen Kindes auf der Straße. Dazu haben wir schließlich die Häuser am Land. Sie erkundigt sich, am besten gleich heut´ oder morgen, beim Herrn von Valenta, wo wir die Rosi am besten unterbringen. Er soll sich überlegen, wo sich auch ein paar ledige Burschen finden, von denen sie vielleicht einer nimmt. Die tendiert mir dazu, sonst ein leichtfertiges Ding zu werden. Ich will schließlich net, dass sie in der Steiermark als Wirtshausflitscherl endet. Die Hebamme wird bezahlt, ein Doktor wird bezahlt, das Kind kommt in die Schule und wird auch in den Dienst genommen. Und wie bei allen anderen Kindern, die in meinen Diensten auf die Welt kommen, kriegt es auch ein Postsparkassenbuch, das es in die Hand kriegt, wenn es einundzwanzig ist. Valenta weiß schon, was ich da sonst so zahl. Und noch eins: die Rosi geht mir auch noch hier in Wien zum Doktor.
Zum Neuländer freilich, nicht zum Mittermayer, wo die Gräfin hingeht, der Neuländer schuldet mir noch was und macht´s auch weg, so es sich die Rosi doch noch anders überlegt. Wotruba, sie haftet mir dafür, ich will noch Ende der Woche die Arztrechnung sehen, verstanden?“
„Sehr wohl, Herr Graf und nochmals danke, Herr Graf.“, die Wotruba wollte schon ab, da hielt Graf Ludwig sie noch einmal zurück.
„Aber auch wenn sie´s wegmachen lasst, will ich sie hier nicht mehr sehen.“
Er repetierte kurz noch einmal die Möglichkeiten für die unglückselige Rosi: Kind, Stellung und Sparbuch für das Kind in der Steiermark, Kind wegmachen und Stellung in der Steiermark, oder Kind wegmachen, zwei Monatslöhne, wohlmeinendes Zeugnis und Schluss.
Das nahm Amelie aber nur mehr undeutlich wahr, denn sie eilte bereits auf Zehenspitzen aus der Bibliothek. Sie würde ein anderes Mal noch wegen dem Kinderkriegen nachschlagen, was ihren Vater betraf, hatte sie genug gehört.
Wir werden ja sehen, ob er auch so modern und so gelassen reagiert, wenn es um mich geht, dachte sie. Sie wusste, dass andere Herren, oder vor allem die allgemein strengeren Damen, ihre Dienstmädchen bei derlei Gelegenheiten ohne viel Federlesens an die Luft setzten und bewunderte ihren Vater ein wenig, war sich jedoch zugleich im Klaren, dass er bei ihr wohl nicht von vornherein so kühl agieren würde.
Interessant fand sie auch die Wahl des Arztes. Obermedizinalrat Mittermayer, Ritter von Friedenthal, der Hausarzt ihrer Mutter, Universitätsprofessor und sehr en vogue bei den besseren Damen, kam offenbar nicht in Frage für die arme Rosi.
Dr. Casari, Arzt ihres Vaters, Amelies eigener Arzt und der ihrer Brüder scheinbar auch nicht. Nein bestenfalls der Dr. Neuländer, ein noch recht junger Jude, zu dem die Wotrubas und das restliche Personal gingen, respektive, der im Fall der Fälle ins Haus geholt wurde. Und – so erinnerte sich Amelie – jener Dr. Neuländer schuldete ihrem Vater also etwas? Sehr interessant. Ich müsste also nur etwas Geld lukrieren und könnte auf die Verschwiegenheit von Dr. Neuländer bauen.
Während sie sich zum Abendessen umzog, - die Wirkung des Cognac hatte sich gefahrlos verfestigt und zeichnete sich nur mehr mittels großer Gelassenheit aus -, fielen Amelie freilich diverse weitere Schwierigkeiten ein.
Zwar waren die Gedanken, von wegen ein Kind in der Steiermark großzuziehen, offenbar nicht gar so abwegig, auch musste sie im allerschlimmsten aller Fälle nur bis zu ihrem einundzwanzigsten Geburtstag durchhalten, bis das ihr hinterlassene Konto der lieben, guten Tante Melly für sie greifbar wurde, jetzt im Moment hatte sie aber nicht einmal die Möglichkeit, eine etwaige Rechnung dieses Dr. Neuländer zu bezahlen. Höchstens mit einem Schmuckstück, mit irgendwas, das mir zwar gehört, was ich aber ohnehin nie trage. Auf Anfrage hab ich es halt verloren.
Amelie bewunderte sich selbst ob ihrer kühnen Ideen und war froh, soviel über längst vergangene Hofintrigen gelesen zu haben. Wenn die La Motte den Kardinal Rohan hinters Licht geführt hat, dachte sie, wird es mir doch wohl noch gelingen, diesen Juden, Dr. Neuländer zu bezahlen!
Es ist ja schon einigermaßen grotesk, dass ich eigentlich zwar Geld hab' und doch wieder nicht, dachte sie kopfschüttelnd.
Innerhalb der nächsten Tage, so schwor sie sich, musste sie sich dennoch in der Bibliothek nach einschlägiger Literatur umsehen. Und gleich heute nach dem Abendessen werde ich meinen Schmuck durchsehen. Natürlich wusste sie weder, wie hoch eine Arztrechnung ausfallen konnte, noch wie viel ihre wenigen Schmuckstücke wert waren. Auch ging sie seufzend davon aus, jener Dr. Neuländer würde sicher ihre Situation ausnützen und sie übervorteilen, aber was sollte sie machen?
Was geschehen war, war nun einmal geschehen.
Dies brachte sie zu Sergej Sergejewitsch. Im Wien des Jahres 1873 war es für eine eigentlich wohlbehütete Tochter aus gutem Haus, aus sehr gutem sogar, durchaus leichter, die Unschuld zu verlieren, oder mittels des einen oder anderen Schmuckstücks die Diskretion eines jungen aufstrebenden Arztes zu erkaufen, als es möglich war, den Mitschuldigen überhaupt allein wieder zu sehen.
Bevor ich mir überlege, was ich ihm schreibe, muss ich mir überlegen, wie ich ihm überhaupt ein Billet zukommen lasse, so überlegte Amelie. Vom Haus kann ich niemand schicken, egal was ich ihnen einschärfe, die sind imstand und geben meinen Brief dem Vater und nicht dem Sohn. Kein österreichischer Domestik begreift den Unterschied zwischen Sergej Alexandrowitsch und Sergej Sergejewitsch und den Portiers des Hotel „Métropole“ misstraute Amelie desgleichen. Die Wotrubas kamen erst recht nicht in Frage. Zwar konnte der Junior Französisch und war der einzige, dem zuzutrauen war, im „Métropole“ zu Sergej Sergejewitsch direkt durchzudringen, aber unter welchem Vorwand sollte sie ihm wohl eine Nachricht für den jungen Russen mitgeben? Allein ins „Métropole“ zu gehen, war Amelie auch nicht möglich. Schließlich war entweder die Mademoiselle bei ihr, noch dazu nicht ihre Vertraute, sondern die ihrer Mutter, oder Herr Vorhofer, oder mindestens die Fini, ihr persönliches Mädchen!
Keinen Schritt tat sie jemals allein, weil es sich nicht gehörte. Allein, sie hatte soundso schon etwas Ungehöriges getan und wenn sie and Dr. Neuländer dachte, schien es ihr, als würde sie noch so manches Ungehöriges dazu tun. Die einzige Wegstrecke, die sie jemals allein zurück legte, war der kurze Weg über den Alten Postplatz zwischen ihrer Schule und dem elterlichen Palais. Die einzige Möglichkeit war, eventuell rasch ins Hotel „Zur Eisernen Krone“ abzubiegen und unter irgendeinem Vorwand einen der dortigen Pagen ins „Métropole“ zu schicken. Arlingtons waren dort seit jenem ersten Sonntag mit den russischen Verwandten bestens bekannt und hoch angesehen. Herrn Kupferwieser, dem Besitzer wäre es sicher eine Freude, ihr einen Gefallen zu tun, respektive würde sein Personal eine derartige Intention ihrerseits in keiner Weise in Frage stellen.
Sie musste nur ein einziges Billet direkt an Sergej Sergejewitsch zustande bringen, denn er konnte ihr jederzeit über Pagen des „Métropole“ eine Nachricht zukommen lassen. Amelie fühlte sich immer mehr wie Marie Antoinette, Sergej Sergejewitsch war ihr Graf Fersen und im Geiste ernannte sie Fini zur Princesse de Lamballe. Nein, das war zu albern, ermahnte sie sich selbst.
Donnerstags aber ging Gräfin Eugenie stets mit Mademoiselle schon am Vormittag in die Stadt, tätigte diverse Einkäufe, begann bei ihrer Schneiderin, wechselte über die Modistin zum Gabelfrühstück beim Figlmüller oder im Café Rebhuhn, schaute bei der „Schwäbischen Jungfrau“ vorbei, ob sie ihre Tischwäsche wohl auffrischen müsse, hatte eventuell bei Köchert oder Backhausen etwas abzugeben, oder abzuholen, speiste im Hotel „Krantz“ zu Mittag, kaufte Tee bei Schönbichler, begutachtete Teppiche bei Haas am Stephansplatz, nahm einen Kaffee im „Sacher“, sofern sie nicht bei Gräfin Wilczek in der Herrengasse vorbei schaute, oder bei Gräfin Harrach auf der Freyung, die beide Donnerstags empfingen und ihre engsten Freundinnen waren. Sie schloss ihren Tag mit schöner Regelmäßigkeit, indem sie entweder Torten von Demel oder Gerstner, oder aber von einem der neuen italienischen Eissalons „Gefrorenes“ zum abendlichen Dessert nach Hause brachte.
Ebenfalls Donnerstags konferierte Graf Ludwig üblicherweise gleich nach dem Frühstück mit Herrn Brauner und Herrn von Valenta, hielt die übliche, sogenannte „Wochenbesprechung“ ab, wonach er zum Mittagessen Monsignore d´Allio empfing, den einzigen Kirchenmann, dem er wirklich Vertrauen entgegen brachte. Nachmittags hatte er dann seine Tarockpartie, allgemein mit Graf Garfield, Baron Hilfinger und General de Souza. Für den gar nicht so seltenen Fall, dass Eugenie bei Wilczeks oder Harrachs zum Abendessen blieb, zog sich die Tarockpartie dann oft und gerne bis in die Abendstunden und den Herren wurden belegte Brote in die Bibliothek serviert, während die Kinder mit Hrn. Vorhofer dinierten. Manchmal blieben die „Tarockherren“, wie der Arlingtonsche Hausjargon sie nannte, aber auch gerne zum familiären Dîner, denn Graf Garfield war verwitwet, die Ehe des Barons galt als Schauplatz unerklärter Kriegshandlungen und über die Gefährtin des unverheirateten Generals sprach man nicht, jedenfalls nicht vor den Kindern.
Wer auch immer am Donnerstag zum Abendessen im Hause war, es blieb der einzige Abend in der Woche, wo man ganz léger blieb und sich nicht umzog.
Donnerstags hatte darüber hinaus Herr Vorhofer nachmittags Vorlesung, was nicht weiter störte, da im Schottengymnasium an diesem Tag auch Nachmittagsunterricht herrschte, somit die Buben beschäftigt waren. Da alle so emploiert waren, nützte den Donnerstag auch die Wotruba, um den Großteil ihres Wocheneinkaufs zu tätigen, Hannes, die Köchin und mindestens einen der Hausburschen im Schlepptau.
Es gab also definitiv nur den Donnerstag Nachmittag, an dem Amelie unbeschadet und ungefragt, ihrerseits die unbedarfte Fini im Gefolge, das Haus verlassen konnte.
Also tat sie es, ging raschen Schrittes, in ihrem erwachsendsten Kleid auf den Portier der „Eisernen Krone“ zu und meinte zugleich in ihrer kindlichsten Diktion, sie müsse ihren russischen Verwandten eine Nachricht ins „Métropole“ schicken, aber sämtliches Personal sei irgendwie in Anspruch genommen und sonst wo unterwegs, ob man ihr wohl mit einem Pagen aushelfen könne, im Namen ihres Herrn Papa? Man würde ihnen allen wirklich aus einer großen Verlegenheit helfen ...
Sicherheitshalber hatte sie die Fini an der Tür stehen gelassen und noch mehr sicherheitshalber ihr wöchentliches Taschengeld zu einem Trinkgeld anwachsen lassen, das ihr angemessen erschien. Offensichtlich hatte sie den Betrag zu hoch bemessen, denn Portier, zweiter Portier und Page überschlugen sich förmlich, Komtess zu Hilfe zu eilen, aber Hauptsache war, dass der Page in Richtung „Métropole“ ging, dass Kupferwieser nicht auftauchte und die Fini beschäftigte Amelie anschließend noch mit völlig sinnlosen Besichtigungen diverser Geschäfte.
Amelie hatte tatsächlich lange an jenem Billet gearbeitet, ohne sich eines weiteren Cognacs zu bedienen, denn sie hatte sich an ihrem gewähltesten Französisch versucht und konnte schließlich weder die Louise, noch Madame de Saint-Blair, ihre Französischlehrerin in der Schule, zu Rate ziehen.
„Lieber Sergej Sergejewitsch, lieber Cousin! Ich entbinde Sie jeglicher Verantwortung mir gegenüber. Was geschehen ist, geschah Ihrerseits und meinerseits zu gleichen Teilen. Wenn Ihnen nur ein wenig an mir liegt, werden Sie mich nicht gegenüber meiner Familie kompromittieren und ich werde desgleichen nichts tun. Ich werde meine Mittel und Wege finden, hier zu bleiben, ohne dass einer von uns beiden zu Schaden kommt.
Lieber Cousin, wir sind zu verschieden für eine gemeinsame Zukunft, daher bitte ich Sie in aller Form, von einer weiteren Verbindung zwischen uns Abstand zu nehmen. Über etwaige Folgen machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe ein Vertrauen zu Gott und genieße das Wohlwollen meiner Eltern.
Ihre Amelie von Arlington“
Amelie fand alles was sie sagen wollte etwas holprig ausgedrückt, fehlerhaft und unvollständig, fühlte sich selbst mit einem Male nicht mehr gar so erwachsen.
Noch am selben Tag jedoch, knapp vor dem Abendessen überbrachte ein Page des Hotel „Métropole“ eine Nachricht von Sergej Sergejewitsch.
„Liebe Amelie, liebe Cousine! Ich verstehe Ihre Gründe vielleicht besser als Sie denken. Ich möchte nur wiederholen, dass ich bereit bin, die Verantwortung für alles Geschehene, sowohl gegenüber Ihren Eltern, wie auch gegenüber meiner Familie voll und ganz auf mich zu nehmen. Ich kann auch noch in zwei Monaten offiziell um Ihre Hand anhalten, falls es erforderlich ist und falls Sie es wünschen. Falls es wirklich zu ernsthaften Folgen kommt und Sie dennoch keine weitere Verbindung mit mir wünschen, vertraue ich ganz und gar der Stärke Ihrer Person. Jedoch hoffe ich, dass Sie es mich wissen lassen. Im Notfall bitte ich Sie, wenigstens der pekuniären Unterstützung meiner Familie zu vertrauen. Ich möchte in jedem Falle Ihr Freund bleiben und hoffe, dass wir miteinander wenigstens korrespondieren können, wenn ich nach Russland zurück kehre.
Sehr der Ihre, Sergej Sergejewitsch Arlington“
Amelie, die den Pagen hatte warten lassen, antwortete kurz.
„Lieber Sergej, lieber Cousin! Auch Sie finden mich als ganz die Ihre. Mit Ihnen weiterhin in Verbindung zu bleiben, wäre mir tatsächlich eine große Freude.
Ihre Amelie“
Und tatsächlich geschah es, dass die nächsten Wochen, welche die russischen Arlingtons noch in der Stadt verblieben, sich Amelie und Sergej Sergejewitsch oft und öfter ganz zwanglos, heiter und ohne Sorge begegneten, fallweise sogar fast allein, die Fini und Arnold, den Diener von Sergej Sergejewitsch im Kielwasser. Arnold, ein Baltendeutscher, machte Fini sogar ein wenig den Hof, so dass die beiden beschäftigt und abgelenkt genug waren. Die elterlichen Arlingtons ließen es gerne dabei bewenden und machten sich weder Sorgen noch Gedanken. Man war sich einig, die Beziehung der Kinder als gute Freundschaft unter Verwandten zu verbuchen, im übrigen sprachen die Grafen viel über Arlington-Glas und die Gräfinnen viel über Arlington-Rosen.
Mit ein Grund für das neuerdings so entspannte Miteinander war freilich ein wesentlich weniger entspannter, sondern eher unerfreulicher Besuch Amelies bei jenem Dr. Neuländer, der sie einerseits einen altmodischen, aber wertvollen Rubinring der verstorbenen Tante Melly kostete, ihr aber andrerseits die Gewissheit brachte, - nach besten Wissen und Gewissen -, dass sie niemals Kinder würde bekommen können. Jene forensische Analyse ihrer körperlichen Befindlichkeiten nahm Amelie wie betäubt zur Kenntnis und vergaß sofort wieder die eigentliche - und einigermaßen langatmige Begründung.
Danach gab es zunächst einen sehr einsamen Abend für sie, an dem sie sich nach dem Dîner wieder einiges an Cognac gönnte. Mochte sich die Wotruba auch noch so sehr über den ungewohnten Schwund in einer bestimmten Karaffe wundern, für den Moment war es Amelie einerlei.
Wieder zu sich gekommen, empfand sie ihre Situation denn doch mit einer gewissen Erleichterung.
Sie war frei. Sie war so frei, wie kaum eine Frau ihres Alters, ihrer Generation und ihre Herkunft, denn sie wusste um diese Freiheit. Um so schockierender und irritierender war diese Gewissheit freilich zunächst für sie.
Mit neu gewonnener Kühnheit spazierte sie bald danach, - nachdem sie dreist auch noch die Fini losgeworden war -, ins Hotel „Métropole“, konfrontierte den Russen mit den Erkenntnissen und gab sich ihm erneut hin und erneut und erneut, über Tage und Wochen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit und solche ergaben sich mit einem Male zahlreich, da sie beide Mittel und Wege fanden, Fini und Arnold zugleich mit den unsinnigsten Aufträgen zu beschäftigen.
Irgendwann danach, der Winter zog schon ins Land, reiste Sergej Sergejewitsch Arlington samt Eltern und Personal ab, unter allgemeinem Bedauern. Man begleitete sie zum Nordbahnhof, denn die Russen reisten über Berlin und Preußen, und es wurde eine tränenreiche Szene, da die Grafen, die Gräfinnen, die Sprösslinge, ja selbst Fini und Arnold, sich mit ihren Gefühlen nicht zurückhalten konnten. Arlingtons versicherten sich wechselseitig, sich künftig so oft wie möglich zu besuchen. Graf und Graf, Gräfin und Gräfin, Sohn und Tochter, versicherten sich wechselseitig regelmäßiger Korrespondenz. Allein Fini und Arnold waren um die letzten Worte ein wenig verlegen.
Wochen später, schon knapp vor Jahreswechsel, ergab sich in Ludwigs Arbeitszimmer ein Gespräch, das Amelie irgendwie bekannt vorkam, ohne dass sie es zugeben konnte. Zur Abwechslung war die Fini „in der Hoffnung“ und nach einem etwas hektischem Briefwechsel zwischen Wien und St. Petersburg, wurde der Junior dazu abkommandiert, die Fini unter Mitnahme einer kleinen Mitgift und der nötigsten Aussteuer, nach St. Petersburg zu eskortieren, um ihren Arnold zu ehelichen.
Fini, die unerfahren, aber nicht dumm war, lernte mit Hannes wie besessen Französisch, während sie den gräflichen Herrschaften in den verschiedensten Varianten für deren Verständnis und Entgegenkommen dankte.
Amelie bestand in weiterer Folge darauf, die Fini zum Bahnhof zu begleiten, schließlich sei sie ihr persönliches Mädchen gewesen und letztendlich gehöre es sich, dass wer von der Familie dabei sei.
Man gab Fini Briefe mit und in Amelies Brief an Sergej Sergejewitsch befand sich ein Medaillon mit ihrer Photographie. Der Fini schenkte Amelie schließlich ein schlichtes Goldarmband. Versehentlich fuhr Amelie ohne Begleitung zum Bahnhof, weil ihr neues Mädchen kurzfristig erkrankt war und sich die Eltern nichts dabei dachten, die Tochter zur Rückfahrt allein im eigenen Wagen fahren zu lassen, daher war es Amelie möglich, einen Dienstmann zum Dr. Neuländer zu schicken, mit einem Paar Rubinohrgehänge, passend zum Ring. Dies tat sie aus dem Gefühl einer gewissen Erleichterung heraus.
Allgemein lehnte man sich im Palais Arlington am Alten Postplatz mit einer gewissen Erleichterung zurück, die russische Affaire einigermaßen schadlos überstanden zu haben. Sowohl Ludwig wie auch
Eugenie waren weit davon entfernt, die russische Verwandtschaft allzu bald wiedersehen zu wollen, auch das Interesse an verstärkter Korrespondenz hielt sich in Grenzen. Sergej Alexandrowitsch würde Arlington-Glas in Russland verbreiten und Eugenie würde eine Rosenzucht in der Steiermark aufbauen. Fini und Arnold würden heiraten.
„Noch ein Glück,“ bemerkte Gräfin Eugenie eines Tages gegenüber Baronin Fasching, „dass net mehr passiert ist.“ Und die Baronin, mit der Selbstverständlichkeit der Juden, aus allem gern ein Gleichnis zu machen, meinte: „Gott soll einen hüten, vor allem, was noch ein Glück is´.“