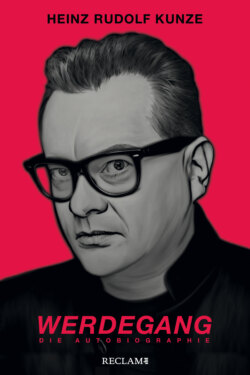Читать книгу Werdegang - Heinz Rudolf Kunze - Страница 10
03. In der Alten Piccardie
ОглавлениеDie Erinnerung scheint den Schleier des Vergessens, der sich über meine früheste Kindheit gelegt hat, zu durchdringen. Vielleicht spielt sie mir aber auch Streiche und gaukelt mir nur vor, dass sie zurückreicht bis fast an den Anfang. Denn was sie zutage fördert, sind Bilder, wenige nur und stets dieselben. Sie kommen mir vertraut vor, und ich will sie für den Abdruck des einst bewusst Erlebten halten. Doch kann es auch sein, dass tausendmal in den Händen gehaltene Fotografien, die meine Eltern gemacht haben und auf denen ich als kleines Kind zu sehen bin, mit der Zeit an die Stelle tatsächlicher Erinnerungen getreten sind. Dass die Bilder also gar nicht wirklich mir gehören, sondern von einem Apparat hergestellt wurden. Aber letztlich macht es keinen Unterschied mehr. Sie bleiben real für mich, und ich finde mich in ihnen wieder.
Der unendlich weiche Stoff eines gelben Schlafanzugs. Eine Kindersonnenbrille, die das Licht im Zimmer einfärbt, und auf meinen langen, blonden, gelockten Haaren ein kleiner Papp-Zylinder. Beides lässt mich wie ein Miniatur-Mitglied der Glamrock-Band New York Dolls aussehen, also einigermaßen lächerlich, und so fühle ich mich auch. Ein rosa Bademantel mit senkrechten, schwarz-weißen Streifen, ich bin im Wohnzimmer der winzigen Dachwohnung in Lengerich, die meine Eltern nach dem Weggang aus Espelkamp gemietet haben, meine Oma, die Mutter meiner Mutter, wohnt bei uns. Ich stehe auf einem Eimer, um größer zu sein, wieder trage ich einen Hut aus Pappe, aber diesmal bin ich ein Zauberer, der den Großen Geschichten erzählt und Lieder vorsingt, ging ein Weiblein Nüsse schütteln, Nüsse schütteln, Nüsse schütteln, alle Kinder halfen rütteln, halfen rütteln, rums! Meine Mutter hatte mir das so oft vorgesungen, nun sang ich es ihr, ich liebte Wörter, und ich liebte, wie sie sich verbinden konnten mit Tönen. Früh, sehr früh schon konnte ich sprechen und weit vor meiner Einschulung auch lesen. Ich brachte es mir selbst bei, die Hörzu half mir, ich musste es schaffen, die Buchstaben auf den Seiten mit dem TV-Programm zu entziffern, nur so konnte ich meinen Eltern beweisen, dass gerade wirklich eine Kindersendung im Fernsehen lief. Wenn ich lesen konnte, würden sie niemals mehr sagen können, nein, das stimmt nicht, das steht hier nicht, es kommt nichts für dich.
»Ich lebte über mein Alter, wie man über seine Verhältnisse lebt«, heißt es in Sartres Autobiographie Die Wörter, und das traf auch auf das von Wörtern und Tönen faszinierte Kind zu, das ich war. Ich habe das Buch erst relativ spät gelesen, aber dann kam es mir vor, als hätte mich jemand im Innersten belauscht und meine Kindheit in Schrift verwandelt. Es spielte keine Rolle, dass der dem Lesen und Schreiben verfallene Junge im Buch in einer anderen Zeit und unter völlig anderen Umständen lebte, ich wusste genau, wie er sich fühlte. Ich kannte seine Einsamkeit, seine Furcht, nicht zu genügen, seine Schwierigkeiten, die er mit sich selbst hatte, sein starkes Empfinden, falsch in die Welt hineingestellt zu sein. All das war und ist mir nur allzu vertraut.
Und noch ein Bild aus der Erinnerung, aber wahrscheinlich handelt es sich auch dabei um eine Fotografie: Mein Vater sitzt auf einem Moped, er trägt einen langen Ledermantel, wie man ihn von Gestapo-Leuten kennt. Auf diesem Moped fuhr er in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre Tag für Tag von Lengerich zur Hochschule nach Osnabrück, wo er ein Lehramtsstudium aufgenommen hatte. Dann ein Unfall: Mein Vater wurde angefahren von einem englischen Militärtransporter, das linke Bein war gleich mehrfach gebrochen. Habe ich den Schrecken, den dieses Ereignis in unserer Familie hervorrief, wirklich bewusst mitbekommen? Ein langer Krankenhausaufenthalt schloss sich an, hinterher ging mein Vater viele Monate am Stock. Ans Mopedfahren war nicht mehr zu denken, ans Weiterstudieren glücklicherweise schon, fortan nahm er den Bus nach Osnabrück.
In dieser Zeit verdiente meine Mutter das Geld, sie arbeitete als Sprechstundenhilfe. Nicht bei irgendeinem Arzt, sondern bei einer äußerst wohlhabenden westfälischen Ärzte-Dynastie, den Steinmanns. Manchmal nahm mich meine Mutter mit in die Praxis, sie befand sich in einem Herrenhaus, das aussah, als sei es einem Edgar-Wallace-Film entsprungen: ein großer Eingangsbereich, links und rechts führten Treppenstufen nach oben, sie endeten auf einer Galerie, von der aus es in die einzelnen Räume im ersten Stock ging. Dazu kam noch die zu jeder Viertelstunde dumpf schlagende Standuhr. Eigentlich fehlte nur Klaus Kinski, der wie in Neues vom Hexer fragt: »Noch einen Wunsch, Mylady?« Ich bin sehr zufrieden mit dem Haus, in dem ich nun schon so lange wohne. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich noch immer sofort meine Sachen packen und in solch ein Krimi-Schloss umziehen. Ich bin mir sicher, in mir hätte Inspektor Wesby den idealen Assistenten.
»Take me back«, singt Van Morrison, führ mich zurück, ganz weit zurück, zurück in der Zeit, ganz, ganz, ganz weit zurück, führ mich zurück in ein Damals, in dem das Leben noch voller Sinn war, als sich alles so gut angefühlt hat, als ich noch keine Sorgen hatte und keine Angst, führ mich dahin zurück, ins Licht goldener Nachmittage, als alles voller Wunder war, und lass die Zeit stillstehen, noch einmal, für einen ewigen Moment des Erinnerns, für ein ewiges Jetzt, führ mich dahin zurück, führ mich zurück.
Zuerst in die Erinnerung kommt das nie verstummende, weithin vernehmbare Keuchen der Ölpumpen, es war, als würde die Landschaft selbst atmen, ein, aus, sie lag hingestreckt unter einem weiten Himmel, eine Moorlandschaft, eine Welt für sich. Jemand hielt seine Hand über mich, wenn ich durch die Wiesen lief, die im Winter gefroren waren und im Sommer nach dem Mähen so gut rochen. Die Jahre ergaben sich dem Rhythmus der Wolken, ich war drei, ich war vier und sang Hymnen auf die Stille. Dies war mein Combray, mein Jerichow, mein Kindheitsparadies, das ich niemals vergessen werde. Ich war engelsgoldgelockt und unverwundbar klein, als der Wind von Westen kam und über die einzige Straße des Dorfes wehte, an der sich die Gehöfte der Bauern aneinanderreihten, eins am anderen, unterbrochen nur vom Kramladen, in den auch ging, wer einen Brief aufgeben wollte oder ein amtliches Dokument brauchte.
Der Ort hieß Alte Piccardie und lag in der Grafschaft Bentheim, ganz nah an der niederländischen Grenze. Der Krieg war gerade einmal fünfzehn Jahre vorbei, und noch hatte man sich nicht zu mögen gelernt. Wer konnte es den Holländern verdenken, wenn sie gelegentlich die Faust ballten oder ausspuckten beim Anblick eines deutschen Autokennzeichens. Aber davon bekam ich nichts mit. Für mich hatte der Sündenfall noch nicht stattgefunden. Ich wusste nicht, dass ich Kind war, alles an mir war beseelt. Ich half mit, am Abend die Kühe zurück in den Stall zu treiben. Ich ließ mich fallen, und das Heu fing mich auf. Ich aß das frisch geschlachtete Fleisch, das uns die Bauern vorbeibrachten, direkt aus dem Kessel.
Die Menschen waren gut zu uns, die schweigsamen Männer ebenso wie die Frauen mit den rosigen Gesichtern und den vom Wind zerzausten Haaren. Sie nahmen meine Eltern, meine Oma und mich in ihre Gemeinschaft auf. Dabei hatte man uns doch vorher so eindringlich vor ihnen gewarnt, verstockt seien die Moorbauern, feindselig gar zu allen Fremden, besonders zu denen ›von drüben‹. Doch sie trugen uns auf Händen, und das nicht nur, weil der Lehrer, den alle nur »Meester« nannten, genau wie der Pastor über jeden Zweifel erhaben war. Mein Vater hatte sein Examen bestanden, und nun trat er seine erste Stelle an, als Lehrer in Alte Piccardie. Die Dorfschule bestand aus zwei kleinen, durch einen Gang verbundenen Häusern, wir wohnten im ersten Stock des linken. Morgens, wenn er zum Unterricht ging, musste mein Vater nur die Treppe nach unten gehen, dann stand er im Klassenzimmer und sah die ersten Bauernkinder hereinkommen und ihre abgewetzten Ranzen neben die Stühle stellen.
Er unterrichtete die Kleinen. Die Älteren gingen ins rechte Haus, ihr Lehrer war Alfred Serwatka, der Leiter der Dorfschule. Die Serwatkas wohnten nebenan, ihre beiden Töchter Elfriede und Hannegret wurden meine ersten Spielkameradinnen, und wenn mir meine Eltern mal wieder das Fernsehen verboten hatten, rannte ich hinüber, um dort zu schauen. Alide Serwatka wurde für mich zu einer zweiten Mama. Ich war ihr Liebling, und sie hatte mich so in ihr Herz geschlossen, dass es meine Mutter eifersüchtig machte. Bei Alide durfte ich alles, aber ich nutzte es nicht aus. Ich blieb ein schüchterner, braver Junge, meine Tage verliefen ohne Arg. Als die Serwatkas einige Jahre später noch einen Sohn bekamen, nannten sie ihn Karl-Heinz.
Am liebsten war meinem Vater der Sportunterricht. Wenn er mit den etwas Größeren hinausgehen wollte, um Fußball zu spielen, durften die Erst- und Zweitklässler währenddessen nicht ohne Aufsicht bleiben. Also rief er mich zu sich, fragte: »Heinzi, willste?«, ich sagte: »Ja, klar!«, ging ins Klassenzimmer und begann zu unterrichten. Ich ließ vorlesen und Diktate schreiben, ich war vier und beherrschte das schon gut, aber es klappte nur, weil die Kinder mitmachten und mich akzeptierten. Sie hätten es mir übelnehmen können, dass mich ihre Mütter als leuchtendes Vorbild hinstellten, während sie selbst Ohrfeigen bekamen wegen ihrer Schwierigkeiten, nach der Schrift zu sprechen. Aber sie taten es nicht. Sie waren gutmütig und machten es mir leicht, glücklich zu sein.
An eine Begebenheit in Alte Piccardie muss ich oft denken. In der Erinnerung läuft sie wie in Zeitlupe ab. Ich bin fünf und stehe im Verbindungsgang zwischen den beiden Dorfschul-Teilen, ich gerate ins Träumen und starre wie blind hinaus auf die Felder. Plötzlich hebe ich die Faust meiner rechten Hand. In der nächsten Sekunde blutet sie, denn ich habe die Fensterscheibe vor mir eingeschlagen. Smash the Mirror. Für einen langen Moment ist es ganz still, viel stiller als zuvor, ich habe Angst, denn ich bin mir sicher, nun schlimm bestraft zu werden. Und wirklich, da kommt schon Alfred Serwatka herbeigestürzt, aber er schimpft nicht, er sagt nur, um Gottes willen, Junge, was hast du denn gemacht, zieht sein Taschentuch aus der Jacke und verbindet meine blutende Hand. Ich habe nie einen Vorwurf wegen der zerbrochenen Scheibe gehört, wahrscheinlich glaubten alle an ein Versehen, aber das war es nicht. Ich habe es absichtlich getan, wahrscheinlich weil ich herausfinden wollte, wie es sich anfühlt, etwas kaputtzumachen.
»Ich schlug träumend eine fremde Fensterscheibe ein, / denn ich wollte bei den blutenden Soldaten sein«, schrieb ich fast vierzig Jahre später in dem Song »Nicht mal das«. Vielleicht ging es darum – um den Versuch, den Schmerz nach außen zu tragen und zum Leben selbst durchzudringen. »Nicht mal das« liefert nach, was einem meiner bekanntesten Lieder, dem autobiographischen »Brille«, fehlt: die Innensicht. Eine psychedelische Rocknummer, die mit dem Keith-Jarrett-Klavier von Matthias Ulmer und dem die ganze Welt schreddernden Gitarrensolo von Heiner Lürig mein wichtigstes Lied und mein größtes Tondokument ist. Näher vermag ich dem Ausdruck meiner Verzweiflung wohl nicht zu kommen. Ich würde es wieder tun.
Als wir von Alte Piccardie fortgingen, brach es mir das Herz. Wegen eines hartnäckigen Ziehens im Hals hatten mich meine Eltern von einem Arzt untersuchen lassen. Der sprach von einem Nervenleiden, warnte vor dem angeblich so schädlichen Moorklima und riet zum Umzug. Meine Eltern gehorchten, meine Mutter schien sogar ganz froh zu sein, auf diese Weise ihrer Eifersucht auf Alide Serwatka entkommen zu können. Nun würde sie mich wieder nur noch mit meiner Oma teilen müssen. Ich habe niemals einen Kindergarten von innen gesehen.
Wir landeten vom Himmel in der Hölle. Wir landeten in Bad Grund im Westharz, wo sich mein Vater auf eine Lehrerstelle beworben hatte. Der Ort lag in einer Schlucht, in die selbst an klaren Tagen kaum Sonne fiel. Die Leute begegneten uns mit unverhohlener Ablehnung. Mit uns im Zweiparteienhaus wohnte eine Familie, deren zwei Söhne Spaß daran hatten, mich zu quälen. Zum ersten Mal lernte ich Menschen kennen, die mich nicht leiden konnten, die mich hänselten und ärgerten, beschimpften und schlugen. Sie sorgten dafür, dass ich mich eines Mittags, nachdem sie mir wieder einmal aufgelauert hatten, vollkommen verlor. In einem Anfall von dämonischer Ermächtigung schnappte ich mir den Jüngeren der beiden, warf ihn in den Dreck und würgte ihn. Sein Bruder sah bloß fassungslos zu, offensichtlich gelähmt vor Schreck. Ich war wütend, so, so wütend, es würde nie mehr vorbeigehen. Ich bilde es mir nicht ein, ich weiß es, dass ich diesen Jungen umgebracht hätte, wäre seine Mutter nicht gerade noch rechtzeitig aus dem Haus gestürzt, um mich wegzureißen. Das Gesicht des Jungen war schon blau angelaufen. Doch sie bestrafte mich nicht und erwähnte auch den Vorfall meinen Eltern gegenüber mit keinem Wort. Sie wusste, wie ihre Söhne mich die ganze Zeit über behandelt hatten. Von diesem Tag an ließen sie mich in Ruhe.
Ich war kreuzunglücklich in Bad Grund, meinen Eltern erging es kaum besser. Als ich mir auch noch beim Skifahren-Lernen den Arm brach, hatten wir alle genug. Nach nur einem halben Jahr zogen wir wieder um, noch einmal, ein letztes Mal. Elisabeth Siegel, die Professorin, die meinen Vater an der Pädagogischen Hochschule ausgebildet hatte, holte ihn als Assistenten zu sich nach Osnabrück, und ich besuchte ab 1964 meine insgesamt dritte Grundschule. Das zweite Schuljahr lief bereits, was das Ankommen zusätzlich erschwerte. Aber ich kam an, mehr als es meine Eltern je vermocht haben. Wenn es denn überhaupt eine Stadt gibt, die dem Begriff ›Heimat‹ in meinem Leben nahekommt, dann ist es wohl Osnabrück. Dort sind meine beiden Kinder zur Welt gekommen, dorthin bin ich von meinen ersten großen Tourneen zurückgekehrt, dort habe ich insgesamt vierundzwanzig Jahre verbracht.
Wir wohnten in einem dunkelgrauen Vierparteienhaus, die Adresse lautete Ameldungstraße 21, das war am Südrand von Osnabrück, eine lange, schnurgerade, etwas langweilige Vorortstraße im Stadtteil Schölerberg. Alle fünfzehn Minuten fuhr der Bus an den Kleinbürgerwohnhäusern mit den schmalen Vorgärten vorbei, sonst gab es nur ein paar Geschäfte und ein Mädchengymnasium. Vor meinem Fenster stand ein Baum, seine Äste und Blätter ließen wenig Licht ins Zimmer, aber das war mir egal. Die Einrichtung unserer Wohnung störte mich dafür umso mehr. Ich hielt sie für unbeschreiblich geschmacklos. Meine Eltern hielten eisern an ihren ersten Nachkriegsmöbeln fest und weigerten sich hartnäckig, über Neuanschaffungen überhaupt auch nur nachzudenken. Das führte zu verheerenden Ergebnissen. Was vielleicht 1951 in der DDR einmal kurz in Mode gewesen sein mochte, wirkte 1969 in Westdeutschland grotesk fehl am Platz. Die Wohnung war mir peinlich, zumal ich mitbekam, wie es bei anderen Leuten aussah. Reinhard Frense, mein bester Freund, kam aus einer sehr wohlhabenden Familie, sein Vater arbeitete als Architekt. Sie besaßen ein Haus im vornehmen Stadtteil Westerberg, und allein schon ihr Wohnzimmer übertraf die Ausmaße unserer gesamten Wohnung, beinahe meinte man, die Erdkrümmung zu sehen. Alles war so geschmackvoll und stilsicher eingerichtet, dass man bei Frenses ohne weiteres eine Tatort-Folge mit Klaus Schwarzkopf als Kriminalhauptkommissar Finke hätte drehen können. Mord in guten Verhältnissen. Bei uns daheim sah es dagegen aus, als käme in der nächsten Sekunde Heinz Ehrhardt ins Zimmer gehüpft, der junge, wohlgemerkt.
Reinhard sorgte auch noch für ein weiteres Aha-Erlebnis. In der großen Pause packte er regelmäßig ein Sandwich aus, das nicht nur wie meines mit Wurst oder Käse, sondern auch mit einem Salatblatt belegt war. Mit einem Salatblatt! Nicht dass ich besonders scharf auf Salatblätter gewesen wäre. Aber dieser Anblick lehrte mich doch die feinen Unterschiede zwischen den Müttern aus Osnabrück-Schölerberg und denen aus Osnabrück-Westerberg. Stichwort ›Kulturelles Kapital‹. Pierre Bourdieu hätte es mir nicht besser erklären können. Nur weitaus umständlicher.
In Osnabrück begann meine Mutter wieder zu arbeiten. Nach einer kurzen Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule wurde sie Grundschullehrerin. Auch mein Vater unterrichtete nach Ende seiner Assistententätigkeit wieder. Er hatte Glück. Nur wenige Jahre später, in den Siebzigern, wäre es einem Mann mit seiner Vergangenheit wohl nicht mehr möglich gewesen, Realschullehrer zu werden. Er liebte seinen Beruf, und er machte ihn gut. Oft haben mich später ehemalige Schüler von ihm angesprochen, erwachsene Frauen und Männer, die sich gerne an seinen Unterricht oder an die gemeinsamen Klassenfahrten erinnerten.
Einmal stand er sogar kurz davor, Rektor seiner Schule zu werden. Er hätte den Posten auch ohne Probleme bekommen, wäre er denn, daraus wurde kein Geheimnis gemacht, CDU-Mitglied gewesen. Nicht nur die Abneigung meiner Mutter gegen jede politische Festlegung stand dem entgegen. Wenn überhaupt einer Partei, hätte sich mein Vater ohnehin nicht der CDU, sondern viel eher dem konservativen Flügel der SPD und damit Leuten wie Leber, Apel oder Schmidt angeschlossen. Daran hatte Elisabeth Siegel, die sozialdemokratische Professorin, die ihn ausgebildet hatte, sicher ihren Anteil. Sie war es auch, die meinem Vater in intensiven Gesprächen immer wieder das Ausmaß der nationalsozialistischen Verbrechen vor Augen führte. Von manchem erhielt er überhaupt erst durch sie Kenntnis. Kein Wunder. Mitte der sechziger Jahre existierte das Thema in der Öffentlichkeit praktisch nicht. Das Unrecht sollte abgehakt, nicht aufgearbeitet werden.
Umso bemerkenswerter die Offenheit, mit der mein Vater über seine Rolle in der SS sprach, bald auch mit mir. Vielleicht mussten seine Erzählungen zwangsläufig in mir erst einmal den Reflex auslösen, ihn verstehen und sein Verhalten sogar rechtfertigen zu wollen. Ich war ein Kind, ich liebte meinen Vater und wollte einen Sinn in dem sehen, was er getan hatte. Er wehrte müde ab: Lass gut sein, Junge, da war kein Sinn. Es war falsch, und das ist die ganze Geschichte.
Die Vergangenheit holte ihn ein, wenn er gar nicht damit rechnete. Das konnte eher harmlos sein, wie an jenem Morgen, als wir beim Bäcker an der Theke standen und ein alter Herr neben uns plötzlich zu salutieren begann, weil er meinen Vater erkannt hatte: Ich habe Ihnen mein Leben zu verdanken, Herr Unterscharführer! Sie haben uns heil herausgeführt aus dem Kessel von …
Aber es gab auch die unheimlichen Begegnungen. Männer, die wie Albtraumgestalten bei uns zu Hause auftauchten. Etwa zwei alte Waffen-SS-Männer, ehemalige Mitgefangene, einer von ihnen war inzwischen CDU-Abgeordneter. Sie traten rabiat auf und setzten meinen Vater unter Druck, weil er nicht zu den Kameradschaftsabenden auf Schloss Elmau oder sonst wo in Bayern kam, Gruselveranstaltungen, an denen sich damals kein Mensch zu stören schien. Warum bist du nicht dabei, fragten die Männer, »unsere Ehre heißt Treue«, das stand auch auf deinem Koppelschloss, hast du das vergessen? Und mein Vater ist dann tatsächlich hingegangen, sogar mehrmals, ich hoffe heute noch, aus Angst und nicht aus heimlicher Sympathie. Er machte an diesen Abenden den Clown, erzählte Witze und Anekdoten aus der Gefangenschaft, denn das konnte er ja, den Alleinunterhalter geben. Wenn er zurückkam, schämte er sich und war doch auch gleichzeitig ein bisschen stolz, die alten Kameraden zum Lachen gebracht zu haben.
Einerseits hatte er eine regelrechte Abscheu gegen alle Formen der SS-Traditionspflege, andererseits hielt er manchmal an äußerst zweifelhaften Leuten fest, weil er mit ihnen Jahre in einem sibirischen Lager verbracht hatte. Mir fällt der alte Nazi ein, der nach der Gefangenschaft sofort wieder auf die Füße gefallen war und es, auf welche Art auch immer, zu einer großen Ferienhaussiedlung an der Costa Brava gebracht hatte. Wir waren sogar einmal dort, er hatte uns eingeladen, ich studierte schon und hatte ihn nie zuvor gesehen, wusste aber sofort Bescheid, als er versuchte, mich für die Redaktion irgendeines braunen Blättchens anzuwerben: Sie können schreiben, Heinz Rudolf, höre ich. Kommen Sie doch zu uns, wir brauchen Leute wie Sie …
Ein anderer Besucher in Osnabrück trieb meinen Eltern den Schweiß auf die Stirn. Sie ließen ihn dennoch herein, einen kleinen, schattenhaften, verhuschten Mann von osteuropäischem Aussehen, einen Ukraine-Deutschen, auch ihn kannte mein Vater aus der Gefangenschaft. Gleich nach dem Überfall auf Russland hatte er sich auf die Seite der Deutschen geschlagen, ein Schreiber und Dolmetscher, den man offensichtlich bei Verhören, Folterungen und Erschießungen gut hatte gebrauchen können, so viel Ordnung musste schon sein. Auch beim Massaker von Babi Jar 1941 tat er seine schrecklichen Dienste. Dann, während der Gefangenschaft, gelang es ihm, weiß der Teufel, wie er es angestellt hat, seine Identität und damit auch seine Taten geheim zu halten. Man entließ ihn in die Freiheit, nun lebte er in Osnabrück und arbeitete, ich mag es kaum aussprechen, bei den örtlichen Gaswerken. Zu meinem Vater war er gekommen, weil er Hilfe suchte oder vielleicht auch nur ein offenes Ohr, denn er hatte panische Angst, vom israelischen Geheimdienst aufgespürt und entführt zu werden. Was mein Vater ihm sagte, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass er nie wiederkam.
Am schlimmsten von allen aber war der Schwiegersohn eines Großonkels. Leider wohnte er, anders als unsere sonstige Verwandtschaft, mit Frau und Tochter in der Nähe und musste daher des Öfteren am Sonntagnachmittag besucht werden. Es war schließlich Familie, meine Mutter ließ da auch nicht mit sich reden, obwohl mein Vater sie mehrfach anflehte, endlich den Kontakt abzubrechen. Dieser Mann war Ausbilder bei der Luftwaffe gewesen, er hatte die gesamte Kriegszeit in der Etappe verbracht, auf einem kleinen Militärflugplatz in der Mark Brandenburg und damit fernab jeder Kampfhandlung. Er sprach von der Nazizeit und dem Krieg wie von einem Erholungsurlaub. Wann immer mein Vater ihm widersprach und von seinen schrecklichen Erlebnissen an der Ostfront oder in der Gefangenschaft erzählte, hieß es: Markier hier nicht den dicken Mann, du übertreibst doch, es war eine tolle Zeit, erzähl uns bloß keine Märchen. So ging es jedes Mal, bis mein Vater nach dem achten Cognac schließlich in Tränen ausbrach und sich ins Nebenzimmer zurückzog, wo ihn meine Mutter wieder aufrichten musste. Um den nächsten Verwandtschaftsbesuch kam er trotzdem nicht herum.
Meine Eltern haben mich sehr geliebt, daran gibt es keinen Zweifel. Sie taten es mit einer fast berserkerhaften Zuwendung. Ich kam auf die Welt als ein verzweifelt erwartetes Wunschkind, beladen mit den Hoffnungen auf ein Glück, das ihnen selbst verwehrt geblieben war. Ich sollte es einmal besser haben als sie. Oft kam es mir so vor, als verzichteten sie dafür auf ein eigenes Leben, aber vielleicht besaßen sie ja auch schon lange keines mehr, weil es ihnen gestohlen worden war, von dem ganzen verdammten Elend, das sie erfahren hatten und das nicht mehr vergehen wollte. Die Vorstellung meiner Eltern von Glück beschränkte sich auf das, was der Krieg ihnen davon übriggelassen hatte, sehr viel mehr, als sich wegzuducken und die Zähne zusammenzubeißen, war das nicht. Zu überleben, darum ging es.
Meine Eltern waren Gezeichnete, Traumatisierte. Und obwohl es oft nicht so aussah, weil der Alltag eben weiterging, die Arbeit, das Fernsehen, Geburtstage, Weihnachten, ist es ihnen nie gelungen, aus dieser Nacht aus Panik noch einmal herauszufinden, in die sie als junge Menschen hineingeraten waren. Einmal hatte ich einen Wutausbruch und warf ihnen vor, gar nicht wirklich in der Gegenwart zu leben, meinen kleinen Bruder und mich überhaupt nicht wahrzunehmen, eigentlich seien wir beide doch überflüssig, sagte ich, ihr hängt doch sowieso in der Vergangenheit fest und betrachtet den Rest nun als eine Zugabe, mit der ihr heillos überfordert seid.
In unserer Familie blieb die Angst vor einer Wiederkehr des Schreckens immer präsent. Jede Schlagzeile von einem bewaffneten Konflikt, und sei er noch so weit entfernt, ließ besonders für meine Mutter das ohnehin fragile Gleichgewicht ihres Alltags ins Wanken geraten. Für sie war der Krieg nicht vorbei, er machte nur eine Pause. Sie traute dem Frieden nicht und glaubte nicht an seinen Bestand. Jedes Politikerinterview konnte sie in Alarmstimmung versetzen. Sie führte ein Dasein auf Vorbehalt. Besitz stand sie misstrauisch gegenüber, sie konnte sich nicht am Haben erfreuen, sondern dachte bereits an den Verlust, der unweigerlich kommen würde. Es war aussichtslos, meine Eltern zum Kauf eines Häuschens, zumal auf Kredit, überreden zu wollen. Ich gab meinen Versuch schnell auf. Sie machten keine Schulden, weil sie schon damit rechneten, sie nie wieder tilgen zu können.
Die Daseinsangst äußerte sich bei meiner Mutter über Jahrzehnte hinweg auch körperlich, als Migräne-Attacken. Dann lag sie im Bett, den Kopf umwickelt mit nassen, heißen Tüchern, jedes Geräusch verstärkte die Schmerzen, wir schlichen auf Zehenspitzen durch die Wohnung, um sie nicht zu stören. Ab und zu hörten wir sie das Bett verlassen, sie ging auf die Toilette, mit halb geschlossenen Augen, ein Geist, taumelnd, nicht mehr in der Lage, etwas wahrzunehmen. Sie stieß sich am Anblick der Welt, sogar mich sah sie dann nicht mehr.
Auch das Leben meines Vaters war grundiert von Traurigkeit. Und doch ist es kein Widerspruch, wenn ich sage, dass er gerne gelacht und Unsinn getrieben hat. Er hielt am Traum, ein Entertainer wie Peter Frankenfeld zu sein, auch dann fest, wenn das Publikum nur aus uns, seiner Familie, bestand. Beim größten Fußballspiel aller Zeiten, Deutschland gegen Italien 1970 in Mexiko-Stadt, schlug er bei den deutschen Toren vor Freude Purzelbäume auf dem Wohnzimmerteppich. Er trank gerne und viel Alkohol, manchmal auch sehr viel, einen halben Kasten Bier und eine Flasche Weinbrand an einem Tag, doch nie habe ich ihn betrunken oder verkatert erlebt. Der Alkohol schien ihm einfach nichts anhaben zu können. Dabei achtete er nicht einmal auf Qualität. Statt sich einen guten und damit teuren Cognac zu leisten, kaufte er sich lieber vier Billig-Flaschen, von denen man halb blind wurde, wenn man sie nur ansah. Eine ganz besondere Vorliebe hegte er für Pennypacker-Whisky aus dem Discounter. Auf dem Etikett stand zwar »Bourbon«, aber der Geruch erinnerte eher an Möbelpolitur. Dafür stimmte der Preis, und die Flasche war groß. Ist doch ein Schnäppchen, Junge!
Vielleicht trank er auch nur, weil er hoffte, so für einen Augenblick das Versprechen vergessen zu können, das ihm mein Opa Arthur, der Vater meiner Mutter, auf dem Sterbebett abgenommen hatte: Rudi, du musst dich um Gertrud kümmern, jetzt, wo ich’s nicht mehr kann. Und Rudi versprach es ihm. Er war von da an verantwortlich nicht nur für seine Frau, sondern auch für seine Schwiegermutter, die bei jedem Ortswechsel mitkam, in jede Wohnung mit einzog.
Meine Oma Gertrud war die lebensunkundigste Frau, die ich je kennengelernt habe. Noch viel mehr als meine Mutter fürchtete sie sich vor der Welt. Sie hatte buchstäblich Angst vor allem. Sie las keine Zeitung, sie hörte kein Radio, und wenn die Nachrichten im Fernsehen anfingen, verließ sie das Zimmer. Sie liebte ihre Familie und vor allem mich abgöttisch, ansonsten aber war sie menschenscheu und hatte weder Bekannte noch Freunde. Einer der wenigen Fremden, mit denen sie überhaupt ein Wort wechselte, war der Fleischer, er kam aus derselben Gegend wie sie und sprach dasselbe starke Niederschlesisch.
Das Resultat aus diesem Dreieck aus Vater, Mutter und Schwiegermutter war Streit. Bitterer, mieser, böser Zank über die alltäglichsten Dinge. Ich stand zwischen den Fronten und musste hilflos mit ansehen, wie mein Vater zum Spielball der Gemeinheiten der beiden sich häufig auch untereinander fetzenden Frauen wurde. Meist endeten die Auseinandersetzungen damit, dass mein Vater die Wohnung verließ. Dann ging er spazieren, heulend und zitternd vor Wut. Wie erträgst du das nur, habe ich ihn als Jugendlicher manchmal gefragt. Du musst die Alte rausschmeißen, auch wenn es meine Oma ist, die ich liebhabe. Du gehst sonst vor die Hunde! Ich kann nicht, sagte er dann, ich hab’s Arthur doch versprochen. Nichts zu machen.