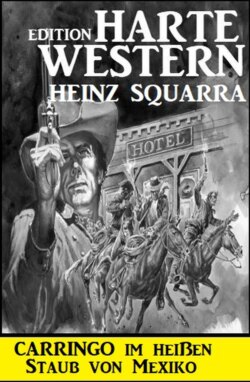Читать книгу Carringo im heißen Staub von Mexiko: Harte Western Edition - Heinz Squarra - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеDas klagende Geheul eines Kojoten schallte durch die Nacht. Es ängstigte meinen Falben so sehr, dass er immer wieder versuchte auszubrechen. Ich musste ihm den Kopf fest gegen die Brust ziehen, um das zu verhindern.
Mein Blick war nach Norden gerichtet. Im fahlen Mondschein erkannte ich ein paar niedrige Adobelehmhütten, die einen verwahrlosten und verlassenen Eindruck erweckten. Eine Brunnenmauer stand vor den Hütten. Ich hoffte, dass dort auch noch Wasser für das Pferd und mich zu finden wäre. Drumherum wucherte die Wildnis, welche die Maisfelder aufgefressen hatte und die Zäune der teilweise verfallenen Corrals als Wachstumshilfen benutzte.
Ich schnalzte mit der Zunge und lenkte den Falben auf die Gemäuer zu. Dabei beobachtete ich die Gebäude vor mir. Auch dort, wo einst der Hof des Ranchos gewesen sein musste, wuchsen Büsche und Gras wüst durcheinander.
Nichts rührte sich. Doch hörte ich lauter als vorher in mir eine warnende Stimme. Ich saß ab und führte das Pferd weiter. Über dem Brunnen entdeckte ich ein Holzgestell mit Trommel und Seilablauf in der Mitte und einer Kurbel an der Seite. Das Seil hing in den finsteren Schacht hinunter, aus dem Kühle emporstieg.
Meine Hand griff nach der Kurbel. Es war die linke Hand, weil ich mich nicht zu entschließen vermochte, den Colt loszulassen. Ich drehte. Die Trommel gab knarrende Geräusche von sich. Das Seil wickelte sich auf, und aus dem Schacht drang lautes Scheppern, wenn der Eimer von einer Wandseite gegen die andere prallte.
Er war voll mit Wasser, als ich ihn auf die bemooste Brunnenmauer zog und aus der hohlen Hand trank.
Schnaubend drängte der Falbe neben mich. Ich füllte mir noch den Hut mit Wasser und trank daraus. Dabei trat ich zur Seite, damit das Pferd an den Eimer konnte. Es musste aus ihm saufen, da keine Tränke oder etwas Ähnliches zu entdecken waren.
Nass stülpte ich den Hut auf den Kopf. Meine Blick wanderten weiter herum, und ich beschloss bereits, auf diesem verlassenen Rancho für ein paar Stunden zu bleiben und den fehlenden Schlaf nachzuholen.
Als der Falbe gesoffen hatte, führte ich ihn zu einer Scheune mit breitem, torlosem Eingang. Drinnen raschelte Stroh unter meinen Stiefeln und den Hufen des Pferdes. Ich sattelte das Tier ab, zog das Gewehr aus dem Scabbard und legte den Sattel neben den Mauerausschnitt. Ich verließ die offene Scheune und umging den Brunnen. Auch dem Wohnhaus fehlte die Tür. Zwei zersplitterte Fensterrahmen lagen im Gras. Ich schob mich in den finsteren Flur und hörte erneut die warnende Stimme in mir. Gespannt lauschte ich in das Dunkel.
Da schlug ein leises Stöhnen an meine Ohren.
Heiße Schauer jagten mir über den Rücken. Sekundenlang wusste ich nicht, ob ich vorspringen oder zurückgehen sollte.
Da war wieder das leise, kaum zu vernehmende Stöhnen eines offenbar verletzten Mannes.
In diesem Augenblick geschah noch etwas. Vor mir kratzte etwas über die alten, schmutzstarrenden Dielen. Ich sah einen hellen Fleck, glimmende Augen und undeutlich einen Hut darüber.
Eine Gestalt flog auf mich zu. Meine Spencer schwang herum und traf den Mann mit dem Kolben mitten im Angriff. Er flog nach links und schrammte gegen eine Bretterwand. Das alte Gemäuer schien zu schwanken.
Der Mann stieß sich federnd von der Wand ab. Mein nächster Schlag ging daneben. Ich empfing eine plötzlich aus dem Dunkel auftauchende Faust, verlor das Gewehr und taumelte.
Der Kerl setzte nach. Doch ich konnte mich fangen, duckte mich und rammte ihn mit der Schulter. Er fluchte lästerlich, schwankte und war sekundenlang unfähig, einen neuen Angriff zu unternehmen. Das genügte mir. Ich ging an ihn heran und setzte ihn matt.
Sein Stöhnen tönte durch das Haus. Dann sah ich einen weiteren hellen Fleck und wollte schon angreifen.
„Schlagen Sie sich auch mit einer Frau?“, fragte da eine weibliche Stimme, die zu dem hellen Fleck an der Tür des Zimmers gehörte.
Sie sprach auch texanischen Slang.
Ich musste meine Überraschung erst verdauen.
„Hier, Ihr Gewehr. Sie haben es im Flur verloren!“ Sie trat auf mich zu. so dass ich das ovale Gesicht mit den rotblonden Haaren wie eine Mähne darum deutlich erkannte, auch ihre großen, grün schillernden Augen, die an ein Raubtier erinnerten.
Ich griff nach der Spencer. „Gibt es hier kein Licht?“
„Doch.“
„Ist noch jemand da?“
„Nur der Verletzte.“
Ich trat dicht an sie heran, sah ein Flackern in ihren grünen Augen und spürte ihren Atem, der mein Gesicht traf. „Sonst niemand?“
„Sehen Sie jemanden?“
„Wie heißen Sie?“
„Jenny.“
Ich schaute sie mir genau an. Nach meiner Schätzung war sie knapp dreißig Jahre alt, aber deutlich vermochte ich das nicht zu erkennen. Dafür war das Mondlicht zu schwach, das durch die Fensterausschnitte hereinfiel.
„Holen Sie die Lampe, Jenny“, sagte ich.
„Ist gut.“ Sie trat erst zwei Schritte zurück, dann wandte sie sich um und eilte hinaus. Ihre Schuhe trafen laut die Dielen im Flur und entfernten sich. Dann knirschte Sand. Noch ein paar Herzschläge lang stand ich reglos und lauschte, weil ich erst nicht begriff, wieso sie aus dem Haus lief. Dann wieherte ein Pferd. Hufschlag schallte herein.
„Jenny!“, schrie ich und stürmte los.
Im Hof traf mich aufgewirbelter Staub. Nur noch schemenhaft sah ich die Reiterin. Ihr Pferd musste fluchtbereit irgendwo gestanden haben, wo ich es nicht gesehen hatte. So lief ich bis zur Ecke und sah zwei weitere, ebenfalls gesattelte braune Pferde im schwarzen Schlagschatten des Wohnhauses.
„Verdammt“, murmelte ich leise. Der Hufschlag war noch zu hören, wurde aber schnell zu einem davoneilenden Raunen, das im lauen Nachtwind unterging.
Ich wandte mich um, ging hinein, durchsuchte das Haus und fand eine Lampe, die ich anzündete. Im Licht der Sturmlaterne konnte ich auch Stricke finden.
Mein Gegner lag bewusstlos in dem großen Raum, der beträchtliche Mengen zertrümmerter Möbel wie eine Rumpelkammer enthielt. Ich fesselte den Mann, ohne dass er dabei erwachte. Auch die Fußgelenke schnürte ich ihm zusammen. Als ich mich danach aufrichtete und zurücktrat, um ihn nochmals genau zu betrachten, fiel mir die kurze Jacke auf, die er trug. Sie hatte einen Teil der Knöpfe verloren und war auch sonst deformiert und ausgeblichen. Aber noch war die grüne Grundfarbe des Stoffes zu erkennen – eine Uniformjacke.
Solche Uniformjacken hatten die Leibgardisten des fremden Kaisers in Mexiko getragen. Diese Leibgarde hatte sich zu einem beträchtlichen Teil aus amerikanischen Revolvermännern rekrutiert, aus vorwiegend Südstaaten-Soldaten, die nach dem verlorenen Krieg die Staaten verlassen hatten, weil dort für sie kein Job mehr zu holen war. Sie hatten nur das Handwerk des Tötens in ihrer Jugend erlernt und waren später unfähig gewesen, sich in ein anderes Leben einzufügen. Der Kaiser in Mexiko war ihre Chance.
Ich war ganz sicher, einen solchen Leibgardisten Maximilians vor mir zu haben. Einen Mann auf der Flucht vor den Juaristas, die ihn kurzerhand aufknüpfen würden, konnten sie ihn vor dem Rio Grande noch erwischen.
Ich blickte auf die Tür, durch welche die Frau geflohen war, die sich Jenny nannte. Vielleicht meinte sie, in mir einen solchen Verfolger erkannt zu haben. Denn auch auf der Seite der Juaristas gab es mehr als genug amerikanische Revolvermänner, ganz gleiche wie diesen hier, nur von einer Fügung ihres Schicksals auf die andere Seite verschlagen.
Sie schien mich für einen solchen Amerikaner von der anderen Seite gehalten zu haben. Auch sie glaubte ich nun richtig einordnen zu können. Sie war mit dem Mann vor mir auf der Flucht gewesen, und sie hatten hier für eine Weile Zuflucht gesucht. Solche Mädchen, ehemalige Bardamen aus Texas und Arizona, hatte der Kaiser von Mexiko für seine amerikanischen Leibwächter angeheuert.
Das Stöhnen aus dem anderen Raum erinnerte mich wieder an den Verletzten. So nahm ich die Sturmlaterne auf und verließ den verwahrlosten Raum.
Der Mann lag in einer schmalen Kammer auf einer breiten Holzpritsche. Es gab nicht einmal einen Strohsack darauf. Ein Schrank, der schief war und dem die Tür fehlte, stand links in der Ecke neben dem Fensterloch, in dem ein zerschlagener Rahmen mit ein paar Scherbenresten hing.
Ich nahm die Lampe hoch und trat an das primitive Lager. Die Schatten wanderten in die Höhe. Grelles Licht traf ein hohlwangiges, stoppelbärtiges Gesicht, auf dem Schmutz und Schweiß einen grauschwarzen Belag bildeten. Er trug eine grüne Jacke wie der andere. Die großen Messingknöpfe daran schimmerten im Lampenlicht wie pures Gold. Diese Jacke stand offen und war von dem grauen Hemd des Revolvermannes gerutscht. Rechts auf der Brust befand sich ein großer Blutfleck mit einem winzigen Loch mitten drin.
Das Stöhnen des Mannes verriet mir noch deutlicher als sein schmerzverzerrtes Gesicht, dass er der Hölle bereits näher zu sein schien als der Erde. Ich trat dicht an seine Seite. Die Lider des Mannes zuckten, doch vermochte er die Augen nicht zu öffnen.
Ich schaute mich noch einmal um und suchte nach irgend etwas, womit ich ihm vielleicht die letzten Stunden oder Minuten erleichtern konnte, doch ich sah auch jetzt nichts. Der andere Mann schien gar nicht erst versucht zu haben, dem Kameraden behilflich zu sein, oder er hatte auch nichts gefunden.
Wieder zuckten die Lider des Mannes, den das Licht zu stören schien. Jetzt öffnete er die Augen und schaute mich an.
„Was – Wasser!“, stieß er hervor.
„Ja.“ Ich verließ die Kammer und suchte nach der Küche, die ich ganz vorn neben der Haustür fand, konnte aber keine Wasserpumpe entdecken. Es gab auch hier nur ein paar kaum noch zu erkennende, zertrümmerte Möbelstücke, die in der hintersten Ecke einen wüsten Haufen bildeten.
Ich ging in den Hof, stellte die brennende Lampe auf den Brunnenrand und ließ den Eimer in den schwarzen Schacht hinunter. Dabei schaute ich mich in der fahlen Dunkelheit um und hoffte, die junge Frau wiederzusehen, die so jählings die Flucht ergriffen hatte. Ich konnte zwar verstehen, dass sie geflohen war, nachdem sie meinte, in mir einen Verfolger zu sehen. Aber es wunderte mich, dass sie nicht anderen Sinnes wurde und umkehrte, nachdem sie sich doch sagen musste, dass ich mich nicht wie ein Verfolger aufführte.
Sie war nirgendwo zu sehen. Ich bewegte die Trommel, auf die sich das Seil spulte. Der Eimer prallte im Brunnenschacht gegen die Wände. Dann konnte ich ihn ergreifen und auf den Rand stellen. Ich ging noch einmal in die Küche und suchte in den Trümmern nach einer Flasche. Tatsächlich fand ich eine, spülte sie im Eimer aus und füllte sie.
Der Verletzte hatte die Augen noch offen, als ich an seine Seite trat, die Lampe auf die Pritsche stellte und ihm zu trinken gab. Das Wasser lief aus seinen Mundwinkeln und grub helle Rinnen in das Grauschwarz auf der Haut. Er atmete regelmäßiger.
„Wer bist du?“ Ich beugte mich tiefer zu ihm hinunter.
Die Lippen des Verletzten zuckten. Er schien ernsthaft bemüht zu antworten, doch es gelang ihm nicht. Die Lider schlossen sich.
Ich stellte die Flasche neben den Mann, nahm die Lampe und verließ den Raum.
Der Gefesselte war bei Besinnung. Als er mich hinter der Lampe auftauchen sah, stellte er die Versuche ein, sich der Handfesseln zu entledigen.
Ich meinte, die nackte Angst in den Augen des Stoppelbärtigen zu erkennen, stellte die Lampe ab und ging dabei vor ihm in die Hocke.
„Wer bist du?“
„Der Teufel soll dich holen“, erwiderte der Kerl.
„Du hast Angst.“ Ich lächelte. „Vor mir? Oder vor den Juaristas?“
Einen Moment stutzte der Gefesselte, dann fluchte er lästerlich. Dabei irrten seine Blicke durch den Raum und in den Flur hinaus.
„Jenny ist abgehauen“, sagte ich. „Hat sich auf ihr Pferd geschwungen und ist fort. Hast du einen Namen?“ Ich lächelte den Mann auf dem Boden an.
Er dachte gar nicht daran, mir zu antworten. Weil das Stöhnen in der Kammer lauter wurde, richtete ich mich auf, nahm die Lampe mit und ging hinaus.
Der Mann auf der Holzpritsche bäumte sich von Schmerzen gepeinigt auf und fiel kraftlos auf die Bretter zurück. Feucht schimmerte der Blutfleck auf seinem Hemd.
Ich versuchte, ihn zu beruhigen, stellte die Laterne ab, gab ihm zu trinken und öffnete vorsichtig das Hemd.
Blut sickerte aus dem Einschusskanal. Die Kugel schien tief in seiner Brust zu stecken. Ihm zu helfen, erschien mir unmöglich. Deutlicher als zuvor meinte ich sein nahes Ende vor allem im ausgemergelten Gesicht und den hohlen Augen zu sehen. Ich gab ihm noch einmal aus der Flasche zu trinken, aber sein Zustand besserte sich nicht. Ein jäher Fieberschauer schüttelte ihn. Er wollte aufstehen, fiel aber kraftlos zurück, noch bevor er die sitzende Stellung erreichte. Der Schweiß rann ihm in Strömen über das hohlwangige Gesicht.
Noch ein paar Herzschläge lang blieb ich bei ihm stehen, dann nahm ich die Lampe auf und ging zu dem Gefesselten zurück. Ich stellte die Lampe an die Wand und setzte mich daneben auf den Boden. Die Müdigkeit packte mich.
Der Gefesselte starrte mich wütend an.
„Ihm ist nicht zu helfen“, erklärte ich, um irgend etwas zu sagen. „Die Wunde ist stark entzündet. Wie lange schleppt er die Kugel schon mit sich herum? Zwei Tage? Drei?“
„Geh zum Teufel!“
„Du solltest dir mal was anderes einfallen lassen.“ Ich musste gähnen. Es wurde Zeit, dass ich endlich ein paar Stunden schlief. Deswegen hatte ich diesen Rancho ja aufgesucht. Danach musste ich mir überlegen, ob ich die beiden ihrem Schicksal überließ oder was sonst geschehen sollte. Weil ich dabei wieder an den Verletzten dachte, setzte ich hinzu: „Er wird sterben.“
Der Gefesselte stützte die zusammengebundene Hände auf und setzte sich. Er rutschte zurück, bis er mir genau gegenüber an der Wand lehnte. Aber er sagte noch immer nichts.
„Ihr seid Leibgardisten des gestürzten Kaisers gewesen“, fuhr ich fort.
Die Augen meines Gegenübers schlossen sich fast völlig.
„Ihr seid geflohen und wurdet von Juaristas gestellt. Irgendwann in den letzten Tagen. Dabei hat es deinen Freund erwischt. Konntet ihr sie abschütteln oder töten?“
„Das geht dich einen Dreck an!“
„Stimmt“, gab ich zu. „Aber da wir sozusagen im selben Wagen sitzen, könnte es wichtig für mich werden. Ich bin nämlich kein Juaristafreund, wie du vielleicht denkst.“
Der Mann öffnete die Augen weiter. „Und warum bin ich dann gefesselt, he?“
„Du bist auf mich losgegangen.“ Ich stand auf, trat in den Flur und holte mein Gewehr, das dort noch an der Wand lag. Ich legte es neben mich, während ich mich an die Wand setzte.
„Wenn du nicht zu denen gehörst, dann binde mich los!“, stieß der Mann hervor.
„Langsam, langsam“, wehrte ich ab. „Ich habe Schlaf nötig und will nicht mit durchgeschnittener Kehle im Himmel aufwachen.“
„Du bist also kein Juarista, weißt, dass ich Leibgardist von Maximilian war und traust mir doch nicht, was?“
„So ist es. Lass uns weiter darüber reden, wenn es Tag wird.“ Ich gähnte wieder, schob das Gewehr ganz an die Wand und legte mich davor nieder.
Noch bevor ich einschlief, hörte ich ein Scharren auf dem Boden. Das war mein Glück. Die Müdigkeit schien meinen Verstand bereits soweit gelähmt zu haben, dass ich übersah, vor dem Mann nicht sicher zu sein. Dass er gefesselt war, nutzte gar nichts. Ich sah, wie er auf mich zu kroch. Wenn es ihm gelang, meinen Colt an sich zu bringen, war ich erledigt. So zwang ich mich, die Müdigkeit abzuschütteln und stand auf.
Unübersehbar zeichnete Enttäuschung das Gesicht des anderen.
„Zu früh gefreut“, sagte ich. „Und zu hastig gewesen.“ Ich ging zu ihm, ergriff seinen Arm und schleifte ihn zum Fenster. Mit dem noch auf dem Boden liegenden Strick band ich eine Schleife um die Fesseln an seinen Beinen, wälzte ihn zur Seite, richtete mich auf und warf den Strick über einen Dachbalken. Ich zog ihn kraftvoll straff und die Beine des Mannes dabei einen Fuß hoch vom Boden weg. Dann verknotete ich den Strick wieder an den Fesseln, wofür er gerade ausreichend lang war.
Um einigermaßen bequem liegen zu können, musste mein Gefangener sich jetzt auf den Bauch, rollen.
Ich ging zurück und legte mich nieder. „Tut mir leid. Aber das hast du dir selbst eingebrockt.“
Überzeugt, dass er nun nicht mehr versuchen konnte, zu mir zu kriechen, meine Waffen an sich zu bringen und mich ins Jenseits zu schicken, schlief ich gleich darauf ein.