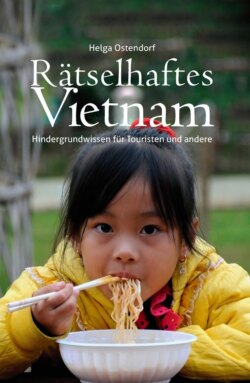Читать книгу Rätselhaftes Vietnam - Hintergrundwissen für Touristen und andere - Helga Ostendorf - Страница 5
3. Ein gewaltiger Sprung vorwärts
ОглавлениеBildung
Hinsichtlich des Bildungsstandes der Bevölkerung hat Vietnam ebenfalls einen großen Schritt nach vorn gemacht. Gleichwohl gibt es Ungleichgewichte zwischen Jung und Alt, sozialen Schichten und beruflicher und hochschulischer Bildung. Auch die Korruption spielt im Bildungswesen eine erhebliche Rolle. Und nicht zuletzt werden auch die Richtungsstreitigkeiten zwischen den Traditionalisten_innen und den Modernisierer_innen besonders deutlich.
Während nach dem Zweiten Weltkrieg die meisten Vietnamesen_innen noch Analphabeten waren, macht heute mehr als die Hälfte der vietnamesischen Jugendlichen das Abitur. Die Leistungen der vietnamesischen Schüler_innen können sich ebenfalls sehen lassen. 2012 hat Vietnam erstmals an den PISA-Vergleichsstudien teilgenommen und erreichte in Mathematik mit 511 Punkten gleich hinter Deutschland (514 Punkte) Platz 17 unter 65 Ländern (Schweiz: 531 Punkte, Österreich 506 Punkte). Der Economist (12.12. 2013) kommentierte, dieses Ergebnis sei für Bildungspolitiker_innen westlicher Hauptstädte wohl „ein wenig demütigend“.
Bildung hat sowohl bei vietnamesischen Eltern als auch bei der Regierung einen sehr hohen Stellenwert. Selbst einkommensarme Eltern versuchen, ihren Kindern das Abitur zu ermöglichen: Jedes dritte Kind aus Familien, die täglich höchstens 2,24 US$ pro Familienmitglied zur Verfügung haben, besucht ein Gymnasium. Dabei bekommt nur die Hälfte dieser Kinder ein staatliches Stipendium und nur ebenso viele erhalten eine Reduzierung der Schulgebühren oder sind davon befreit.[3]
Vietnam verwendet mit 15% seines Bruttoinlandsprodukts mehr als das Doppelte für Bildung als Deutschland. Im Fokus steht dabei auch die berufliche Bildung, wo Vietnam einen hohen Nachholbedarf hat und die eine Voraussetzung für die weitere Industrialisierung des Landes ist. Doch zwischen Stadt und Land gibt es auch in der Bildung nach wie vor ein großes Gefälle und ebenso zwischen der armen und der wohlhabenden Bevölkerung. Darüber hinaus ist unter den Älteren die Zahl der Analphabeten nach wie vor hoch.
Ältere Straßenhändler_innen zeigen einem häufig einen Geldschein, wenn es um die Frage geht, was das Gewünschte kostet. Da sie nie lesen, schreiben und rechnen gelernt haben, können sie die Zahl nicht benennen – und auf Englisch schon gar nicht. Auch ist es uns in einer ländlichen Region begegnet, dass eine Verkäuferin auf die Frage nach dem Preis für vier Dosen Cola lange rechnete und schließlich viel zu wenig verlangte. Das verwundert nicht, hat doch von den Älteren (2010: 61+) nur jede_r Zweite die Grundschule besucht und nur jede_r Vierte die Sekundarstufe I. An einem anderen Verkaufsstand ganz in der Nähe bediente uns ein 14-jähriges Mädchen (es waren Schulferien). Ihr Englisch war hervorragend und korrekt zusammenzählen konnte sie selbstverständlich auch.
Literaturtempel in Hanoi
Historisch waren die Bildungsangebote vorrangig den zukünftigen Mitarbeitern des Königs, den „Mandarins“, vorbehalten. An diesem elitären Bildungssystem änderten die französischen Besatzungskräfte wenig. Schließlich war es nicht ihr Ziel, das Land zu entwickeln, sondern es auszubeuten. Während der französischen Besatzung sollen die Bildungsmöglichkeiten sogar vermindert worden sein (Mensel 2012, 135). 1939 wechselten nur 2% der Grundschulkinder in eine weiterführende Schule. Auch den spätestens seit 1965 im Süden faktisch herrschenden USA ging es nicht um die Entwicklung des Landes, sondern ausschließlich um die Abwehr der politischen Einflüsse Chinas und der Sowjetunion. Für das ab 1954 in Nordvietnam herrschende kommunistische Regime dagegen hatte die Schulbildung der Kinder von Beginn an einen hohen Stellenwert. Es setzte erhebliche Mittel ein und 1957 war die Zahl der Grundschüler_innen im Norden bereits dreimal so hoch wie zwanzig Jahre vorher in Gesamtvietnam.
Jonathan D. London (2006, 5) unterscheidet drei Phasen der Schulentwicklung in (Nord-)Vietnam: erstens eine rapide Expansion in den 1950er und 1960er Jahren, zweitens ein geringes Wachstum in den 1970er Jahren und drittens Stagnation und Krise in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre. Wie erwähnt, hat es in jüngeren Jahren wieder einen deutlichen Schub vorwärts gegeben. Dennoch wurden in den Krisenjahren Strukturen geschaffen, die sich noch heute ungünstig auswirken.
Das Ziel der Kommunistischen Partei Vietnams (KPV) war ein Bürgerrecht auf eine zwölfjährige Schulbildung. Dieses Ziel wurde auch in den Kriegsjahren unbeirrt weiter verfolgt. In den wirtschaftlichen Krisenjahren Ende der 1980er Jahre jedoch war es nicht mehr aufrecht zu erhalten. Finanziert wurden die Schulen anteilig durch den Zentralstaat und die volkseigenen örtlichen Betriebe, die nunmehr schlicht kein Geld mehr hatten. Aus dieser Not heraus entstand die Idee, die Eltern heranzuziehen. Auf einer eigens einberufenen Sondersitzung beschloss die Nationalversammlung 1989 eine Verfassungsänderung und ließ die Erhebung von Schulgebühren zu. Diese sind seither stetig gestiegen. Jonathan D. London (2006, 12) schätzte sie Mitte der Nuller Jahre bereits auf 50% der Ausgaben für Schulen insgesamt. So berichtet Volker Breck (2012) von 370 Euro pro Halbjahr für den Besuch der Grundschule – ein halber Monatslohn eines Fabrikarbeiters. Eine andere Quelle (VietNamNews 29.8.2012) berichtet Ähnliches: 48 US$ für die Grundschule und 144 US$ für das Gymnasium monatlich. Hinzu kommen Elternbeiträge für die Instandhaltung der Schulen. Seit 1993 gibt es neben den öffentlichen auch private und halbprivate Schulen. Dort sind die Schulgebühren noch erheblich höher. Die Einführung der Schulgebühren führte unmittelbar dazu, dass viele Kinder den Schulbesuch abbrechen mussten. Erst Mitte der 1990er Jahre war der Anteil der Kinder, die eine Schule besuchten, wieder auf dem Stand von 1985. Viele, die damals ohne Schulabschluss blieben, stehen heute mitten im Berufsleben.
In der jüngeren Generation aber steigt das Bildungsniveau rasant. 2010 bereits hatten von den 15- bis 24-Jährigen nicht nur fast alle einen Abschluss der Grundschule, sondern der weit überwiegende Teil auch der Sekundarstufe I (9. Klasse). Lediglich 4% blieben ohne Grundschulabschluss. Dabei ist zu berücksichtigen, dass als Spätfolge der Agent-Orange-Bomben, die die USA eingesetzt haben, noch heute viele schwerbehinderte Kinder geboren werden. Mehr als jedes vierte Kind, das die Grundschule nicht besucht, ist krank oder schwerbehindert (ILO 2014, 12). Eine wesentliche Rolle aber spielt auch das Einkommen der Eltern. Immer noch werden Kinder nicht zur Schule geschickt, weil die Eltern die Gebühren, Schulbücher und -uniformen nicht bezahlen können.[4] Diese soziale Schieflage zeigt sich auch in späteren Schulstufen: 72% der Kinder aus armen Elternhäusern aber 88% der Kinder aus Elternhäusern, die zum reichsten[5] Fünftel der Bevölkerung zählen, besuchen die Sekundarstufe I, wobei Privatschulen anscheinend nicht mitgezählt wurden. Die gymnasiale Oberstufe besuchen dieser Quelle zu Folge nur ein Drittel des ärmsten, aber 81% des reichsten Fünftels (World Bank 2012, 76).
Verschärft wird der ungleiche Bildungszugang noch dadurch, dass privat zu zahlende Nachhilfestunden üblich sind. Bereits in der Grundschule hat fast ein Drittel der Kinder Nachhilfeunterricht; in der Sekundarstufe I ist es fast die Hälfte und in der gymnasialen Oberstufe sind es nahezu zwei Drittel (Dang 2013, 9). Nicht selten spielt Korruption mit hinein. Jede_r siebte Vietnamese_in hält das Erziehungssystem für korrupt (Tansparency International 2013): Lehrkräfte erteilen ihren eigenen Schüler_innen „Extra-Unterricht“ und kassieren dafür 2,50 bis 5 US$ die Stunde. Um das Geschäft anzukurbeln, werden sogar prüfungsrelevante Unterrichtsinhalte in den „Extra-Unterricht“ verlagert. Derartige Machenschaften scheinen so verbreitet zu sein, dass sich 2012 das Erziehungsministerium einschaltete (Dang 2013, 13). Auch scheint es Routine zu sein, dass Plätze an öffentlichen Eliteschulen für 3.000 US$ „verkauft“ werden, dem Eineinhalbfachen eines durchschnittlichen Jahresverdienstes (The Economist, 12.12.2013). Entstanden sind solche Betrügereien in der Wirtschaftskrise Ende der 1980er Jahre als Lehrkräfte zu wenig verdienten, um davon leben zu können. Zudem mussten sie oft monatelang auf ihr Gehalt warten. Für manche Lehrkräfte sind diese Extra-Einnahmen bis in die Gegenwart hinein kein Zubrot, sondern Haupt-Einnahmequelle. So berichtet Jonathan D. London (2006, 14) von einem Lehrer, der in DaNang im Jahr 2000 ein Gehalt von 40 US$ monatlich bezog und 1.000 US$ aus den „extra studies“ hinzuverdiente. Bis heute ist es nicht unüblich, dass Eltern allmonatlich mehrere hundert US-Dollar für den Extra-Unterricht bezahlen.
Abzulesen sind die Auswirkungen z.B. an Testergebnissen im Fach Mathematik: Kinder aus armen Elternhäusern, die vor der Einschulung beste Ergebnisse haben, rutschen bis zum Alter von acht Jahren dermaßen ab, dass sie schlechtere Ergebnisse haben als die ehedem leistungsschwachen Kinder der Reichen. Ihr Niveau entspricht jetzt dem bei der Einschulung schwacher Kinder aus armen Familien (Worldbank 2012, 167).
Doch selbst wenn das Abitur geschafft ist, wird es für etliche Jugendliche schwierig:
80% der 57%, die das Abitur erreichen, möchten studieren,
60% bestehen das zentral durchgeführte Eingangsexamen und
17% erhalten einen Studienplatz.
Viele gehen ins Ausland, z.B. nach Japan, Australien oder Südkorea. Auch in Deutschland hat sich die Zahl der vietnamesischen Studierenden im letzten Jahrzehnt auf heute über 4 ½ Tausend mehr als verdreifacht. Leisten können sich ein Auslandsstudium natürlich nur diejenigen mit einkommensstarken Eltern. Eine Berufsausbildung als Alternative lehnen viele ab. Vietnamesen_innen „boykottieren“ die berufliche Bildung, heißt es in den VietNamNews (3.3.2014).
Während es gegenwärtig eine größere Zahl an arbeitslosen Abiturienten_innen und auch an Hochschulabsolventen_innen gibt, mangelt es an Facharbeitern_innen und Fachangestellten. Nur 13% der 25- bis 55-Jährigen verfügen über eine Berufsausbildung – gegenüber 60-70% in Westeuropa (World Bank 2011, 10). Auch wenn man bedenkt, dass nach und nach die Ungelernten in Rente gehen und Gelernte nachrücken, ist der Aufholbedarf immens.
Zwar gibt es in Vietnam ein Berufsfachschulsystem, wo Jugendliche in drei bis vier Jahren einen Beruf erlernen können, doch möglicherweise ist der Ruf der beruflichen Bildung auch deshalb miserabel, weil es an Lernmitteln und qualifizierten Lehrkräften fehlt. Das 2008 eröffnete Berufsschulzentrum in Hau Giang (Provinz Vi Thy Districts) wurde mit Lernmitteln in Höhe von 1.245 US$ pro Platz ausgestattet (insg. 809.500 US$). Ausgebildet werden dort Reparateure_innen für Computer, „motorbikes“ und Industrienähmaschinen. Rechnet man Werkbänke, Werkzeug und das Übungsmaterial zusammen, wäre sicherlich ein Vielfaches nötig. Das 2012 gebaute Berufsschulzentrum in Ca Mau (U Minh District), an dem in acht Berufen ausgebildet wird, wurde sogar mit nur 57.500 US$ an Lernmitteln versehen (VietNamNews 3.3.2014).
Neben einer verbesserten Ausstattung scheint auch eine grundlegende Reform überfällig. So fordern Mitglieder des Ständigen Ausschusses der Nationalversammlung, dass die berufliche Bildung enger mit den Marktanforderungen verknüpft werden müsse; den Schulen müsse „erlaubt“(!) werden, verstärkt mit Betrieben zusammenzuarbeiten (VietNamNews 16.4.2014). Das klingt ein wenig nach einer Einführung des deutschen dualen Systems. Dies wäre jedoch eine Überinterpretation. Vielmehr existieren in Vietnam unterschiedliche Formen beruflicher Bildung nebeneinander, die häufig aus den Nachbarländern übernommen wurden. Aber nicht zuletzt drängen auch deutsche Firmen, die in Vietnam tätig sind, auf Reformen und führen in Absprache mit der Regierung Pilotprojekte durch. U.a. bildet die Robert Bosch AG seit 2013 Industriemechaniker_innen nach den Standards deutscher Industrie- und Handelskammern aus. Der theoretische Teil der Ausbildung findet in einem (Vorzeige-)College statt, das von der deutschen Bundesregierung parallel mit 20 Mio. US$ ausgestattet wurde (Hundt 2013). Welch ein Unterschied zur Höhe der Investitionen, die Vietnam an anderen Berufsbildungsinstituten vornimmt oder vornehmen kann!
Nicht immer aber tragen Einflüsse aus dem Ausland auch zu Verbesserungen bei. Im Zuge des Beitritts zur Welthandelsorganisation wurden private Universitäten zugelassen. Dabei scheint einiger Wildwuchs entstanden zu sein. So hat das Erziehungsministerium angekündigt, die Englischkenntnisse derjenigen überprüfen zu wollen, die dort Englisch unterrichten oder Lehrveranstaltungen in englischer Sprache abhalten (VietNamNews 8.8.2014). Mittlerweile wird die Zulassung privater Universitäten an Qualitätskriterien geknüpft.
Generell ist die Qualifikation des Lehrpersonals eher gering. An den vietnamesischen Hochschulen sind nur 10% des Lehrpersonals promoviert, 40% verfügen über ein Master-Examen und 50% über „andere“ Universitäts- und Collegeabschlüsse (World Bank 2013, 28). Eine Ursache ist sicherlich, dass die Zahl der heute über 40-Jährigen, die überhaupt eine Universität besucht haben, sehr niedrig ist. Noch niedriger ist entsprechend die Zahl der Promovierten. Der Prozentsatz derjenigen, die ein „second book“ geschrieben haben und im internationalen Maßstab als professorabel gelten, dürfte gegen Null tendieren.[6] D.h., Vietnam muss mit unterqualifiziertem Lehrpersonal – das gilt auch für die Lehrkräfte an allgemein bildenden und beruflichen Schulen – den Sprung von einem Entwicklungsland in eine Industrienation bewerkstelligen.
Im Bereich der Bildungspolitik wird nicht nur deutlich, was es heißt, ohne Geld und qualifiziertem Personal moderne Einrichtungen schaffen zu müssen, sondern hinter den Kulissen werden auch Richtungsstreitigkeiten zwischen den Verfechtern des althergebrachten, streng hierarchischen Realsozialismus und Reformer_innen deutlich. Z.B. verbot das Ministerium 2014 den Englisch-Unterricht in Kindergärten. Die Qualifikation der Lehrkräfte und die Ausstattung mit Räumen und Unterrichtsmaterial seien unzureichend. Das Verbot musste nach Protesten zurückgenommen werden (VietNamNews 26.2.2014), schließlich wollen auch die Kader der Partei, dass ihre Kinder möglichst früh Englisch lernen. Im Zusammenhang mit den anstehenden Schulbuchreformen wurde das Erziehungsministerium – in der parteikontrollierten(!) Presse – als selbstbezogen, der Vergangenheit angehörend und als „Meister der Selbstgefälligkeit“ bezeichnet (VietNamNews 16.4.2014). Das Ministerium hatte darauf beharrt, die – bisher für ganz Vietnam verbindlichen – Schulbücher selbst zu überarbeiten, während u.a. die Vorsitzende des Sozialausschusses der Nationalversammlung vorschlug, private Schulbuchverlage zuzulassen und nur noch die Qualität der Bücher zu überprüfen. Dies käme einer Umdrehung der Machtverhältnisse gleich. Das Ministerium müsste sich rechtfertigen, wenn es Bücher ablehnt.
Festhalten lässt sich, dass Vietnam über ein großes Potenzial junger Menschen mit hervorragenden Schulabschlüssen verfügt, die berufliche Bildung aber nachhinkt. Gelänge es, eine größere Zahl von SEK-I-Absolventen_innen und auch von Abiturenten_innen für eine Berufsausbildung zu interessieren, könnte „made in Vietnam“ sicherlich bald denselben Ruf wie „made in Germany“ haben, womit auch die Einkommen erheblich steigen könnten. Voraussetzung wäre allerdings, dass die Qualität der beruflichen Ausbildung deutlich angehoben wird.
Irritierend bleibt, dass in der Sozialistischen Republik Vietnam die Bildungschancen der Kinder vom Einkommen der Eltern abhängig sind und dass in einem sich „sozialistisch“ nennenden Land Schulgebühren erhoben werden. Im Erziehungswesen – so Jonathan D. London (2006, 7) – zeigt sich besonders deutlich die eigentümliche und manchmal widersprüchliche Mischung von Prinzipien, die das heutige Vietnam prägen: den leninistischen, wonach die kommunistische Partei als intellektuelle „Vorhut der Arbeiterklasse“ bestimmt, was geschehen soll, und den neoliberalen, wonach die Marktkräfte frei flotieren und letztlich regieren.
Auf den Sozialismus vietnamesischen Typs und damit auf die Zukunftschancen Vietnams werde ich noch zurückkommen. Zunächst aber werde ich auf die in Deutschland lebenden Vietnamesen und Vietnamesinnen eingehen, nicht nur weil deutsche Vietnam-Touristen_innen auch etwas über ihre Landsleute mit vietnamesischem Migrationshintergrund wissen sollten, sondern weil sich aus dem Leben von Vietnamesen_innen und Vietnam-Stämmigen in Deutschland Erkenntnisse für die Eigenheiten der vietnamesischen Kultur gewinnen lassen.