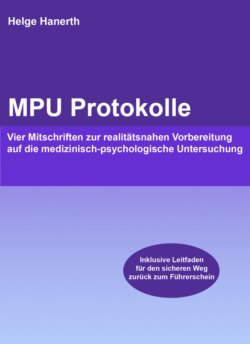Читать книгу MPU Protokolle - Helge Hanerth - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
MPU – der erste Versuch. Die psychologische Exploration
ОглавлениеDie abschließende psychologische Begutachtung nennt sich Exploration. Zu dieser Exploration lud mich etwa zwanzig Minuten später die Psychologin in ihr Büro, das dem Sekretariat sehr glich, inklusive dem Kaffeeduft. Es war angenehm wie sie versuchte, eine lockere und entspannte Atmosphäre zu schaffen. Sie fragte, ob ich mir vor Beginn draußen am Automaten nicht noch einen Kaffee ziehen wolle. Ich lehnte dankend ab.
„Ah, dann haben sie also schon Kaffee getrunken.“
Ich verneinte abermals.
„Wie kommt das?“, fragte sie nach.
Ich erklärte, dass ich gar keine Heißgetränke trank, weder Kaffee noch Tee.
„Wie werden sie dann morgens wach?“, wollte sie nun wissen.
Also erzählte ich, dass ich nicht lange schlafen konnte. Morgens trank ich dann immer kalte Frischmilch, wie ich das schon seit Lebzeiten tat. Wenn ich mich morgens beim Frühstück kurzfasste, reichte manchmal noch die Zeit zum Joggen.
„Sie frühstücken bei der Arbeit?“, fragte sie überrascht nach.
Ich verneinte abermals und erklärte, dass ich zwar schon Hunger verspüre, aber meistens siege mein Tatendrang. Wenn ich erstmal in der Arbeit steckte, vergaß ich den Hunger schnell. Sie schloss das <Warm Up> ab mit einem: „Ist ja interessant. Na dann lassen sie uns anfangen.“
Ihre erste Frage lautete: „Welche bei der ärztlichen Untersuchung aufgeführten Trinkereignisse als Teenager müssen wir noch ergänzen? Bei ihnen ist das ja schon lange her. Da gibt es natürlich Erinnerungslücken. Trotzdem ist das hier wichtig. Pubertät ohne Alkohol ist so wahrscheinlich wie ein Jackpot im Lotto. Das ist leicht erklärbar, wenn man bedenkt, dass der Weg zur Adoleszenz durch die Pubertät eine Sturm und Drang Zeit ist. Aktuelle Untersuchungen bestätigen, dass weit über neunzig Prozent der Teenager Erfahrung mit Alkohol haben.“
Ich zeigte mich überrascht und sagte: „Ich habe nicht gedacht, dass das so viele sind. War das auch schon so zu meiner Zeit? So Rituale wie Komatrinken, dachte ich, seien eine neuzeitliche Erscheinung.“
„Es mag da kleine Abweichungen geben“, antwortete sie und schaute mich wieder fragend an. Ich spürte, dass ich hier mit weiteren Trinkmengen eine Erwartungshaltung befriedigen konnte. Der wohlwollende Frageton zeigte mir, dass der Mut zu einem solchen Eingeständnis positiv ausgelegt werden würde. Ich befand mich also wieder in dem gleichen Konflikt wie beim Arzt, als der nach den Trinkgewohnheiten bei der Bundeswehr fragte. Ich zögerte. Ich hatte schon wegen meiner Antworten beim Arzt Bauchschmerzen. Ich hatte weiterhin Zweifel an meinen Angaben, zu denen ich mich ihm gegenüber hatte hinreißen lassen. Dann entschied ich mich, nicht zu <pimpen> (aufzumotzen), auch wenn die Wahrheit viel mehr Überzeugungsarbeit benötigte. Das war in erster Linie keine taktische, sondern eine Gewissensentscheidung. Die Wahrheit durfte nicht wieder auf der Strecke bleiben.
Also holte ich weit aus und begann meine Antwort statt mit zusätzlichen Trinkmengen, mit einem Rückblick auf eine traumhafte, alkoholfreie Kindheit. Die verbrachte ich in der Nähe einer Kleinstadt umgeben von Äckern, Weiden und Wald. Astrid Lindgren hätte unsere Siedlung vielleicht Bullerbü genannt, denn etwa so wie in ihrem Buch der Kinder von Bullerbü, erlebte auch ich meine Kindheit. Ich hatte meinen eigenen Gemüsegarten, half im Spätsommer bei der Obsternte, ging Bauern beim Heumachen zur Hand, tobte durch den Wald, baute Baumhütten, fing Frösche und Molche und spielte mit anderen Rabauken Fußball auf der Straße oder Eishockey im Winter auf einem gefrorenen Fischteich. Hier entschied ich, dass ich später Naturforscher werden wollte und dass ich Expeditionen und Reisen in die Südsee unternehmen würde. Aber vor allem wollte ich später einmal wie die Bussarde, die ich oft im Gras liegend beobachtete, fliegen.
Diese Wünsche und viele andere aus dieser Zeit, sollten später tatsächlich wahr werden. Ich arbeitete kontinuierlich daran. Meine Träume sollten keine Schäume bleiben. Einige Träume bestimmen mein Leben noch heute so sehr, das ihre Umsetzung in Arbeit ist.
Etwa in der siebten Klasse wurde an meiner heilen Welt gekratzt. Vor allem von progressiven Lehrern die mich in die Pubertät zwingen wollten und von Freunden, denen die Pubertät den Kopf verdreht hatte. Ich wollte von all dem nichts wissen. Ich fand die Zeit für etwas Neues war für mich noch nicht reif. Das machte mich in der Schule zum Außenseiter und Streber und in unserer Siedlung zum Eigenbrötler. Während die anderen neuerdings sich mit Mädchen im Jugendzentrum trafen, zimmerte ich eben alleine an Nistkästen für Meisen oder Bilche und baute Dämme in einem Graben, um die Entwässerung einer Feuchtwiese zu verhindern, in der Ringelnattern lebten.
Ich möchte betonen, mich störte nicht was die anderen machten. Manche von den Anderen hatten auch ganz nette Seiten. Es störte mich aber sehr, dass ihre Cliquen und vor allem ihre kraftmeiernden Anführer sich gewaltig an jedem Nonkonformisten aufrieben. Da ich nie einlenkte, sondern aggressiv meine Freiheit verteidigte, wurden die Fronten immer härter. Ich wollte mich nicht an ihr Gehabe und ihre Anschläge gegen mich gewöhnen. Sie waren einfach nur peinlich, ganz besonders wenn Alkohol ins Spiel kam. Ein Zwischenfall nachts im Herbergszimmer der Jungen während einer Klassenfahrt, ärgerte mich so sehr, das ich alle weiteren Ausflüge bis einschließlich der zehnten Klasse boykottierte. Ich fand es so unmöglich, dass die Jungs in ihrem Alkoholrausch überhaupt nicht erreichbar waren. Was ich auch versuchte, wurde mit blödem Kichern beantwortet. Das zog sich über Stunden hin. Mir war keine Gegenwehr möglich und verpfeifen ging natürlich auch nicht. Solche Ereignisse entwickelten eine Aversion in mir gegen diese Schüler und gegen den Alkohol, der sie so machte. In solcher Gemeinschaft mochte ich nicht mittun. Die waren mir zu krass. Die waren doch nicht sie selbst. Jeden Genuss von Alkohol meinerseits hätte ich als Verrat meiner Identität empfunden. Für sie wurde ich so zum <Unberührbaren>. Mir wurde es egal, denn schließlich hatte ich mich und das was ich wollte. Ich war zufrieden und ganz im Reinen mit mir, gerade ohne pubertäre Bedrohung. Verbiegen mussten sich die anderen, wenn sie unbedingt <hipp> sein wollten. Ich wollte von ihrer Welt und von den Attributen ihrer Welt nichts wissen. In dieser Zeit wurde Alkohol für mich zum Symbol für pubertierende Spinner.
Parallel zu diesen Erlebnissen begegnete ich im Sportverein und der Musikschule netten Teenagern, mit denen ich eine gemeinsame Leidenschaft teilte und Alkohol nie eine Rolle spielte. Ich empfand Glück im aktiven Tun um ein Interesse. Sportliche Erfolge verstärkten meinen Ehrgeiz für ein Anliegen zu kämpfen.
Bis auf die zwei Biere, zu denen ich in der dreizehnten Klasse als Wahlhelfer bei einer Landtagswahl eingeladen wurde, habe ich damals keinen Alkohol konsumiert.
Alkohol spielte erst wieder bei der Marine eine Rolle. Während meines ersten Bordkommandos auf einem Minensuchboot wurde der langjährige Kommandant wegen seiner Gelbsucht vom Borddienst befreit. Ursache sei eben die <Seemannskrankheit> gewesen. Dass gehöre zu einem Seefahrerleben dazu wie der Tripper, war seine offene Überzeugung. Einige Wochen zuvor hatte er noch mit einigen Mitstreitern eine Löschschaumschlacht mit der Wache des gegenüber an der Schwimmpier festgemachten Bootes gemacht. Danach musste der Verlierer einen Kasten Bier springen lassen, der sogleich gemeinschaftlich getrunken wurde, um den Waffenstillstand gebührend zu feiern.
War ich hier noch unbeteiligter Zuschauer, so konnte ich mich bei meinem zweiten Bordkommando dem Zwang der Decksgemeinschaft nicht ganz entziehen. Auf der Fregatte traf ich auf Kameraden, die mit ganzer Kraft genau die Vorurteile bestätigten, die ich in der Schule mit trinkenden Mitschülern gemacht hatte. Sie waren eine Horde sich unheimlich stark fühlenden Besserwisser, die Andersdenkende nicht nur nicht tolerieren konnten, sondern gerne gröhlend vorführten und lächerlich machten. Ich habe verhalten mitgetrunken, so zurückhaltend wie möglich. Berauscht war ich nie. Das war wichtig. Unter anderen Umständen wäre ich vielleicht neugierig geworden, wie sich das anfühlte. In dieser Situation musste ich aber absolut die Kontrolle behalten. Die Angst vor gewalttätigen Eskalationen lag immer in der Luft, und die waren schließlich in der Mehrheit. Mein Widerwille gegen die Typen wuchs, wenn wir auf See waren. Mit zollfrei erstandenem Whisky aus dem Bordladen feierten sie und erzählten dann wilde Heldengeschichten von ihren Großvätern in der Wehrmacht. Ein falscher Kommentar meinerseits in dieser Runde, führte zwangsläufig zu einer höchst willkommenen Keilerei.
Die hier gemachten Erfahrungen waren so einschneidend, dass ich den Rest meines Lebens Alkohol in Gesellschaft meide. Ich lernte so aber auch die Vorteile zu schätzen, wenn man bei zurückhaltendem Genuss in einer Gruppe die Kontrolle behielt und taktieren konnte. Danach blieb mein Konsum bis auf eine Silvesterfeier über Jahrzehnte nahezu alkoholfrei.
Die Silvesterfeier fand in meiner Unterkunft statt. Der einzige Gast war ich. Bedingt durch meinen Tausch des Wachdienstes, hatte ich nicht wie die Soldaten meiner Einheit über die Feiertage frei.
„Warum trinken Sie allgemein so wenig?“
„Meine <One-Man-Party> war nur kurz lustig. Danach schlief ich schnell ein ein, um mit heftigstem Kater am nächsten Morgen aufzuwachen. Fast wäre mein Plan für eine große Unternehmung an diesem freien Tag geplatzt, weil mich der Kater bis in den Nachmittag lähmte. Die Unternehmung war immerhin der Grund für meinen Wachtausch gewesen. Der Ausgang dieses Alkoholereignisses lieferte keinen Grund zur Wiederholung. Das Thema Alkohol als Spaßmacher war damit abgehakt. Der Alkohol hatte meine Erwartungen nicht nur nicht erfüllt, sondern meine Pläne gefährdet. In meinem weiteren Leben etablierte sich gerade Alkoholfreiheit als ein Qualitätsfaktor für Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Nur alkoholfrei konnte ich meine Pläne und mein Tageswerk verrichten. Nur alkoholfrei konnte ich meine Sinne so beisammen halten, dass ich Ideen und Kreativität entwickeln konnte. Die Kraft der Arbeit war stärker als Alkohol, weil sie sinngebend war. Ich erfüllte durch sie eine Aufgabe an mir selbst und gab Nutzen. Ich machte keine dauerhaften Kompromisse am Sinn. Ich arbeite nicht nur, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Deswegen suchte ich auch nach Feierabend noch Herausforderungen, die mir Wahrnehmungstiefe und das befriedigende Gefühl gaben Nutzen zu stiften. Während eines Tages rief ich mir immer wieder mein Tagesprogramm ins Bewusstsein. So behielt der Tag eine Struktur, die ich auch noch permanent optimieren konnte. Mit meinem Handeln gab ich mir Sinn. Das brachte mich gut drauf und machte mich dankbar für jeden Tag. Ich freute mich über das, was ich schon erledigt hatte, prüfte Planänderungen und checkte mein Timing. Wenn ich mehr als die Hälfte meines Tageswerks geschafft hatte, wurde ich bei meinen Planspielen schon mal euphorisch. Wenn die Zielgerade in Sicht kam, wuchs die Lust neue Pläne zu stricken. Nichts war befriedigender, als mit einem Rückblick auf einen erfolgreichen Tag abends möglichst total erschöpft ins Bett zu sinken.“
„Also Alkohol ist Ihnen nicht das Wichtigste?“, kam die nächste Frage.
„Das Wichtigste?“ wiederholte ich ungläubig. „Alkohol ist doch beileibe nicht das Wichtigste. Dafür kann Alkohol zu wenig. Alkohol brauchte Jahrzehnte um wieder eine Chance bei mir zu finden. Und da war er nur Ersatzspieler für andere Leidenschaften, die vorübergehend brachlagen. Der Alkohol sprang ein, um eine betrunkene Zufriedenheit zu schaffen, in der es mir relativ egal wurde, dass wichtige Dinge vorübergehend ungeregelt blieben. Das war doch auch schon so bei meiner Silvesterparty alleine auf der Bundeswehrstube gewesen, wo ich auf diese Weise Langeweile und Einsamkeit für eine Nacht tötete. In jedem Rausch bleibt die Sehnsucht nach einem mehr, das nicht durch mehr Alkohol befriedigt werden kann. Das lässt mich lieber nach Alternativen suchen. Das Surfereignis am Tag nach der Silvesterfeier war so eine Alternative. Wichtige Leidenschaften bieten eben mehr. Deswegen musste Sehnsucht zurückbleiben, wenn ich stattdessen während der Schwangerschaft meiner Frau zum ersten Mal Alkohol täglich trank. Vor allem aber blieb unter Alkoholeinfluss die Sehnsucht nach Bedeutung oder wie es der Wiener Psychologe Viktor Frankl (Frankl, Viktor E.: „… trotzdem Ja zum Leben sagen“, Kiesel Verlag 2009) formuliert hat, die Suche nach einem weitergehenden Sinn unbefriedigt. Dem Alkohol genügt der Moment. Alkohol feiert nur sich selbst. Jede Bedeutung ist aufgeplustert und jeder interessante Gedanke ist einen Moment später wieder vergessen. Am Tag darauf kann man auf nichts Substanzielles mehr zurückgreifen. So wurde mir der größte Nutzen vom Alkohol, dass er mich gut einschlafen ließ. Damit war mein Drang etwas zu unternehmen erst mal aufgelöst und alle Hoffnungen auf Taten einfach nur vertagt.
Stärker als Alkohol war immer ein aktiver Kick. Nur aktive Kicks schaffen das Bewusstsein, das Erkenntnisfähigkeit braucht. Nur sie machen geistige Verliebtheit möglich. Musik zu hören konnte wunderschön sein. Musik zu spielen oder nach Musik zu tanzen war aber eine viel tiefer gehende Erfahrung. Alkohol schaffte es nicht diese Gefühlszustände nachzubilden. Alkohol konnte nicht mal den Genuss der rein vom Band gehörten Musik verbessern, weil mit zunehmender Alkoholwirkung die musikalisch, harmonischen Details verblassten. Alkohol verstärkte nur die allgemeine musikspezifische Stimmung. Ich hatte z.B. kein Gehör mehr für Anschlag und Phrasierung des Pianisten. Bestimmte Hirnbereiche, die dafür sensibilisiert sind, fingen an zu rebellieren. Sie forderten ihr Recht auf einen musikalischen Genuss. Ruhigstellen konnte ich sie nur, in dem ich sie auf Morgen vertröstete, wenn mich Alkohol und Kater verlassen hatten. Erst dann würden wieder nachhaltige Aktivitäten möglich sein, an die man sich gerne zurück erinnerte. Alkohol feierte nur den Moment. Ich konnte mich an kein einziges Erlebnis in meinem Leben erinnern, bei dem Alkohol eine Rolle gespielt hat, das in meinen Erinnerungen angenehm nachwirkte und wenigstens ein nostalgisches Gefühl hinterlassen hat.
Alkohol tötete nach kurzem Höhenflug jede Kreativität. Schon nach etwa einer dreiviertel Stunde wurde das Denken anstrengend. Die Ideen waren weg und mit ihnen jede Muße. Man konnte nur noch passiv genießen.
Solange es noch Restenergie gab, verrichtete ich lieber leichte Tätigkeiten. Dies war der Moment, wo ich entweder meine Reisekostenabrechnung machte, oder das Haus putzte. Solange man nichts Wichtigeres erledigen musste, konnte ich mich mit diesem Procedere vorübergehend abfinden. Ansonsten trieb mich der Ärger über unerledigte Angelegenheiten am nächsten Tag zu masochistischen Handlungen, bei denen ich mir bewies, dass mein Geist und dessen Wille die oberste Instanz in meinem Körper sind. Entschlossenheit und Leidensfähigkeit waren immer wesentlicher Teil meiner Erfolge gewesen. Das kannte ich schon vom Sport nicht anders.“
„Sie haben alkoholisiert geputzt?“, kam eine amüsierte Nachfrage.
„Ja natürlich. Beim Putzen erlebte ich mein Haus. Ich nahm es als Habitat war. Ich befühlte mit dem Putzen was ich bewohnte. Ich entdeckte, dass das was ich hatte, schön war und freute mich gerade beim Putzen hier an diesem Ort zu sein. So gewann die banale Tätigkeit eine Zen-Dimension. Nur das Bürsten der einzelnen Fliesen und das Imprägnieren des Parketts (im ganzen Haus gab es keinen Teppichboden), blieb eine ungeliebte Arbeit. Grundsätzlich ging es auch beim Putzen um die Schönheit im Tun. Die Monotonie der sich wiederholenden Handlungen beim Putzen beruhigte und machte zufrieden. Langes Putzen war aber schon langweilig. Das ging mit Alkohol viel besser. Der Rausch nahm das Gefühl passiv zu sein.“
„Was bedeutet ihnen Alkohol?“
„Alkohol bedeutete Ersatz für andere Freuden während der Schwangerschaft meiner Frau. Ich fand aber so nach und nach auch neue Aspekte. So wurde Alkohol auch zur Belohnung für eine gute Leistung. Wenn ich trank, dann hatte ich mir das verdient. Ich schaute zurück auf den Tag. Ich feierte meine Leistungen und mit ihnen mich selbst. Das war erlaubt, denn nicht viele Chefs sind gute Chefs. So ersetzte der Alkohol deren Inkompetenz oder Ignoranz. In meinem Job gab es ein vergleichendes Ranking. Ich gehörte immer zu den Top10 unter den Mitarbeitern. Lob und ein Präsent bekamen aber nur die Plätze eins bis drei.
Alkohol konnte aber auch sehr gut Tatendrank kompensieren. Dann wurde man müde und genügsam und war mit Fernsehunterhaltung zu frieden oder träumte stattdessen von tollen Aktionen in ferner Zukunft.“
„Ihr Anlass zum Trinken war die Schwangerschaft ihrer Frau?“
„Richtig, und die Schwangerschaft leitete auch das Ende der Trinkphase ein.“
„Warum haben sie früher so wenig getrunken?“
Hatte ich die Frage nicht schon beantwortet? Ich ging also von einer Kontrollfrage aus und sagte: „Weil ich glücklich war. Das Glück war mit Alkohol nicht zu toppen. Gleichwohl war die Monotonie der neuen Häuslichkeit zu toppen, die die Schwangerschaft begleitete. Es war nichts mehr los. In allen Lebenslagen drängt es mich zu einer aktiven Rolle. Ich kann zu Hause nicht mal Musik hören, ohne mich nicht zwischendurch ans Klavier zu setzen, um wenigstens mal eine Melodie nachzuspielen oder nach den passenden Akkorden zu suchen.
Vor allem aber fehlte mir der Sport. Mit Sport konnte ich selbst einem misslungenen Tag etwas Aufregung abringen. Auch entschädigte Sport für Misserfolge und kompensierte Stress. Sport generierte neue Kraft und Lust. Sport war seit meiner Kindheit täglich da. Sport war so wichtig wie das Atmen. Sport hat meinen Charakter geprägt. Ehrgeiz, Ausdauer, Leidensfähigkeit und Siegeswille haben sich mir erst durch Sport so richtig tief eingebrannt. Ohne das Wohlgefühl beim Sport ist ein Tag nicht vollständig.“
„Sie hatten also keine Lust das Trinken fortzusetzen?“
„Auf Dauer erwarte ich mehr von einem Tag als Alkohol bieten kann. Alkohol schafft nichts, an das man sich gerne zurück erinnert. Auch den Endorphin-Kick beim Sport kann Alkohol nicht erreichen. Und meine neue Familie kann ich ohne Alkohol viel detaillierter wahrnehmen. Ich nehme viel mehr Facetten im Verhalten meines Sohnes wahr, als das mit Alkohol möglich wäre. Vor allem wird mein Sohn mir erst so zu einem unfassbaren Mysterium. Das Ende des Trinkens war der erwartete Startschuss, um in mein altes, neues Leben zurückzukehren.
„Welche seelischen Belastungen gab es während des Trinkens?“
„Ich sah nur die eine Belastung, die Umstände der Schwangerschaft vorübergehend ertragen zu müssen. Da das Ende dieser Zeit absehbar war, konnte ich mit der Belastung gut leben. Es galt nur die Zeit zu überbrücken. Andere dauerhafte Belastungen gab es nicht. Das wäre auch eher kontraproduktiv gewesen und widersprach meiner leicht aneckenden, ungeduldigen Natur. Probleme waren Herausforderungen sich zu beweisen. Gerade im Berufsleben waren sie Kick und nicht Belastung. Immerhin wurde ich als Projektleiter für das Lösen von Problemen bezahlt. Weitere private, seelische Belastungen gab es auch nicht. Ich war von niemand abhängig. Ich hatte immer die Freiheit, Dinge zu verändern, die mir nicht passten. Es wäre selbst legitim gewiesen, meine Ehe zu beenden, wenn man sich vergeblich um einvernehmliche Lösungen bemüht hätte. Nur in der Schwangerschaft und kurze Zeit danach, war mir das ein Tabu. Für das Arbeitsleben und auch privat gilt, dass es immer eine Alternative gibt für die man sich entscheiden kann, für eine andere Firma wie für einen anderen Partner. Es gab also außerhalb der Schwangerschaftszeit, keinen Grund nicht nach dem zu greifen, was einen glücklicher gemacht hätte.“
„Wie wirkte sich die Zäsur durch den Führerscheinentzug auf Ihr Leben aus?“
Nach kurzem Überlegen erwiderte ich: „Stillstand! Ich fühlte mich ausgebremst. Die Leere war unerträglich. Ich wurde nicht gefordert. Ich drehte nur noch an kleinen Rädchen. Es war ein Gefühl, als wollte man eine neue Sprache lernen, z.B. Dänisch, und im Unterricht beginnen sie in aller Ausführlichkeit mit dem kompletten Alphabet, das nur in kleinen Teilen anders ist als im Deutschen. So etwas ist doch nicht auszuhalten. Ich pflegte deswegen meine Hobbys in einer Weise wie lange nicht mehr. So gewann mein Leben wieder an Fahrt.“
„Haben sie da gefühlt, das Trinken eine Alternative sein könnte?“ Meine Antwort war klar: „Nein – es gab ja genug Alternativen, die potenter waren. Und ich hatte nicht vergessen, dass Alkohol kein vollständiger Ersatz für einen aktiven Kick sein konnte. Die Scheinwelt des Alkohols hielt nie lang und führte nur in den Schlaf. Spätestens nach einem Kater war alles wieder so wie vorher. Nur mit aktivem Handeln schaffe ich. Selbst im Vergleich zum simplen Joggen, verlor Alkohol hinsichtlich seines Spaßfaktors. Joggen ist eben auch ein aktiver Kick.“
„War und ist ihr Trinkverhalten überlegt, vielleicht sogar kontrolliert?“
„Ja, denn ich trank nur nach Plan. Jeden Abend mache ich mir Gedanken über den nächsten Tag. Meist begann ich mit einer Reflektion des abgelaufenen Tages. Ich nenne das meinen sokratischen Monolog. Mit einem Plan im Hinterkopf gehe ich dann in den folgenden Tag. Größere Änderungen gehen dann nicht mehr. So etwas müsste ich erst mal überschlafen. Sokratische Monologe ergeben sich ganz automatisch beim Einschlafen, wenn man im Bett liegend den Tag Revue passieren lässt. Man genießt die frische Erinnerung an das Getane und freut sich auf die Fortsetzung am nächsten Morgen. Der Erinnerung folgen dann Verbesserungsvorschläge und Planungen.
Der sokratische Monolog ist ganz nebenbei eine selbstdiagnostische Methode mit integrierter Evaluation. Schließlich ist nur das geprüfte Leben wert gelebt zu werden. Ich will meine begrenzte Lebenszeit nutzen. Außerdem macht es Lust aufs Leben, wenn ich den Genuss des Erlebten durch Erinnerungsschleifen möglichst lange nachwirken lasse.
Nie entschied ich mich unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug zu führen. Die Alkoholfahrt war das Ergebnis einer nüchternen Überlegung. Ich wollte beim Termin mit dem Chef am nächsten Tag ein flaschenfreies Auto haben. Das entsprach meinen Ordnungsprinzipien. Ich stieg nach schnellem Trinken sofort und noch ohne Alkoholwirkung ins Auto im Glauben ohne Blutalkohol zu Hause anzukommen, wenn das Zeitfenster klein blieb. Nur mit dieser Möglichkeit konnte ich überhaupt von meinem normalen Procedere abweichen.
Andere Regeln verboten das Lagern von Alkohol im Haus oder legten Trinkmengen zwingend bereits am Vortag fest. Trinken wurde so zu einer bewussten und als sicher empfundenen Entscheidung. Die Regeln legitimierten mich, jede eventuelle Versuchung von mir zu weisen. Dazu sind doch Regeln da.
Die Entscheidung zu trinken fiel immer am Arbeitsende. Zu erst musste ein Tageswerk geschaffen werden, das zum Trinken berechtigte. Für jedes Trinkereignis musste Alkohol neu gekauft werden. Der wurde in zwei bis drei Dosen aufgeteilt. Die erste Dosis trank ich im Auto in der Garagenauffahrt oder in der Garage. Danach stellte ich mein Fahrrad hinter das Auto und schloss das Garagentor. Wollte ich die zweite oder dritte Dosis konsumieren, musste ich in die Garage gehen. Dieser Umstand zwang vorher zur Beantwortung der Frage, ob das denn wirklich sein musste. Um dem Wunsch nach einer weiteren Dosis nachzugeben, hätte ich beim Öffnen der Garage mein Fahrrad griffbereit vorgefunden. Die Entscheidung das Auto für den Kauf weiteren Alkohols zu nehmen, wäre nur möglich geworden, durch das absichtliche Wegschieben des Fahrrads. Eine solche Entscheidung wäre sehr dumm gewesen. Es gab eine Tankstelle und einen Kiosk in kurzer Entfernung.
Kontrolle ist mir in jeder Beziehung wichtig. Sie ist das beherrschende Merkmal für ein selbstbestimmtes Leben. Ich denke also bin ich. Wobei denken immer eine Einheit bildet mit Kontrolle. Reflektion und philosophische Redundanz sind die Basis für autonomes Handeln. Nur wenn sie gegeben sind, fühle ich mich sicher und souverän. Deswegen lasse ich mich nicht auf ein Abenteuer ein, dessen Ausgang ungewiss ist. Ich schließe ungerne eine Tür hinter mir, wenn ich nicht weiß, was mich erwartet. Beim Surfen in der Brandung oder beim Fallschirmspringen beispielsweise, gibt es deswegen klare Grenzen. Aber gerade beim Gleitschirmfliegen wo ich weniger Erfahrung habe, sehe ich mich deswegen als bekennenden Sonntagsflieger, der natürlich nur bei Schönwetter fliegt.“
Ich erzählte weiter, dass Kontrolle mir Freiheit gebe. Wenn die sich gehen lässt, läuft sie Gefahr sich in Freiheit zu verlieren und trotz maximaler Freiheit sich auf die eine Freiheit, zum Beispiel sich zu betrinken, zu reduzieren. Friedrich Nietzsche hat das bestätigt mit seinem Zitat, dass erst das bewusste Beschränken der Freiheit, also ihre Kontrolle den Blick freihält für die Freiheit neben der Freiheit (Vgl. Nietzsche, Friedrich: „Sämtliche Werke“, hrsg. v. G. Colli und M. Montinari, Berlin 1980).
Mit solchen Erkenntnissen schaffe ich durch Kontrolle die Sicherheit, die ich im Leben brauche. Das tue ich schon von Kindheit an. Als Kind half mir Kontrolle Fehler zu vermeiden und Leistungen zu optimieren. Zur katholischen Fastenzeit vor Ostern half mir Kontrolle die Erwartungen der Erwachsenen zu erfüllen. Natürlich verweigerte ich vier Wochen lang sämtliche Süßigkeiten. Das musste niemand überwachen. Ich hatte geradezu Spaß an Kontrolle und somit eher ein Problem damit aufzuhören. Ich fühlte Macht in mir, wenn ich Kontrolle hatte.
Kontrolle ist bei mir ein mächtiges Instrument, mich vor selbstverschuldeter Unmündigkeit zu schützen. Ich genieße es. Ich genieße diese Kraft, die einen mentalen Ursprung hat. Ihr fehlt etwas das Körperliche. Das geht aber in Ordnung. Als Teenager mochte ich keinen Sex. Meine leidenschaftlichen Gefühle machten mir Angst. So bin ich tatsächlich bei einer ersten Möglichkeit auf Sex aus dem Zimmer einer Freundin geradezu geflüchtet. Danach habe ich auf Jahre meine Enthaltsamkeit fortgesetzt. Mit Leistungssport gelang es mir gut, Leidenschaft, die mein Hirn und meine Kontrolle auszuschalten drohten, zu bändigen.
Das besondere an der Leidenschaft im Sport ist, das sie andere Farben hat. Sie macht wach und aufmerksam. Man ist ganz besonders konzentriert. Ich kann dann leichter knifflige Aufgaben lösen. Heute ist Sex für mich okay. Es ist mir eine Routine geworden. Routinen geben in ihren Wiederholungen Kontrolle. Wenn die sichergestellt ist, darf es auch wieder kleine Ausbrüche von Leidenschaft geben. Das wirkt sich auch auf mein Trinkverhalten aus. Auch deswegen kann ich nicht so einfach weitertrinken, wenn ich den gewohnten Pegel erreicht habe.“
Ich erzählte nochmals von meiner Panik vor Kontrollverlust bei meiner Trunkenheitsfahrt. Das Ereignis war mir gerade deswegen zum Trauma geworden, weil die Kontrolle entglitt. Das Außergewöhnliche an der Situation war, das sie sich von anderen Situationen, in denen ich Angst gehabt hatte, unterschied. Beim Bergwandern in schwierigen, stark ausgesetzten Klettersteigen hatte mich Angst nie gelähmt. Sie hat mich stattdessen hellwach und aufmerksam gemacht. Sie hat mich noch vorsichtiger agieren lassen. Sie generierte sogar eine Art Befriedigung als Risikomanager fungieren zu können. In der Panik der Trunkenheitsfahrt aber merkte ich, wie in mir etwas anderes die Regie übernehmen wollte. Der Verstand gab seine Autonomie an eine andere Institution ab. Die Entscheidung vielleicht weiterzufahren, konnte ich nicht mehr treffen, weil der Verstand nicht die Entscheidungsgewalt hatte. Die Panik hatte das Sagen und die sagte Nein. Das machte mich ja so wütend gegenüber Vorwürfen, ich hätte in berechnender Absicht das Ziel verfolgt, betrunken nach Hause zu fahren. Da wurde, vielleicht unwissend, unterstellt, was nicht möglich war.
„Wie empfinden sie Abstinenz?“
Ich musste lange überlegen. „Ich verbinde mit meiner praktizierten Abstinenz kein Gefühl. Sie ist eher passiv. Ich bin einfach mit meinem aktiven Leben so beschäftigt, dass ich an anderes nicht denken mag. Es ist wieder alles so wie vorher. Mein Leben ist so, wie fast mein ganzes Leben immer war. Seit frühester Kindheit ist mein Leben geprägt durch so viele ansteckende Aktivitäten. Neben dem Musizieren und Leistungssport sind da noch das Entwickeln meiner Fotos, früher im eigenen Labor und heute am PC, Fernreisen mit dem Rucksack, das Schreiben und jetzt auch noch Frau und Kind.“
„Ist das auch so die Reihenfolge? Ich meine das Frau und Kind zuletzt kommen?“
„Ja“, musste ich eingestehen. Vor allem Sport und Musik bedeuteten mir noch mehr als Frau und Sohn. Nichts anderes lässt mich so sehr mich erleben. Musik und Sport sind transzendal. Ich freue mich sehr gerade mit dem wiedergewonnenen Sport mein Leben wieder vollständig zu haben. Andererseits hatte ich das während meiner feierabendlichen Trinkphase auch immer erwartet, dass das wieder so wird. Ich konnte mir das Trinken nur erlauben, weil ich wusste, dass ist rein temporär. Ich wusste, dass mein Leben stark deterministisch geprägt ist. Das gibt doch den Rahmen vor. Fast alles, was ich heute noch tue, ist eine Fortsetzung der Ideen und Träume, die ich als Kind und Jugendlicher entwickelt habe. Da drin gab es keinen Alkohol. Das Trinken konnte deshalb nur ein Intermezzo sein. Natürlich beeinflusst mich auch mal was Neues, schließlich lebe ich nicht isoliert in dieser Welt. Aber meine Interaktionen fördern nur wenig grundlegend Neues. Meist sind es Variationen alter Leidenschaften aus der Kindheit. Ich bin Naturwissenschaftler geworden weil, ich als Kind Fossilien aus dem Kalkstein gehauen habe und im Wald Tiere beobachtet habe mit meinem Spektiv. Meine berufliche Tätigkeit ist auf dem ersten Blick primär betriebswirtschaftlich ausgerichtet, ihr liegen aber biochemische Produkte und Anwendungen zu Grunde. So ist mein Beruf letztlich eine Variation eines in der Kindheit generierten naturwissenschaftlichen Interesses. Selbst meinen Kindheitstraum vom Fliegen lebe ich beim Drachen- und Gleitschirmfliegen noch heute aus. Auch das Salsa tanzen ist nur eine neue Variante meiner alten Leidenschaft für Musikmachen. In dieser Kontinuität gebahnter, neuronaler Prädispositionen ist Abstinenz so irrelevant, weil sie automatisch da ist. Ich muss nicht an ihr arbeiten.
„Woher haben sie das neurobiologische Vokabular?“
„Das war Teil meines molekularbiologischen Schwerpunkts und ist noch Hintergrundwissen für spezielle Fragen der Pharmakologie in meinem Job.“
„Das ist sehr spannend, aber uns bleibt keine Zeit mehr das zu vertiefen. Mein Gott ist das spät. Ein Glück, dass niemand mehr nach Ihnen kommt. Wir können das jetzt leider nicht weiter ausführen. Für weitere Fragen bleibt keine Zeit. Ich breche hier mal ab. Im Prinzip sind wir ja durch.“
Ich sah wie die Gutachterin am PC durch ihre Mitschrift blätterte. Suchte sie doch noch nach weiteren Fragen? Mein Blick auf die Uhr bestätigte ihre Vermutung. Ich hatte reichlich überzogen. Sie ging noch schnell einige meiner Aussagen durch, um wie sie meinte, Missverständnisse auszuschließen.
„Wir sind soweit durch“, sagte sie nach einigen Minuten nochmal und blickte auf. Dann fügte sie an: „Es sind noch weitere Überlegungen anzustellen, aber wahrscheinlich wird das Ergebnis meiner Untersuchung negativ ausfallen.“
Ich reagierte nicht und sie erklärte weiter, dass für eine positive Bewertung der Nachweis einer Abstinenz über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr zwingend erforderlich ist. Außerdem falle es ihr leichter eine positive Haltung einzunehmen, wenn bereits eine Therapie gemacht wurde. Die positive Prognose eines Therapeuten sei immer eine überzeugende Unterstützung bei ihrem Urteil.
Das war es also. Mit diesem Ende hatte ich nicht gerechnet. Ich konnte also von Anfang an diese MPU nicht schaffen. Es fehlten Voraussetzungen. Ich hatte kein Ergebnis einer Therapie vorliegen und konnte auch nicht ein ganzes Jahr Abstinenz dokumentieren. Dabei hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich hatte alle Fragen zufriedenstellend beantwortet. Das schien wohl nicht genug zu sein. Wieso hatte sie das nicht gleich am Anfang gesagt? Wieso hatten wir uns auf diese Untersuchung eingelassen, wenn etwas von Anfang an fehlte. Warum hatte sie die Untersuchung durchgeführt, wenn nichts dabei rauskommen konnte? Wenn es nichts nützte, mich aufs Persönlichste zu erklären, dann will ich das auch nicht tun. Schließlich musste ich mit der Möglichkeit rechnen, dass alles, was ich hier sagte, bei der nächsten MPU gegen mich verwandt werden konnte.
„Ganz bestimmt nicht“, wiegelte sie meinen Einwand ab: „Wir wollen doch alle nur das beste. Wenn Sie schon mal hier sind, dürfen Sie doch ruhig erfahren, wo Sie stehen.“
„Ein teurer Testlauf“, warf ich resignierend ein.
„Aber auch eine Bestätigung, dass es hoffnungsvoll aussieht. Mit der Dokumentation der Abstinenz und vielleicht einem Therapeuten sind ihre Chancen doch gut.“
Das mochte aus ihrer Sicht ja so scheinen, aber wie würde das beim nächsten Mal wirklich aussehen? Ein negatives Gutachten konnte kein gutes Entré für die nächste Begutachtung sein, auch dann nicht, wenn die Gutachterin der Meinung war, das ich das schon schaffen müsste, wenn ich ausreichend Abstinenznachweise und eine Therapie nachweisen könnte.
Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste war, dass niemand verpflichtet ist, Gutachten an die Verkehrsbehörde zu schicken. Der Klient ist der Auftraggeber. Er allein entscheidet über die Verwendung. Es ist falsch anzunehmen, weil die MPU unter Mitwirkung und mit Hilfe der Akten der Verkehrsbehörde durchgeführt wird, dass die Behörde Anspruch hat auf eine der beiden Kopien, die der Auftraggeber von dem Gutachter erhält. Der Klient kann jederzeit eine MPU beantragen. Es ist sinnvoll, erst bei Erfolg eine Kopie des Gutachtens an die Führerscheinstelle zu schicken.
Was blieb mir übrig, als mich zu verabschieden und zu gehen. Sie hatte es immerhin gut gemeint und war sehr freundlich. Jedenfalls war absolut klar, wie es weitergehen musste. Ich würde weiterhin Abstinenz dokumentieren bis ich Nachweise für ein ganzes Kalenderjahr gesammelt hätte, um dann erneut eine MPU zu beantragen. In der Zwischenzeit würde ich eine Therapie machen. Meine Enttäuschung ließ etwas nach. Es ist leichter Ärger abzuschütteln, in einem Moment, wo man einen Ausweg sieht. Wenn man weiß, was die Ursache für einen Zustand ist und klar ist, welche Maßnahmen zu treffen sind, dann wird ein Ziel wieder greifbar und man kann trotz der Strecke, die noch vor einem liegt, wieder lachen.